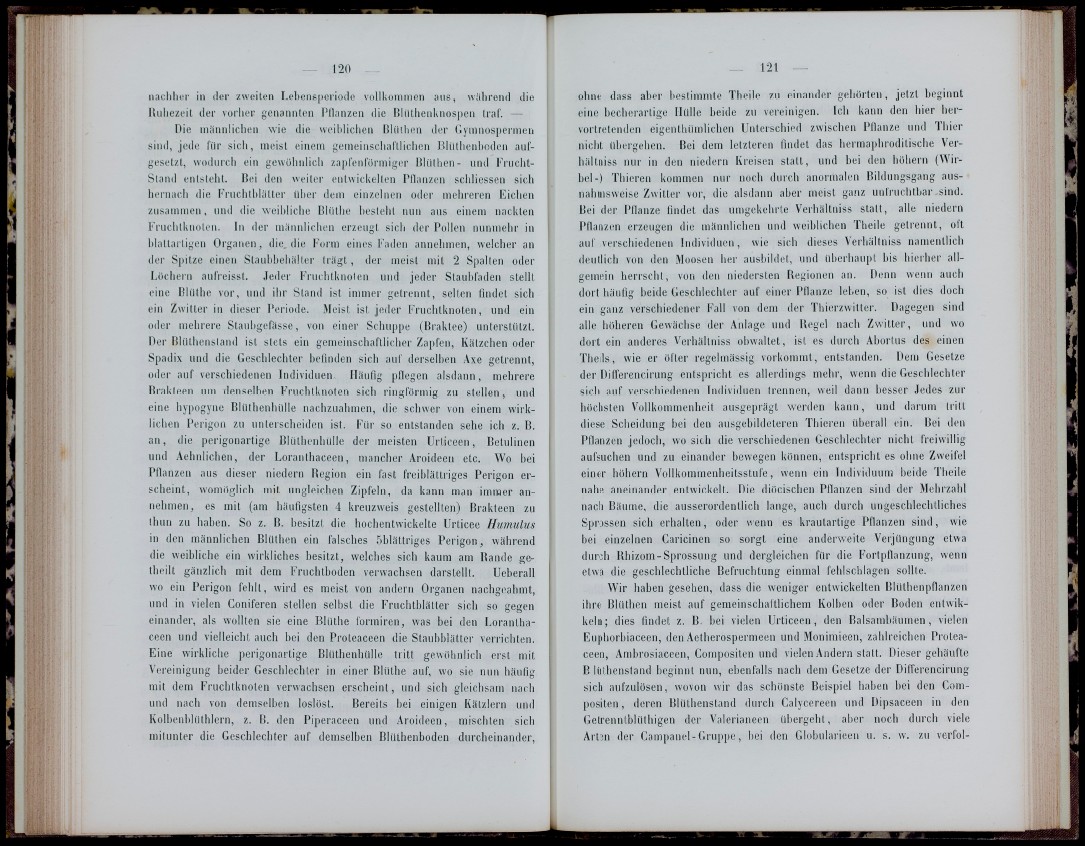
120 121
naclihiM' in der zweiten Lebeiisi)criode vollkoninien a u s , wahr end die
Uuliezeit der vorher genannten IMlanzen die Bliithenknos])en traf. —
Die nuinnlichen wie die weibliclien Bhiihen der Gymnospermen
sind, jede für siel», meist einem gemeinschaRltchen Bliilhenhoden aufgesetzt,
wo(hirch ein gewohnlieh zaj)renformiger BUUhen- und Frucht-
Stand entsteht. Bei den weiter entwickelten Pflanzen schliessen sich
hernach die Fruchtblätter über dem einzelnen oder mehreren Eichen
zusammen, und die weihliche Bliithe besteht nun aus einem nackten
Fruchtknoten. In der männlichen erzeugt sich der Pollen nunmehr in
blattartigen Organen^ die die Form eines Faden annelimen, welcher an
der Spitze einen Staubbehälter trägt , der meist mit 2 Spalten oder
Lochern aufreisst. Jeder Fruchtknoien und jeder Staubfaden stellt
eine Dliithe vor, und ihr Stand ist immer getrennt, selten findet sich
ein Zwitter in dieser Periode. Meist ist jeder Fruchtknoten, und ein
oder mehrere Staubgefässe, von einer Schuppe (Braktee) unterstützt.
Der Blüthensland ist stets ein gemeinschaftlicher Zapfen, Kätzchen oder
Spadix und die Geschlechter befinden sich auf derselben Axe getrennt,
oder auf verschiedenen Individuen- Häufig pflegen alsdann, mehrere
Brakteen um denselben Fruchtknoten sich ringförmig zu stellen, und
eine hypogyne Blüthenhülle nachzuahmen, die schwer von einem wirklichen
Perigon zu nntei'scheiden ist. Für so entstanden sehe ich z. B.
a n , die perigonartige Blüthenhülle der meisten Urticeen, Betulinen
und Aehnlichen, der Loranthaceen, mancher Äroideen etc. Wo bei
Pflanzen aus dieser niedern Region ein fast freiblättriges Perigon erscheint,
womöglich mit ungleichen Zipfeln, da kann man immer annehmen^
es mit (am häufigsten 4 kreuzweis gestellten) Brakteen zu
thun zu haben. So z. B. besitzt die hochentwickelte Urticee Humulus
in den männlichen Blütlien ein falsches Sblättriges Perigon, während
die weibliche ein wirkliches besitzt, welches sich kaum am Rande getheilt
gänzlich mit dem Fruchtboden verwachsen darstellt. Ueberall
wo ein Perigon fehlt, wird es meist von andern Organen nachgeahmt,
und in vielen Coniferen stellen selbst die Fruchtblätter sich so gegen
einander, als wollten sie eine Blüthe formiren, was bei den Loranthaceen
und vielleicht auch bei den Proteaceen die Staubblätter verrichten.
Eine wirkliche perigonartige Blüthenhülle tritt gewöhnlich erst mit
Vereinigung beider Geschlechter in einer Blüthe auf, wo sie nun häufig
mit dem Fruchtknoten verwachsen erscheint, und sich gleichsam nach
und nach von demselben loslöst. Bereits bei einigen Kätzlern und
Kolbenblüthlern, z. B. den Piperaceen und Äroideen, mischten sich
mitunter die Geschlechter auf demselben Blüthenboden durcheinander.
ohne dass aber bestimmte Theile zu einander geliörteu, jetzt beginnt
eine becherartige Hülle beide zu vereinigen. Ich kann den hier hervortretenden
eigenthümlichen Unterschied zwischen Pflanze und Thier
nicht übergehen. Bei dem letzteren findet das hermaphroditische Verhältniss
nur in den niedern Kreisen statt, und bei den höhern (Wirbel)
Tliieren kommen nur noch durch anormalen Bildungsgang ausnahmsweise
Zwitter vor, die alsdann aber meist ganz unfruchtbar sind.
Bei der Pflanze findet das umgekehrte Verhältniss statt, alle niedern
Pflanzen erzeugen die männlichen und weiblichen Theile getrennt, oft
auf verschiedenen Individuen, wie sich dieses Verhältniss namentlich
deutlich von den Moosen her ausbildet, und überhaupt bis hierher allgemein
herrscht, von den niedersten Regionen an. Denn wenn auch
dort häufig beide Geschlechter auf einer Pflanze leben, so ist dies doch
ein ganz verschiedener Fall von dem der Thierzwitter. Dagegen sind
alle höheren Gewächse der Anlage und Regel nach Zwitter, und wo
dort ein anderes Verhältniss obwaltet, ist es durch Abortus des einen
Tlieils, wie er öfter regelmässig vorkommt, entstanden. Dem Gesetze
der Difl^erencirung entspricht es allerdings mehr, wenn die Geschlechter
sich auf verschiedenen Individuen trennen, weil dann besser Jedes zur
höchsten Vollkommenheit ausgeprägt werden kann, und darum tritt
diese Scheidung bei den ausgebildeteren Thieren überall ein. Bei den
Pflanzen jedoch, wo sich die verschiedenen Geschlechter nicht freiwillig
aufsuchen und zu einander bewegen können, entspricht es ohne Zweifel
einer höhern Vollkommenheitsstufe, wenn ein Individuum beide Theile
nahe aneinander entwickelt. Die diöcischen Pflanzen sind der Mehrzahl
nach Bäume, die ausserordentlich lange, auch durch ungeschlechtliches
Sprossen sich erhalten, oder wenn es krautartige Pflanzen sind, wie
bei einzelnen Caricinen so sorgt eine anderweite Verjüngung etwa
durch Rhizom-Sprossung und dergleichen für die Fortpflanzung, wenn
etwa die geschlechtliche Befruchtung einmal fehlschlagen sollte.
Wir haben gesehen, dass die weniger entwickelten Blüthenpflanzen
ihre Blüthen meist auf gemeinschaftlichem Kolben oder Boden entwikkeln;
dies findet z, B. bei vielen Urticeen, den Balsambäumen, vielen
Euphorbiaceen, den Aetherospermeen und Monimieen, zahlreichen Proteaceen,
Ambrosiaceen, Compositen und vielen Andern statt. Dieser gehäufte
Blüthensland beginnt nun, ebenfalls nach dem Gesetze der DifTerencirung
sich aufzulösen, wovon wir das schönste Beispiel haben bei den Compositen,
deren Blüthensland durch Calycereen und Dipsaceen in den
Getrenntblüthigen der Valerianeen übergeht, aber noch durch viele
Arten der Campanel - G r u p p e , bei den Globnlarieen u. s. w. zu verfol-
Hill: