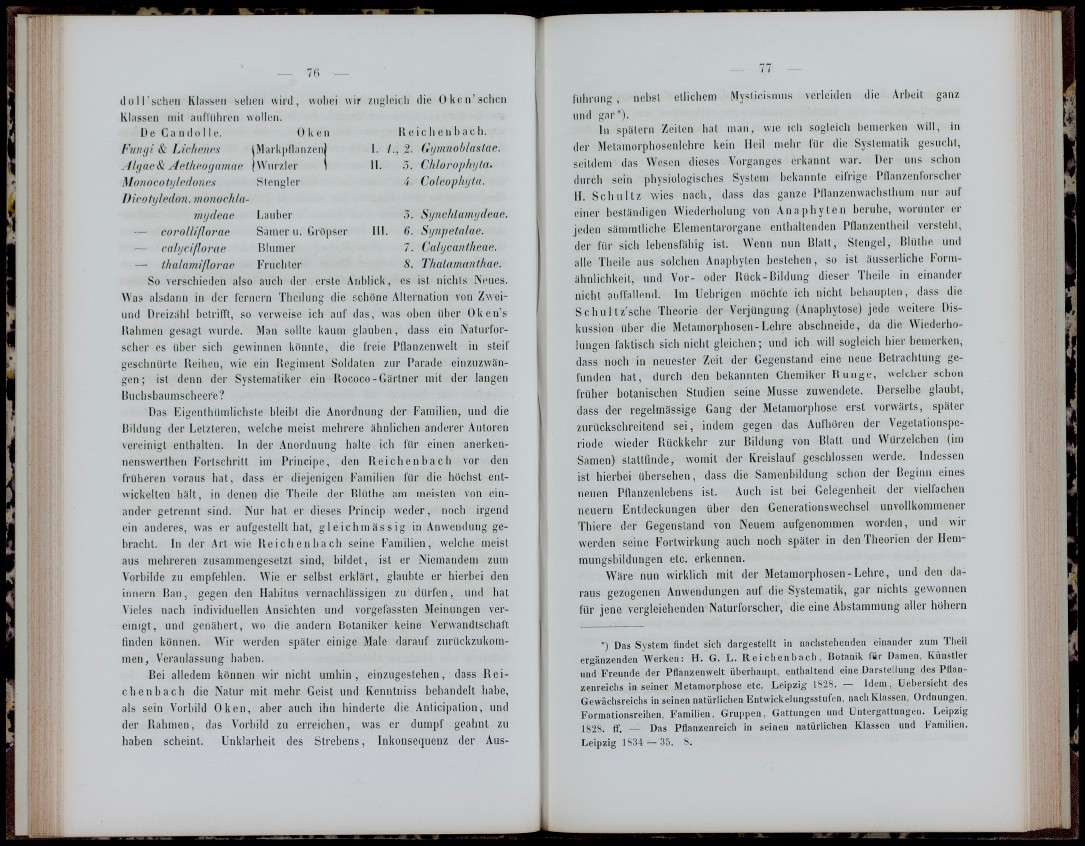
, , . ....
I a
!
c l ü l T s c h e n Klassen sehen wird, wobei wir zugleich die Oken'sehen
Klassen inil aufrühren wollen.
U e i c h e II b a c li.
I. /,^ 2. Gijninoblastae.
II. 5. Chlorophijta.
4. Colcophyta.
rnydeae
~ corolUfJorae
— caJijci[l()rae
— thalainillorae
III.
5. Synclilamydeae.
6. Syiipetalae,
7. Calycantheae.
8. Thalamanthae.
De C a n d o l i e. 0 k e a
Fiingi & Lichencs jiMarkptlanzen
. / ly a 0 & Ae th (* oy a m ae | \ V u r z I e r
M 0 n 0 c 0 ty ledo n es S t e n g 1 e r
l)fr0 tyJedon. m onochIn-
Lauber
S a m e r n . Gröpser
BInmer
Frucliter
So verschieden also auch der erste Anblick, es ist nichts Neues.
Was alsdann in der fernern Theihuig die schöne Alternation von Zweinnd
Dreizahl betrilTt, so verweise ich auf das, was oben über Oken's
Rahmen gesagt wurde. Man sollte kaum glauben, dass ein Naturforscher
es über sich gewinnen könnte, die freie Pflanzenwelt in steif
geschnürte Reihen, w^ie ein Regiment Soldaten zur Parade einzuzwängen;
ist denn der Systematiker ein Rococo - Gär tner mit der langen
Buchsbaumscheere?
Das Eigenthümlichste bleibt die Anordnung der Familien, und die
Bildung der Letzteren, welche meist mehrere ähnlichen anderer Autoren
vereinigt enthalten. In der Anordnung halte ich für einen anerkennenswerthen
Fortschritt im Principe, den R ei c h e n b a c h vor den
früheren voraus hat, dass er diejenigen Familien für die hüclist entwickelten
hält, in denen die Theile der Blüthe am meisten von einander
getrennt sind. Nur hat er dieses Princip weder, noch irgend
ein anderes, was er aufgestellt hat, g l e i c hmä s s i g in Anwendung gebracht.
In der Art wie R e i c h e n b a c h seine Familien, welche meist
aus mehreren zusammengesetzt sind, bildet, ist er Niemandem zum
Vorbilde zu empfehlen. Wie er selbst erklärt, glaubte er hierbei den
innern Bau, gegen den Habitus vernachlässigen zu dürfen, und hat
Vieles nach individuellen Ansichten und vorgefassten Meinungen vere
i n i g t , und genähert, wo die andern Botaniker keine Verwandtschaft
finden können. Wir werden später einige Male darauf zurückzukomm
e n , Veranlassung haben.
Bei alledem können wir nicht umhin, einzugestehen, dass Reic
h e n b a c h die Natur mit mehr Geist und Kenntniss behandelt habe,
als sein Vorbild Oken, aber auch ihn hinderte die Anticipation, und
der Rahmen, das Vorbild zu erreichen, was er dumpf geahnt zu
haben scheint. Unklarheit des Strebens, Inkonsequenz der Ausführung
, nebst etlichem Mysticismus verleiden die Arbeit ganz
und gar*).
In spätem Zeiten hat man, wie ich sogleich bemerken will, in
der Metamorphoscnlehre kein Heil mehr für die Systematik gesucht,
seitden-i das Wesen dieses Vorganges erkannt war. Der uns schon
durch sein physiologisches System bekannte eifrige Pllanzenforscher
H. S c h u l t z wies nach, dass das ganze Pilanzenwachsthum nur auf
einer beständigen Wiederholung von A n a p h y t e n beruhe, worunter er
jeden sämmtliche Elementarorgane entiialtenden Pflanzentheil verstehl,
der für sich lebensfähig ist. Wenn nun Blatt, Stengel, Blüthe und
alle Theile aus solchen Anaphyten bestehen, so ist äusserliche Formähnlichkeit,
und Vor- oder Rück-Bildung dieser Theile in einander
nicht auffallend. Im Uebrigen möchte ich nicht behaupten, dass die
S c h u l t z ' s c h e Theorie der Verjüngung (Anaphytose) jede weitere Diskussion
über die Metamorphosen-Lehre abschneide, da die W^iederholungen
faktisch sich nicht gleichen; und ich will sogleich hier bemerken,
dass noch in neuester Zeit der Gegenstand eine neue Betrachtung gefunden
hat, durch den bekannten Chemiker Runge, welcher schon
f r ü h e r botanischen Studien seine Müsse zuwendete. Derselbe glaubt,
dass der regelmässige Gang der Metamorphose erst vorwärts, später
zurückschreitend sei, indem gegen das Aufhören der Vegetationsperiode
wieder Rückkehr zur Rildung von Blatt und Würzelchen (im
Samen) stattfinde, womit der Kreislauf geschlossen werde. Indessen
ist hierbei übersehen, dass die Samenbildung schon der Beginn eines
neuen Pflanzenlebens ist. Auch ist bei Gelegenheit der vielfachen
neuern Entdeckungen über den Generationswechsel unvollkommener
Thiere der Gegenstand von Neuem aufgenommen worden, und wir
werden seine Fortwirkung auch noch später in den Theorien der Hemmungsbildungen
etc. erkennen.
Wäre nun wirklich mit der Metamorphosen-Lehre, und den daraus
gezogenen Anwendungen auf die Systematik, gar nichts gewonnen
für jene vergleiehenden Naturforscher, die eine Abstammung aller hohem
*) Das System findet sich dargestellt in nachstehenden einander zum Theil
ergänzenden Werken: H. G. L. R e i chenba ch, Botanik für Damen, Künstler
und Freunde der Pflanzenwelt überhaupt, enthaltend eine Darstellung des Pflanzenreichs
in seiner Metamorphose etc. Leipzig 1828. — Idem, Uebersicht des
Gewächsreichs in seinen natürlichen Entwickeluni^sstufen, nach Klassen, Ordnungen,
Formationsreihen, Familien, Gruppen, Gattungen und Untergattungen. Leipzig
1828. ff. — Das Pflanzenreich in seinen natürlichen Klassen und Familien»
Leipzig 1834 — 35. 8.
• rf
• T ;
. 1
l' "'i
i r • i
I,