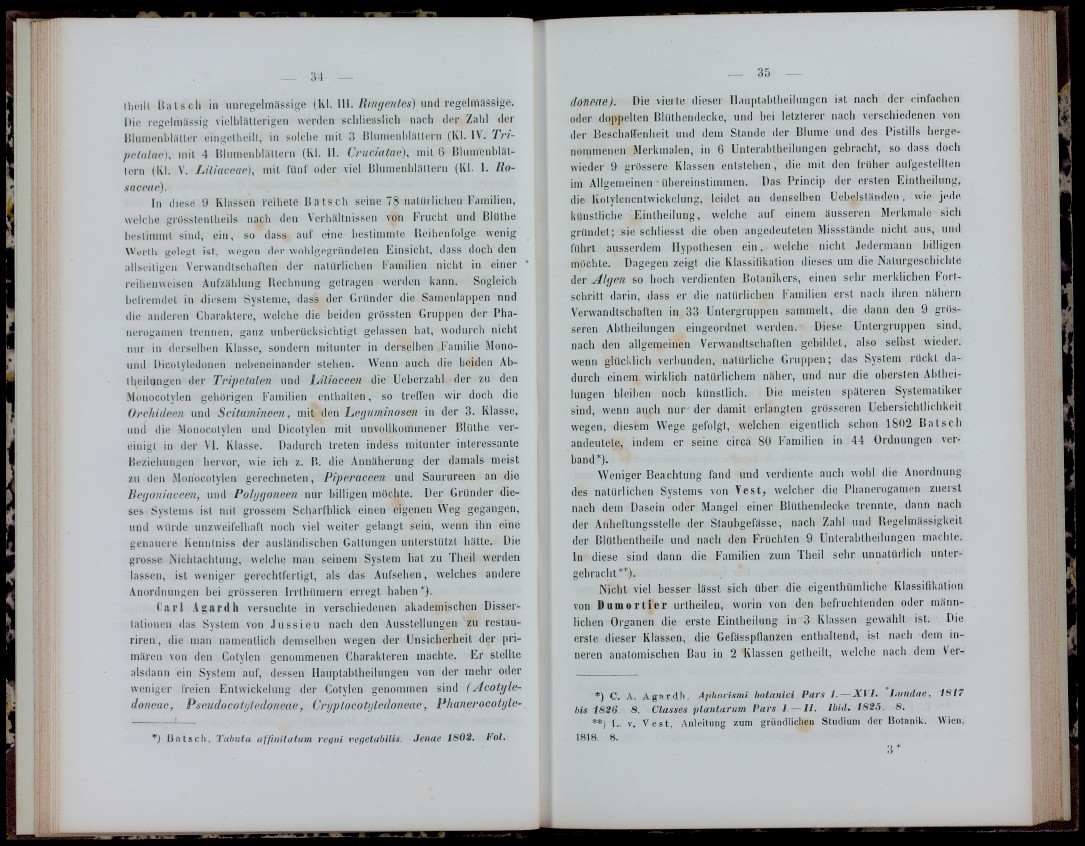
- 34 —
ihcill Balsch in iniregelmässige (Kl. I I I . u n d regelmässige.
Die regelmässig vielbläLterigen werden scliiiesslich nach der Zahl der
Blumenlilätler eingelheill, in solche mil 3 Blumenhlällern (Kl. IV. Tripctalac),
mit 4 Blmnenblällern (Kl. 11. Criic/atae), mil 6 Blumenblällern
(Kl. V. LiLiaceae), mit limt' oder viel Blumenblätlern (Kl. 1. Rosaccae).
In diese 9 Klassen reihetc B a t s c h seine 78 natürlichen Familien,
welche grüsstenlheils nach den Verhältnissen von Frucht und Blüthe
l)eslimml sind, ein, so dass auf eine bestimmte Beihonfolge wenig
Wertli gelegt ist, wegen der wohlgegründeten Einsicht, dass doch den
allseiligen Verwandischarten der natürlichen Familien nicht in einer
i'eilienweisen Aufzählung Rechnung getragen werden kann. Sogleich
helVenulet in diesem Systeme, dass der Gründer die Samenlappen nnd
die anderen Charaktere, welche die beiden grössten Gruppen der Phanerogamen
trennen, ganz unberücksichtigt gelassen hat, wodurch nicht
nur in derselben Klasse, sondern mitunter in derselben Familie Mononnd
Dicülyledonen nebeneinander stehen. V^enn auch die beiden Abtheilungen
der IVipetaleii und Lüiaceen die Ueberzahl der zu den
Monocotylen gehörigen Familien enthalten, so treffen wir doch die
Orchideen und Scitamineen, mit den LegiimiJiosen in der 3. Klasse,
und die Monocotylen und Dicotylen mit unvollkommener Blülbe vereinigt
in der VI. Klasse. Dadurch treten indess mitunter interessante
Beziehungen hervor, wie ich z. B. die Annäherung der damals meist
zu den Monocotylen gerechneten, Piperaceen und Saurureen an die
Beyon/aceen, und PoUjgoneeii nur billigen möchte. Der Gründer dieses
Systems ist mit grossem Scharfblick einen eigenen Weg gegangen,
mul würde unzweifelhaft noch viel weiter gelangt sein, wenn ihn eine
g e n a u e r e Kennlniss der ausländischen Gattungen unterstützt hätte. Die
grosse Nichtachtung, welche man seinem System bat zu Theil werden
lassen, ist weniger gerechtfertigt, als das Aufseben, welches andere
Anordnungen bei grösseren Irrthümern erregt haben*).
C a r l Ägardh versuchte in verschiedenen akademischen Dissertationen
das System von Jus s i e u nach den Ausstellungen zu restaur
i r e n , die man namentlich demselben wegen der Unsicherheit der primären
von den Cotylen genommenen Charakteren machte. Er stellte
alsdann ein System auf, dessen Ilauptabtheilungen von der mehr oder
weniger freien Entwickelung der Cotylen genommen sind (Acotyledoneae,
Pseudocotyledoneae, Crijpiocotyledoneae, Phanerocotyle-
B a t s c h , Tabjita affinitatum reqni vegetabilis. Jenae 1802. Fol.
3 5 ^
doneae). Die vierte dieser Ilauptabtheilungen ist nach der einfachen
oder doppelten Blüthendecke, und bei letzterer nach verschiedenen von
der Beschaiienheit und dem Stande der Blume und des Pistills hergenommenen
Merkmalen, in 6 Unterabtheilungen gebracht, so dass doch
wieder 9 grössere Klassen entstehen , die mit den früher aufgestellten
im Allgemeinen'übereinstimmen. Das Princip der ersten Eintbeilung,
die Kolylenentwickelung, leidet an denselben Uebelständen, wie jede
künstliche Eintbeilung, welche auf einem äusseren Merkmale sich
g r ü n d e t ; sie schliesst die oben angedeuteten Missstände nicht aus, und
führt ausserdem Hypothesen ein, welche nicht Jedermann billigen
möchte. Dagegen zeigt die Klassifikation dieses um die Naturgeschichte
der Algen so hoch verdienten Botanikers, einen sehr merklichen Fortschritt
darin, dass er die natürlichen Familien erst nach ihren nähern
Verwandtschaften in 33 Untergruppen sammelt, die dann den 9 grosseren
Abtbeilungen eingeordnet werden. Diese Untergruppen sind,
nach den allgemeinen Verwandtschaften gebildet, also selbst wieder,
wenn glücklich verbunden, natürliche Gruppen; das System rückt dadurch
einem wirklich natürlichem näher, und nur die obersten Abtheilungen
bleiben noch künstlich. Die meisten späteren Systematiker
sind, wenn auch nur der damit erlangten grösseren Uebersichtlichkeit
wegen, diesem Wege gefolgt, welchen eigentlich .schon 1802 Batsch
andeutete, indem er seine circa 80 Familien in 44 Ordnungen verband*).
Weniger Beachtung fand und verdiente auch wohl die Anordnung
des natürlichen Systems von Vest^ welcher die Phanerogamen zuerst
nach dem Dasein oder Mangel einer Blüthendecke trennte, dann nach
der Anheftungsstelle der Staubgefässe, nach Zahl und Ilegelmässigkeit
der Blüthentheile und nach den Früchten 9 Unterabtheilungen machte.
In diese sind dann die Familien zum Theil sehr unnatürlich untergebracht**).
Nicht viel besser lässt sich über die eigenthümliche Klassifikation
von » u m o r t l e r urtheilen, worin von den befruchtenden oder männlichen
Organen die erste Eintbeilung in 3 Klassen gewählt ist. Die
erste dieser Klassen, die Gefässpflanzen enthaltend, ist nach dem inneren
anatomischen Bau in 2 Klassen gelheilt, welche nach dem Ver-
*) C. A. Agardh, Aphorismi botanici Pars !.-~XVL ^Limdae, 1817
bis 1826. 8. Classes plantarum Pars I — II. Ibid. 1825. 8.
**) L. V. Ves t , Anleitung zum gründiichen Studium der Botanik. Wien,
1818. 8.
ii^iHi
I ^ • rfi . t ' . .?.
>
i
r