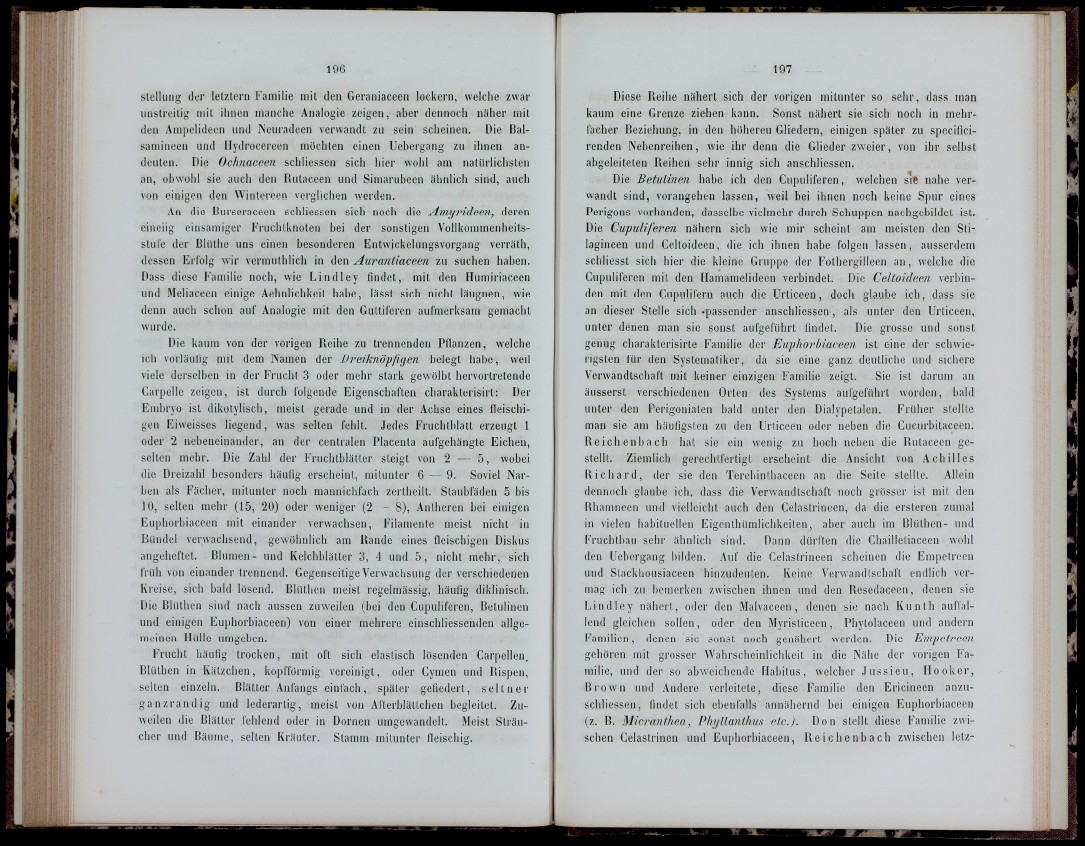
196
Stellung der letztern Familie mit den Geraniaceen lockern, welche zwar
unstreitig mit ihnen manche Analogie zeigen, aber dennoch näher mit
den Ämpelideon und INeuradeen verwandt zu sein scheinen. Die Balsamineen
und Ilydrocereen mochten einen Uebergang zu ihnen andeuten.
Die Ochnaceeii schliessen sich hier wohl am natiniichsten
an, obwohl sie auch den Rutaceen und Simarubeen ähnlich sind, auch
von einigen den Wintereen verglichen werden.
An die Burseracecn schliessen sich noch die Amyrideen^ deren
eineiig einsaniiger Fruchtknoten bei der sonstigen Vollkommenheitsstul'e
der ßlütiie uns einen besonderen Entwickelungsvorgang verräth,
dessen Erfolg wir vermuthlich in den Aurantiaceen zu suchen haben.
Dass diese Familie noch, wie Lindley findet, mit den Humiriaceen
und Meliaceen einige Aehnlichkeit habe, lässt sich nicht läugnen, wie
denn auch schon auf Analogie mit den Guttiferen aufmerksam gemacht
wurde.
Die kaum von der vorigen Reihe zu trennenden Pflanzen, welche
ich vorUiuiig mit dem Namen der Dreiknöpfigen belegt habe, weil
viele derselben in der Frucht 3 oder mehr stark gewölbt hervortretende
Carpelle zeigen, ist durch folgende Eigenschaften charakterisirt: Der
Embryo ist dikolylisch, meist gerade und in der Achse eines fleischigen
Eiweisses liegend, was selten fehlt. Jedes Fruchtblatt erzeugt 1
oder 2 nebeneinander, an der centralen Placenta aufgehängte Eichen,
seilen mehr. Die Zahl der Fruchtblätter steigat von 2 — 5 , wobei
die Dreizahl besonders häufig erscheint, mitunter 6 — 9. Soviel Narben
als Fächer, mitunter noch mannichfach zertheilt. Staubfäden 5 bis
10, selten mehr (15, 20) oder weniger (2 - 8), Antheren bei einigen
Euphorbiaceen mit einander verwachsen, Filamente meist nicht in
Bündel verwachsend, gewöhnlich am Rande eines fleischigen Diskus
angeheftet. Blumen- und Kelchblätter 3, 4 und 5, nicht mehr, sich
früh von einander trennend. Gegenseitige Verwachsung der verschiedenen
Kreise, sich bald lösend. Blüthen meist regelmässig, häufig diklinisch.
Die Blüthen sind nach aussen zuweilen (bei den Cupuliferen, Betulinen
und einigen Euphorbiaceen) von einer mehrere einschliessenden allgemeinen
Hülle umgeben.
Frucht häufig trocken, mit oft sich elastisch lösenden Carpellen.
Blüthen in Kätzchen, kopfförmig vereinigt, oder Cymen und Rispen,
selten einzeln. Blätter Anfangs einfach, später gefiedert, seltner
g a n z r a n d i g und lederartig, meist von Afterblättchen begleitet. Zuweilen
die Blätter fehlend oder in Dornen umgewandelt. Meist Sträucher
und Bäume, selten Kräuter. Stamm mitunter fleischio-.
197
Diese Reihe nähert sich der vorigen mitunter so sehr, dass man
kaum eine Grenze ziehen kann. Sonst nähert sie sich noch in mehrfacher
Bezieliung, in den höhereu Gliedern, einigen später zu specificirenden
Nebenreihen, wie ihr denn die Glieder zweier, von ihr selbst
abgeleiteten Reihen sehr innig sich anschliessen.
Die Betulinen habe ich den Cupuliferen, welchen sie nahe verwandt
sind, vorangehen lassen, weil bei ihnen noch keine Spur eines
Perigons vorhanden, dasselbe vielmehr durch Schuppen nachgebildet ist.
Die Cupuliferen nähern sich wie mir scheint am meisten den Stilagineen
und Celtoideen, die ich ihnen habe folgen lassen, ausserdem
schliesst sich hier die kleine Gruppe der Fothergilleen an, welche die
Cupuliferen mit den Ilamamelideen verbindet. Die Celtoideen verbinden
mit den Cupulifern auch die Urticeen, doch glaube ich, dass sie
an dieser Stelle sich -passender anschliessen , als unter den Urticeen,
unter denen man sie sonst auf^^eführt findet. Die grosse und sonst
genug charakterisirte Familie der Euphorbiaceen ist eine der schwierigsten
für den Systematiker, da sie eine ganz deutliche und sichere
Verwandtschaft mit keiner einzigen Familie zeigt. Sie ist darum an
äusserst verschiedenen Orten des Systems aufgeführt worden, bald
unter den Perigoniaten bald unter den Dialypetalen. Früher stellte
man sie am häufigsten zu den Urticeen oder neben die Cucurbitaceen.
R e i c h e n b a c h hat sie ein wenig zu hoch neben die Rutaceen gestellt.
Ziemlich gerechtfertigt erscheint die Ansicht von Achilles
R i c h a r d , der sie den Terebinthaceen an die Seite stellte. Allein
dennoch glaube ich, dass die Verwandtschaft noch grösser ist mit den
Rhamneen und vielleicht auch den Celastrineen, da die ersteren zumal
in vielen habituellen Eigenthümlichkeiten, aber auch im Blüthen- und
Fruchtbau sehr ähnlich sind. Dann dürften die Chailleliaceen wohl
den Uebergang bilden. Auf die Celastrineen scheinen die Empetreen
und Stackhousiaceen hinzudeuten. Keine Verwandtschaft endlich vermag
ich zu bemerken zwischen ihnen und den Resedaceen, denen sie
L i n d l e y nähert, oder den Malvaceen, denen sie nach Kunt h auffallend
gleichen sollen, oder den Myristiceen, Phytolaceen und andern
Familien, denen sie sonst noch genähert werden. Die Empetreen
gehören mit grosser Wahrscheinlichkeit in die Nähe der vorigen Familie,
und der so abweichende Habitus, welcher Jussieu, Hooker^
R r o w n und Andere verleitete, diese Familie den Ericineen anzuschliessen,
findet sich ebenfalls annähernd bei einigen Euphorbiaceen
(z. B. Micranthea, Phyllanihus etcj, Don stellt diese Familie zwischen
Celastrinen und Euphorbiaceen, Reichenbach zwischen letz