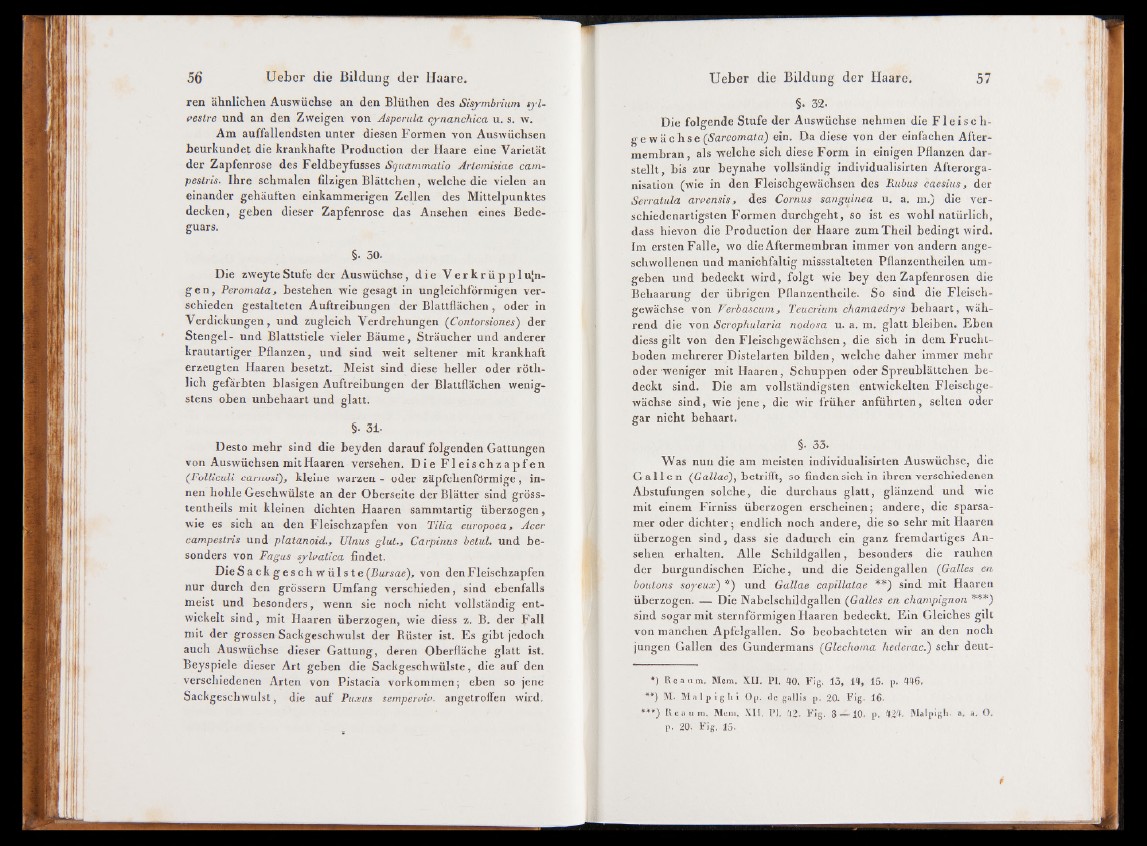
ren ähnlichen Auswüchse an den Blüthen des »Sisymbrium syl-
vestre und an den Zweigen von Asperula cynanchica u. s. w.
Am auffallendsten unter diesen Formen von Auswüchsen
beurkundet die krankhafte Production der Haare eine Varietät
der Zapfenrose des Feldbeyfusses Squammatio Artemisiae cam-
peslris. Ihre schmalen filzigen Blättchen, welche die vielen an
einander gehäuften einkammerigen Zellen des Mittelpunktes
decken, geben dieser Zapfenrose das Ansehen eines Bede-
guars.
§• 30.
Die zweyteStufe der Auswüchse, d ie Verkrüpplu|n-
gen, Peromata, bestehen wie gesagt in ungleichförmigen verschieden
gestalteten Auftreibungen der Blattflächen, oder in
Verdickungen, und zugleich Verdrehungen (Contorsiones) der
Stengel- und Blattstiele vieler Bäume, Sträucher und anderer
krautartiger Pflanzen, und sind weit seltener mit krankhaft
erzeugten Haaren besetzt. Meist sind diese heller oder röth-
lich gefärbten blasigen Auftreibungen der Blattflächen wenigstens
oben unbehaart und glatt.
§. 31.
Desto mehr sind die beyden darauf folgenden Gattungen
von Auswüchsen mit Haaren versehen. D ie F l e i s c h z a p f e n
(■Folliculi carnosi), kleine warzen - oder zäpfchenförmige, innen
hohle Geschwülste an der Oberseite der Blätter sind gröss-
tentheils mit kleinen dichten Haaren sammtartig überzogen,
wie es sich an den Fleischzapfen von Tilia europoea, Acer
campestris und platanoid., Ulnus glut., Carpinus betul. und besonders
von Fagus syloatica findet.
Die S a c k g e s c hwü l s t e (Bursae), von den Fleischzapfen
nur durch den grossem Umfang verschieden, sind ebenfalls
meist und besonders, wenn sie noch nicht vollständig entwickelt
sind, mit Haaren überzogen, wie diess z. B. der Fall
mit der grossen Sackgeschwulst der Rüster ist. Es gibt jedoch
auch Auswüchse dieser Gattung, deren Oberfläche glatt ist.
Beyspiele dieser Art geben die Sackgeschwülste, die auf den
verschiedenen Arten von Pistacla Vorkommen; eben so jene
Sackgeschwulst, die auf Puceus semperoio. angetroffen wird.
§. 32-
Die folgende Stufe der Auswüchse nehmen die F l e i s ch -
g e w ä c h s e (Sarcomata) ein. Da diese von der einfachen Aftermembran
als welche sich diese Form in einigen Pflanzen darstellt,
bis zur beynahe vollsändig individualisirten Afterorganisation
(wie in den Fleischgewächsen des Rubus caesius, der
Serratula aroensis, des Cornus sanguinea u. a. m.) die verschiedenartigsten
Formen durchgeht, so ist es wohl natürlich,
dass hievon die Production der Haare zumTheil bedingt wird.
Im ersten Falle, wo die Aftermembran immer von andern angeschwollenen
und manichfaltig missstalteten Pflanzentheilen umgeben
und bedeckt wird, folgt wie bey den Zapfenrosen die
Behaarung der übrigen Pflanzentheile. So sind die Fleischgewächse
von Verbascum, Teucrium chamaedrys behaart, während
die von Scrophularia nodosa u. a. m. glatt bleiben. Eben
diess gilt von den Fleischgewächsen, die sich in dem Fruchtboden
mehrerer Distelarten bilden, welche daher immer mehr
oder weniger mit Haaren, Schuppen oder Spreublättchen bedeckt
sind. Die am vollständigsten entwickelten Fleischgewächse
sind, wie jene, die wir früher anführten, selten oder
gar nicht behaart.
§. 33.
Was nun die am meisten individualisirten Auswüchse, die
Gai l e n (Gallae), betrifft, so finden sich in ihren verschiedenen
Abstufungen solche, die durchaus glatt, glänzend und wie
mit einem Firniss überzogen erscheinen; andere, die sparsamer
oder dichter; endlich noch andere, die so sehr mit Haaren
überzogen sind, dass sie dadurch ein ganz fremdartiges Ansehen
erhalten. Alle Schildgallen, besonders die rauhen
der burgundischen Eiche, und die Seidengallen (Galles en
boutons soyeux) und Gallae capillatae *) **) sind mit Haaren
überzogen. — Die Nabelschildgallen (Galles en Champignon ***)
sind sogar mit sternförmigen Haaren bedeckt. Ein Gleiches gilt
von manchen Apfelgallen. So beobachteten wir an den noch
jungen Gallen des Gundermans (Glechoma hederac.') sehr deut-
*) R e a u m . Mem. XII. PI. 40. Fig. 13, 14, 15. p. 446.
**) M. M a l p i g l i i Op. de gallis p. 20. Fig. 16.
***) R e a um . Mem. XII. PI. 42. F ig . 8 — 10. p. 424. Malpigh. a, a. O.
p. 20. Fig, 15.
t