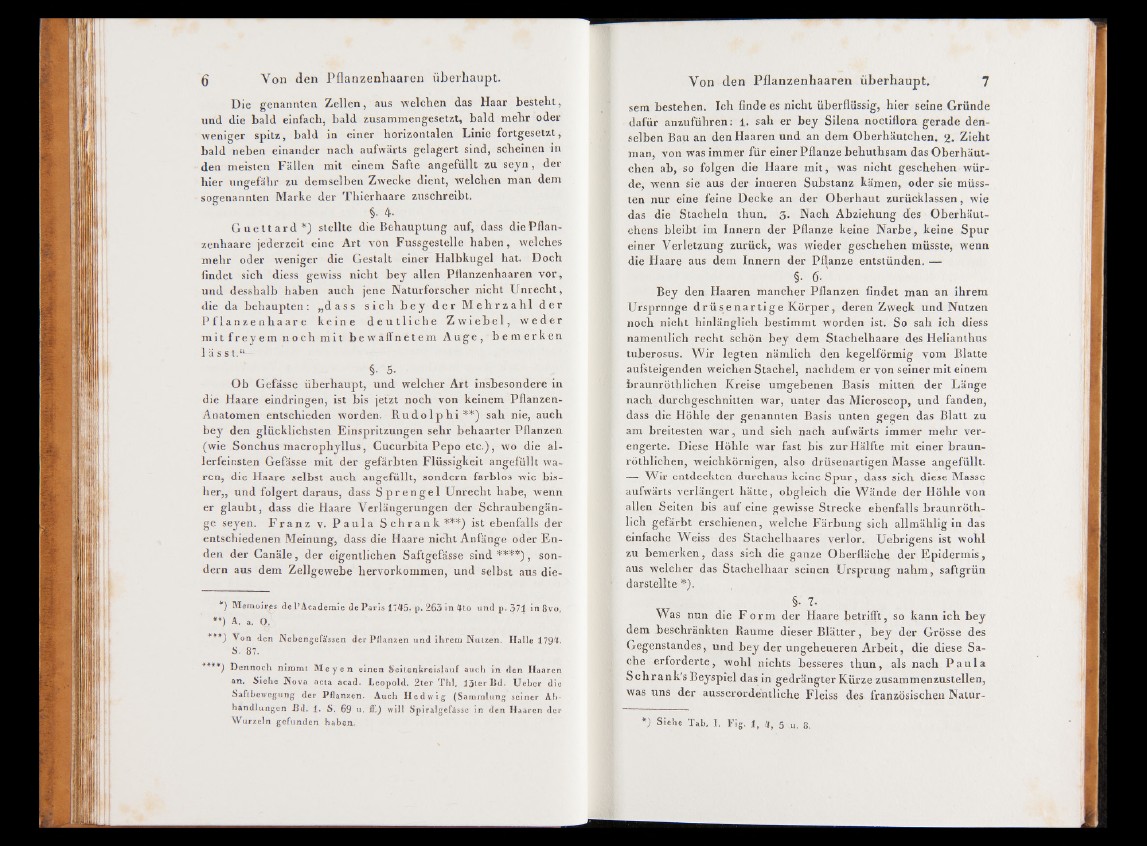
Die genannten Zellen, aus welchen das Haar besteht,
und die bald einfach, bald zusammengesetzt, bald mehr oder
weniger spitz, bald in einer horizontalen Linie fortgesetzt,
bald neben einander nach aufwärts gelagert sind, scheinen in
den meisten Fällen mit einem Safte angefiillt zu seyn, der
hier ungefähr zu demselben Zwecke dient, welchen man dem
sogenannten Marke der Thierhaare zuschreibt.
§• 4-
Gue t t a r d * ) stellte die Behauptung auf, dass diePflan-
zenhaare jederzeit eine Art von Fussgestelle haben, welches
mehr oder weniger die Gestalt einer Halbkugel hat. Doch
findet sich diess gewiss nicht bey allen Pflanzenhaaren vor,
und desshalb haben auch jene Naturforscher nicht Unrecht,
die da behaupten: „dass s i ch b e y der Me h r z a hl der
P f l an z en haare keine deu t l i c h e Zwi e b e l , weder
mit f reyem noch mi t b e w a f f ne t emAug e , bemer ken
1 ä ss t.“
§• 5.
Ob Gefasse überhaupt, und welcher Art insbesondere in
die Haare eindringen, ist bis jetzt noch von keinem Pflanzen-
Anatomen entschieden worden. Rudol p h i **) sah nie, auch
bey den glücklichsten Einspritzungen sehr behaarter Pflanzen
(wie Sonchus macrophyllus, Cucurbita Pepo etc.), wo die allerfeinsten
Gefässe mit der gefärbten Flüssigkeit angefüllt waren,
die Haare selbst auch angefüllt, sondern farblos wie bisher,,
und folgert daraus, dass S p re n ge l Unrecht habe, wenn
er glaubt, dass die Haare Verlängerungen der Schraubengänge
seyen. F ranz v. P a u l a Schrank***) ist ebenfalls der
entschiedenen Meinung, dass die Haare nicht Anfänge oder Enden
der Canäle, der eigentlichen Saftgefässe sind ****), sondern
aus dem Zellgewebe hervorkommen, und selbst aus die*)
Mémoires de l’Academie de P a ris 1745. p. 263 in 4to u nd p. 371 in 8vo,
**) A. a. O.
**) Von den Nebengefässen der Pflanzen u n d ih rem Nutzen. Halle 1794.
S. 87.
****) Dennoch n im m t M e y e n einen ^e ite n h re isfau f auch in den Haaren
an. Siehe Nova acta acad. Leopold. 2te r Thl. 1 3 te rB d . U eber die
Saftbewegung der Pflanzen. Auch He dwi g (Sammlung seiner Abhandlungen
Bd. 1 . S. 69 u. ff,-) will Spiralgefässc in den Haaren der
Wurzeln gefunden haben,
sem bestehen. Ich finde es nicht überflüssig, hier seine Gründe
dafür anzuführen: 1. sah er bey Silena noctiflora gerade denselben
Bau an den Haaren und an dem Oberhäutchen. 2. Zieht
man, von was immer für einer Pflanze behuthsam das Oberhäutchen
ab, so folgen die Haare mit, was nicht geschehen würde,
wenn sie aus der inneren Substanz kämen, oder sie müssten
nur eine feine Decke an der Oberhaut zurücklassen, wie
das die Stacheln thun. 3. Nach Abziehung des Oberhäutchens
bleibt im Innern der Pflanze keine Narbe, keine Spur
einer Verletzung zurück, wras wrieder geschehen müsste, wenn
die Haare aus dem Innern der Pflanze entstünden. —
§• 6.'
Bey den Haaren mancher Pflanzen findet man an ihrem
Ursprnnge drüsenart ige Körper, deren Zweck und Nutzen
noch nicht hinlänglich bestimmt worden ist. So sah ich diess
namentlich recht schön bey dem Stachelhaare des Helianthus
tuberosus. Wir legten nämlich den kegelförmig vom Blatte
aufsteigenden weichen Stachel, nachdem er von seiner mit einem
braunröthlichen Kreise umgebenen Basis mitten der Länge
nach durchgeschnitten war, unter das Microscop, und fanden,
dass die Höhle der genannten Basis unten gegen das Blatt zu
am breitesten war, und sich nach aufwärts immer mehr verengerte.
Diese Höhle war fast bis zur Hälfte mit einer braunröthlichen,
weichkörnigen, also drüsenartigen Masse angefüllt.
— Wir entdeckten durchaus keine Spur, dass sich diese Masse
aufwärts verlängert hätte, obgleich die Wände der Höhle von
allen Seiten bis auf eine gewisse Strecke ebenfalls braunröth-
lich gefärbt erschienen, welche Färbung sich allmählig in das
einfache Weiss des Stachelhaares verlor. Uebrigens ist wohl
zu bemerken, dass sich die ganze Oberfläche, der Epidermis,
aus welcher das Stachelhaar seinen Ursprung nahm, saftgrün
darstellte *).
§• 7.
Was nun die Form der Haare betrifft, so kann ich bey
dem beschränkten Raume dieser Blätter, bey der Grösse des
Gegenstandes, und bey der ungeheueren Arbeit, die diese Sache
erforderte, wohl nichts besseres thun, als nach Paula
Schrank’s Beyspiel das in gedrängter Kürze zusammenzustellen,
was uns der ausserordentliche Fleiss des französischen Natur-
*) Siehe Tab. I. Fig. 1 , lft 5 g.