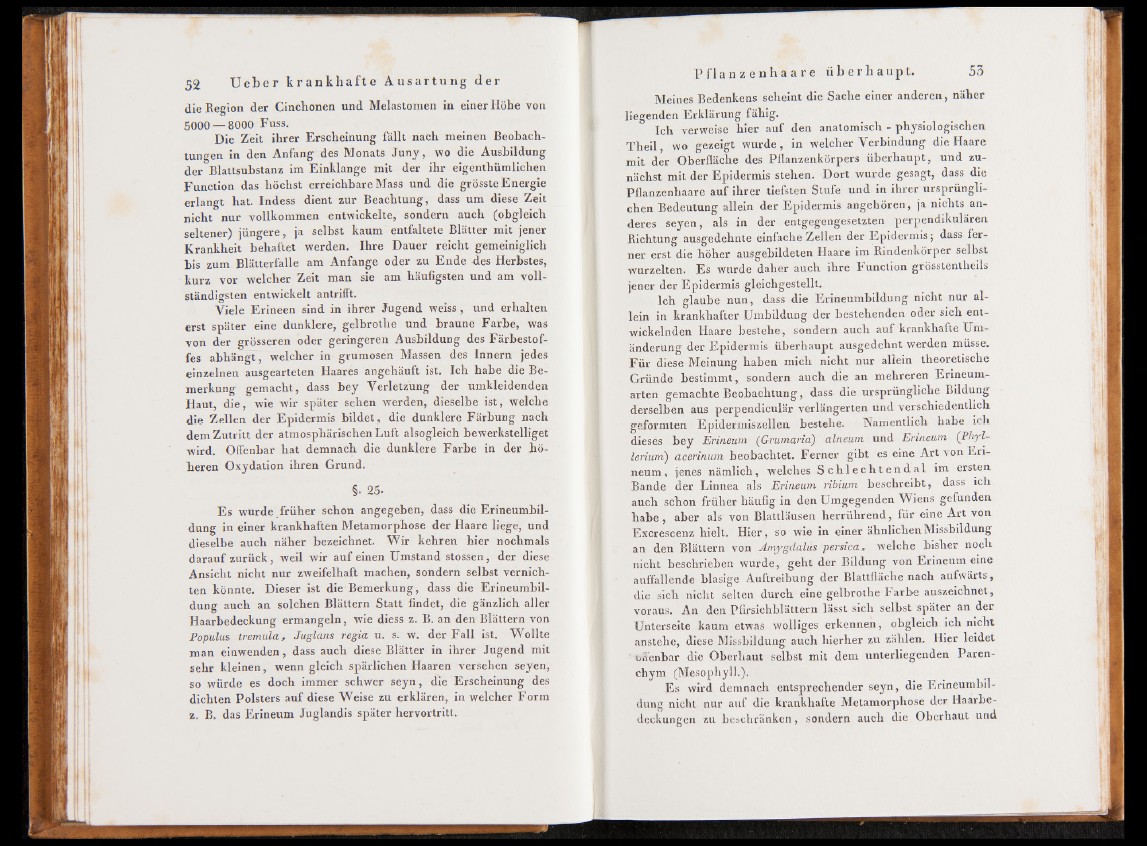
die Region der Cinchonen und Melastomen in einer Höhe von
5000 — 8000 Fuss.
Die Zeit ihrer Erscheinung fällt nach meinen Beobachtungen
in den Anfang des Monats Juny, wo die Ausbildung
der Blattsubstanz im Einklänge mit der ihr eigenthümlichen
Function das höchst erreichbare Mass und die grösste Energie
erlangt hat. Indess dient zur Beachtung, dass um diese Zeit
nicht nur vollkommen entwickelte, sondern auch (obgleich
seltener) jüngere, ja selbst kaum entfaltete Blätter mit jener
Krankheit behaftet werden. Ihre Dauer reicht gemeiniglich
bis zum Blätterfalle am Anfänge oder zu Ende des Herbstes,
kurz vor welcher Zeit man sie am häufigsten und am vollständigsten
entwickelt antrifft.
Viele Erineen sind in ihrer Jugend weiss, und erhalten
erst später eine dunklere, gelbrothe und braune Farbe, was
von der grösseren oder geringeren Ausbildung des Färbestoffes
abhängt, welcher in grumosen Massen des Innern jedes
einzelnen ausgearteten Haares angehäuft ist. Ich habe die Bemerkung
gemacht, dass bey Verletzung der umkleidenden
Haut, die, wie wir später sehen werden, dieselbe ist, welche
die Zellen der Epidermis bildet, die dunklere Färbung nach
dem Zutritt der atmosphärischen Luft alsogleich bewerkstelliget
wird. Offenbar hat demnach die dunklere Farbe in der höheren
Oxydation ihren Grund.
§. 25-
Es wurde früher schon angegeben, dass die Erineumbil-
dung in einer krankhaften Metamorphose der Haare liege, und
dieselbe auch näher bezeichnet. Wir kehren hier nochmals
darauf zurück, weil wir auf einen Umstand stossen, der diese
Ansicht nicht nur zweifelhaft machen, sondern selbst vernichten
könnte. Dieser ist die Bemerkung, dass die Erineumbil-
dung auch an solchen Blättern Statt findet, die gänzlich aller
Haarbedeckung ermangeln, wie diess z. B. an den Blättern von
Populus tremula, Juglans regia u. s. w. der Fall ist. Wollte
man einwenden, dass auch diese Blätter in ihrer Jugend mit
sehr kleinen, wenn gleich spärlichen Haaren versehen seyen,
so würde es doch immer schwer seyn, die Erscheinung des
dichten Polsters auf diese Weise zu erklären, in welcher Form
z. B. das Erineum Juglandis später hervortritt.
Pf l anz enha a r e überhaupt . 53
Meines Bedenkens scheint die Sache einer anderen, näher
liegenden Erklärung fähig.
Ich verweise hier auf den anatomisch - physiologischen
Theil, wo gezeigt wurde, in welcher Verbindung die Haare
mit der Oberfläche des Pflanzenkörpers überhaupt, und zunächst
mit der Epidermis stehen. Dort wurde gesagt, dass die
Pflanzenhaare auf ihrer tiefsten Stufe und in ihrer ursprünglichen
Bedeutung allein der Epidermis angehören, ja nichts anderes
seyen, als in der entgegengesetzten perpendikulären
Richtung ausgedehnte einfache Zellen der Epidermis; dass ferner
erst die höher ausgebildeten Haare im Rindenkörper selbst
wurzelten. Es wurde daher auch ihre Function grösstentheils
jener der Epidermis gleichgestellt.
Ich glaube nun, dass die Erineumbildung nicht nur allein
in krankhafter Umbildung der bestehenden oder sich entwickelnden
Haare bestehe, sondern auch auf krankhafte Umänderung
der Epidermis überhaupt ausgedehnt werden müsse.
Für diese Meinung haben mich nicht nur allein theoretische
Gründe bestimmt, sondern auch die an mehreren Erineum-
arten gemachte Beobachtung, dass die ursprüngliche Bildung
derselben aus perpendiculär verlängerten und verschiedentlich
geformten Epidermiszellen bestehe. Namentlich habe ich
dieses bey Erineum (Grumaria) alneum und Erineum (Phyl-
lerium) acerinum beobachtet. Ferner gibt es eine Art von Erineum,
jenes nämlich, welches S c h l e c h t e n d a l im ersten
Bande der Linnea als Erineum ribium beschreibt, dass ich
auch schon früher häufig in den Umgegenden Wiens gefunden
habe, aber als von Blattläusen herrührend, für eine Art von
Excrescenz hielt. Hier, so wie in einer ähnlichen Missbildung
an den Blättern von Amygdalus persica, welche bisher noch
nicht beschrieben wurde, geht der Bildung von Erineum eine
auffallende blasige Auftreibung der Blattfläche nach aufwärts,
die sich nicht selten durch eine gelbrothe Farb-e auszeichnet,
voraus. An den Pfirsichblättern lässt sich selbst später an der
Unterseite kaum etwas wolliges erkennen, obgleich ich nicht
anstehe, diese Missbildung auch hierher zu zählen. Hier leidet
' offenbar die Oberhaut selbst mit dem unterliegenden Parenchym
(Mesophyll.).
Es wird demnach entsprechender seyn, die Erineumbildung
nicht nur auf die krankhafte Metamorphose der Haarbedeckungen
zu beschranken, sondern auch die Oberhaut und