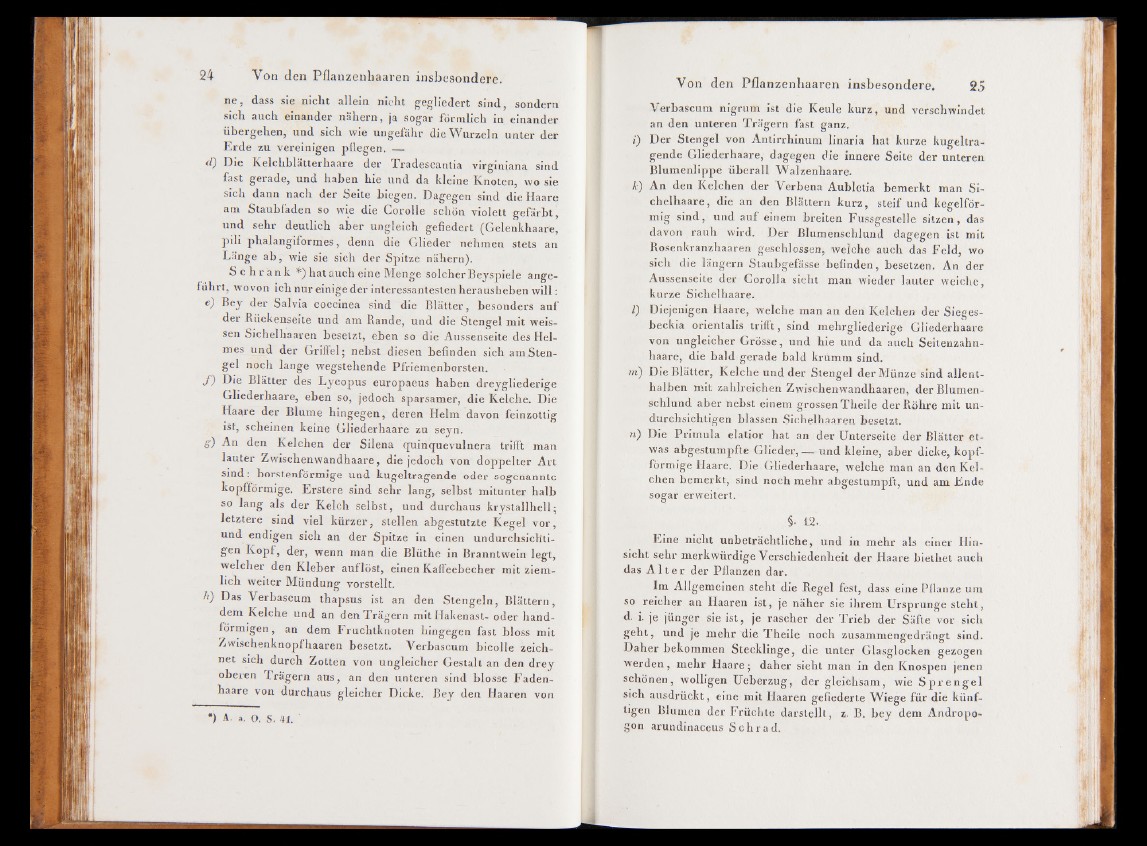
ne, dass sie nicht allein nicht gegliedert sind, sondern
sich auch einander nähern, ja sogar förmlich in einander
übergehen, und sich wie ungefähr die Wurzeln unter der
Erde zu vereinigen pflegen. —
d) Die Kelchblätterhaare der Tradescantia virginiana sind
fast gerade, und haben hie und da kleine Knoten, wo sie
sich dann nach der Seite biegen. Dagegen sind die Haare
am Staubfaden so wie die Corolle schön violett gefärbt,
und sehr deutlich aber ungleich gefiedert (Gelenkhaare,
pili phalangiformes, denn die Glieder nehmen stets an
Länge ab, wie sie sich der Spitze nähern).
S c h r a n k *) hat auch eine Menge solcher Beyspiele angeführt,
wovon ich nur einige der interessantesten herausheben w ill:
e) Bey der Salvia coccinea sind die Blätter, besonders auf
der Kückenseite und am Rande, und die Stengel mit weis-
sen Sichelhaaren besetzt, eben so die Aussenseite des Helmes
und der Griffel; nebst diesen befinden sich am Stengel
noch lange wegstehende Pfriemenborsten.
ƒ) Die Blätter des Lycopus europaeus haben dreygliederige
Gliederhaare, eben so, jedoch sparsamer, die Kelche. Die
Haare der Blume hingegen, deren Helm davon feinzottig
ist, scheinen keine Gliederhaare zu seyn.
S) An den Kelchen der Silena quinquevulnera trifft man
lauter Zwischenwandhaare, die jedoch von doppelter Art
sind: borstenförmige und kugeltragende oder sogenannte
kopfförmige. Erstere sind sehr lang, selbst mitunter halb
so lang als der Kelch selbst, und durchaus krystallhell;
letztere sind viel kürzer, stellen abgestutzte Kegel vor,
und endigen sich an der Spitze in einen undurchsichtigen
Kopf, der, wenn man die Blüthe in Branntwein legt,
welcher den Kleber auflöst, einen Kaffeebecher mit ziemlich
weiter Mündung vorstellt.
h) Das Verbascum thapsus ist an den Stengeln, Blättern,
dem Kelche und an den Trägern mit Hakenast- oder handförmigen,
an dem Fruchtknoten hingegen fast bloss mit
Zwischenknopfhaaren besetzt. Verbascum bicolle zeichnet
sich durch Zotten von ungleicher Gestalt an den drey
oberen Trägern aus, an den unteren sind blosse Fadenhaare
von durchaus gleicher Dicke. Bey den Haaren von
') A. a. O. S. Ul.
Verbascum nigrum ist die Keule kurz, und verschwindet
an den unteren Trägern fast ganz.
i) Der Stengel von Antirrhinum linaria hat kurze kugeltragende
Gliederhaare, dagegen die innere Seite der unteren
Blumenlippe überall Walzenhaare.
k) An den Kelchen der Verbena Aubletia bemerkt man Sichelhaare,
die an den Blattern kurz, steif und kegelförmig
sind, und auf einem breiten Fussgestelle sitzen, das
davon rauh wird. Der Blumenschlund dagegen ist mit
Rosenkranzhaaren geschlossen, welche auch das Feld, wo
sich die langem Staubgefässe befinden, besetzen. An der
Aussenseite der Corolla sieht man wieder lauter weiche,
kurze Sichelhaare.
l) Diejenigen Haare, welche man an den Kelchen der Sieges-
beckia orientalis trifft, sind mehrgliederige Gliederhaare
von ungleicher Grösse, und hie und da auch Seitenzahnhaare,
die bald gerade bald krumm sind.
m) Die Blätter, Kelche und der Stengel der Münze sind allenthalben
mit zahlreichen Zwischenwandhaaren, der Blumenschlund
aber nebst einem grossen Theile der Röhre mit undurchsichtigen
blassen Sichelhaaren besetzt.
n) Die Primula elatior hat an der Unterseite der Blätter etwas
abgestumpfte Glieder, — und kleine, aber dicke, kopfförmige
Haare. Die Gliederhaare, welche man an den Kelchen
bemerkt, sind noch mehr abgestumpft, und am Ende
sogar erweitert.
§• 12.
Eine nicht unbeträchtliche, und in mehr als einer Hinsicht
sehr merkwürdige Verschiedenheit der Haare bielhet auch
das Al t e r der Pflanzen dar.
Im Allgemeinen steht die Regel fest, dass eine Pflanze um
so reicher an Haaren ist, je näher sie ihrem Ursprünge steht,
d. i. je jünger sie ist, je rascher der Trieb der Säfte vor sich
geht, und je mehr die Theile noch zusammengedrängt sind.
Daher bekommen Stecklinge, die unter Glasglocken gezogen
werden, mehr Haare; daher sieht man in den Knospen jenen
schönen, wolligen Ueberzug, der gleichsam, wie Spr enge l
sich ausdrückt, eine mit Haaren gefiederte Wiege für die künftigen
Blumen der Früchte darstellt, z. B. bey dem Andropo-
gon arundinaceus Sehr ad.