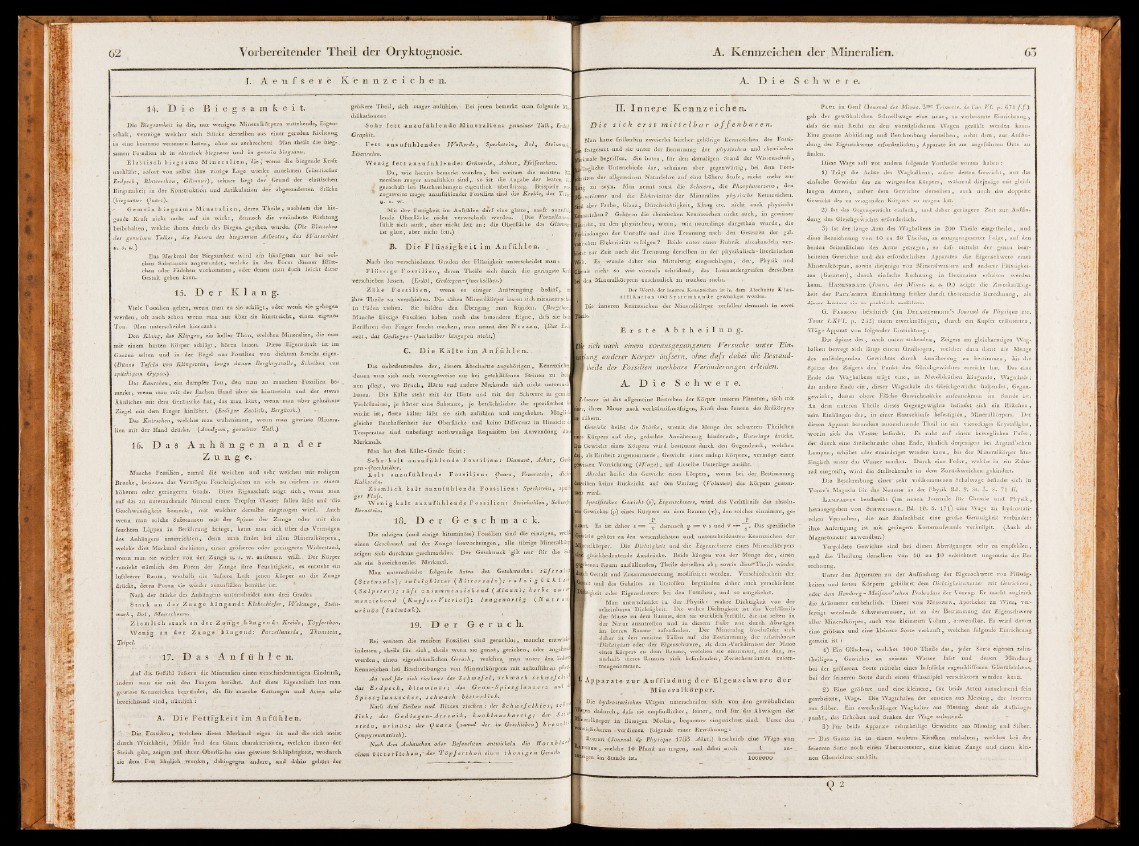
Vorbereitender Theil der Oryktognosie. A. Kennzeichen der Mineralien.
■gröfsere The il, sich, mager -anfühlen. Bei jenen bemerkt mau folgende M0,
’ difikationen
'S e h r f e t t a n z u f ü-lil e n d e M i n e r a 1 i e n : gemeiner Talk, Erda/
■Graphit.
F -e tt a n z u Ri h l e n d e : IValkerde , Speckstein » . B o l, Steinmark,
Eisenrahm.
yV e i l i g f e t t a n z u f i i li l en d e: Grünerde, A sbest, Pfeifenthon.
¡Da, wie bereits bemerkt worden, bei weitem die meisten Mi
neralien mager anzufühlen sind ,i so ist die Angabe der lezten Ei
;euscliaft bei Beschreibungen eigentlich Uberflü;überflüssig.
Beispiele vor
igswei
mger anzufiibleuder Fossilien sind < Trip
Mit der Fettigkeit im AiifÜhlen darf eine glatte, sanft an fii«
lende Oberfläche nicht verwechselt werden. (Die Porzellanen
fühlt sich sanft, aber nicht fett an; die Oberfläche des
ist glatt, aber nicht fett.} •
B. D i e F l ü s s i g k e i t im A n f ü h l e n . .
Nach den verschiedenen ‘Graden der Flüssigkeit unterscheidet nian:
F l ü s s i g e F o s s i l i e n , deren Theile sieh durch die geringste Kn
verschieben lassen. (Erdöl, Gediegen-Ouecksilber.)
■ZSh e" F o s s i l i e n , '• wenn -es einiger- Anstrengüng • bedarf, in
ihre Theile zu verschieben. Die zähen Mineralkörper lassen sich mitunter sclid
in Fäden ziehen. Sie bilden - den Übergang ‘ zum Rigiden. (Bergtheer
Manche flüssige Fossilien haben noch das besondere, E igne, dafs sie beij
Berührenden Finger feucht machen, man nennt dies' N e z z-e n. (Das ErJ
nezt, das Gediegen- Quecksilber hingegen nickt!) ...
C. D i e K ä l t e im A n f ü h l e n . .
Das unbedeutendste der, diesem Abschnitte ungehörigen, Kennzeichn
dessen man sich auch vorzugsweise nur bei geschliffenen Steinen zu bed>
neu pflegt, wo Bruch, Härte und andere Merkmale sich nicht untersuck
lassen. Die Kälte steht mit der Härte und mit der Schwere in gerade
Verhältnisse, je härter eine Substanz, je beträchtlicher ihr spezifisches Gl
wicht is t, desto kälter läfst sie sich anfiihleü und umgekehrt. Möglich
gleiche Beschaffenheit der Obeifläche und keine Differenz in Hinsicht d
Temperatur sind unbedingt nothwendige Requisiten bei Anwendung dies
Merkmals.
Man hat drei Kälte - Grade fixirt:
S;ehr ' k a l t a n z u f ü h l e n d e F o s s i l i e n : Diamant, Achat, Gedi
gen - Quecksilber.
K a l t a n z u f ü h l e n d e F o s s i l i e n : Quarz, Feuerstein, dicht
Kalkstein.
Z i e m l i c h k a l t a n z u f ü h l e n d e F o s s i l i e n : Speckstein, spätl
jir - riüfo. 1 ■ .
W e n i g k a l t a ü z u f U h l e n d e F o s s i l i e n : Steinkohlen , Scliwm
' Bernstein. '
18* D e r G e s c h m a c k *
Die salzigen (und einige bituminöse) Fossilien ’sind die einzigen, weit
einen Geschmack auf der Zunge ■' hervorbringen, alle übrige Mineralkörp
zeigen sich durchaus geschmacklos. Der Geschmack gilt nur für die SiH
als ein bezeichnendes Merkmal.
Man unterscheidet folgende Arten des Geschmacks: 1 s ü fs s a l- 'i
( S t e in s t i l z ) ; s ä l ' z i g b i t t e r ( B i t t e r s a l z ) ; s a I z i g k ü h l d
( S a l p e t e r ) ; s ü f s ■ z u s am m e n z i e h e n d ( A l a u n ) ; h e r b e zus>*
m e n z i e h e n d ( K u p f e r - V i t r i o l ) i l a u g e n a r t i g ( N a t r o «1
u r in ö s ( S a lm i a k ) .
19. D e r G e r u. c h.
Bei weitem die meisten Fossilien sind geruchlos, manche entwich*
indessen, theils für..sich, theils wenn sie gerizt, gerieben, oder angeliau“
werden, einen eigenthiimlichen Geruch, welchen man unter den üiifset*
Kennzeichen bei Beschreibungen von Mineralkörpcrn mit aufzufUhrou pHes-
• An und fü r sich riechen: der S c h w e f e l , s c liw a ch s c h w e f e l t^
•das E r d p ec!) r b i t u m i n ö s ; das G r a u - S p i e s g l a n z e r z und
S p i e s g l a n z o c k e r , sch w -a ch b i t t e r l i c h .
Nach dem Reiben und Rizzen riechen: der S ch w e f e I k i e sch'1
■lieh-; das G v d ie g e n- Ar.s e n i k , k-u-o b l an cli a r t i g ; der ;. St'111
s te i n , u r i n ä s ; der Q u a r z (zumal der in Geschieben) b r e n z ‘l<
(empyreurhatisch) .
Nach dem Anhauchen oder Befeuchten entwickeln die Ho m b Ion
■finen b i t t e r l i c h e n der T ö p f e r th o h einen th o n i g e n Geruch•
II. I n n e r e Keij.nzoi.chen*
D i e s i c h e r s t m i t t e l b a r o f f e n b a r e n .
Man hatte früherhin zweierlei hierher .gehörige Kennzeichen der Fossi-
festgesezt und sie unter der Benennung der physischen, und chemischen
'kmalc begriffen. Sie boten , für den damaligen Stand 1 der Wissenscliaft,
längliche Unterschiede dar, scheinen aber gegenwärtig, bei dem Fortgehen
der allgemeinen Naturlehre auf eine höhere Stufe, nicht mehr zu-
2 zu seyn. Man nenut sonst die Schwere, die Phosphoreszenz, den
vnetismus und die Elektrizität der Mineralien physische Kennzeichen.
1 aber Farbe, Glanz, Durchsichtigkeit, Klang etc. nicht auch physische
Knzeiclien ? Gehören die chemischen Kennzeichen nicht auch, in gewisser
:ht, zu den physischen-, wenn, wie,, neuerdings dargethan wurde,, die
nduugen der UrstQffe und ihre Trennung nach- deif Gesezzen der gal-
hen Elektrizität erfolgen?- Beide unter einer Rubrik abzubandeln ver-,
zur Zeit noch die Trennung derselben -in der physikalisch - literarischen
l]¡. Es wurde daher ein Mittelweg eingeschlagen, der, Physik und
mie nicht so wie vormals scheidend, das Ineinan der greifen derselben
den Mineralkörpern anschaulich zu machen sucht. ¿
Der Werth der inneren Kennzeichen ist in dem Abschnitte K l a s s
i f i k a t i o n und S y s t e m k i i n ä e gewlirdiget worden.
I Die inneren Kennzeichen der Mineralkörper zerfallen1 demnach in zwei
E r s t e A b t h e i l u n g .
Die sich nach einem voraus gegangenen Versuche unter Ein-
H/.iing anderer Körper äufsern, ohne d a fs dabei die Bestand-
theile der Fossilien merkbare Veränderungen erleiden.
A. D i e S c h w e r e .
iwere ist das allgemeine Bestreben der Körper unseres Planeten , sich mit
ihrer Masse nach verhältnifsmäfsigen, Kraft dem Innern des Erdkörpers
I Gewicht heilst die Stärke, womit die Menge der schweren Theilclien
jiitts Körpers auf d ie , gedachte Annäherung hindernde, Unterlage drückt.
Gewicht .eines Körpers wird bestimmt durch den Gegendruck, welchen
du, als Einheit angenommene , Gewicht eines ändern Körpers, vermöge einer
göjrissen Vorrichtung (W a g e ) , auf dieselbe Unterlage ausübt.
Absolut heilst das Gewicht eines Körpers, wenn bei der, Bestimmung
«selben keine Rücksicht auf den .Umfang (Volumen) des Körpers genomft
wird.
■ Spezifisches Gewicht- (s), Eigenschwere, wird das Verhältnifs des absolu-
'teri; Gewichts (p) eines Körpers zu dem Raume ( v ) , den solcher einuimmr, ge- 1
_p H B j ? B I ■ ’ 1 1
nt. Es ist daher s = _ demnach p ’== v. s und v =*= . Das speziflsche
¡Geyvielit gehört zu den wesentliclisten und. unterscheidensten Kennzeichen der
ralkörper. Die Dichtigkeit und ’die Eigenschwere eines Mineralkörpers
!swp gleichbedeutende Ausdrücke. Beide hängen, von der Menge der, einen
[gegebenen. Raum ausfüllenden, Theile desselben ab; sowie diese“Thcile wieder
Üycli Gestalt und Zusammensezziuig modiiiziret werden. Verschiedenheit der
jud des Gehaltes an Urstoffen begründen daher auch verschiedene
eit oder Eigenschwere bei den Fossilien, und so umgekehrt.
Man unterscheidet in der Physik: wahre Dichtigkeit von der
scheinbaren Dichtigkeit. Die wahre Dichtigkeit ist das Verhältnifs
der Masse zu dem Raume, den sie wirklich ^erfüllt. Sie /ist selben in
der Natur anzutreffen und in diesem Falle nur durch Abwägen
im leeren Raume' aufzufinden. Der Mineralog ,beschränkt sich
dahef in den meisten Fällen auf die Bestimmung der scheinbaren
Dichtigkeit oder der Eigenschwere, als dem-Verhältnisse der Masse
■ eines Körpers zu dem' Raume, welchen sie einuimmt, mit den, innerhalb
dieses Raumes sich befindenden, Zwischenräumen zusam-
• mengeiiommen.
!• A p p a r a t e z u r A u f f in d u n g d e r E i g e n s c h \v e r e d e r
M i n e v a 1 k ö r p e r.
■ Die hydrostatischen Wagen1 urttcrscheiden. sich von den gewöhnlichen
t ;en dadurch, dafs sie empfindlicher, f e in e r u n d Tür. das Abwiegen der
«ralkörper in flüssigen Mcdiis, bequemer eingerichtet sind. Unter den
^fciiglioheren » verdienen folgende ei>ier Erwähnung:
Rozier (Journal dp Physique 1708 Adut.) beschrieb eine Wage von
, welche 10 Pfund zu tragen, und dabei nocli 1 a n -_
■ eiS«n im'Stande ist. , . 1000000
de l-au VI. r . 67 i f f . )
verbesserte Einrichtung ,
gezählt werden kann.
P a u l in Genf (Journal des Mines. ’S™6 Tri,na:
gab der gewöhnlichen Schuellwage eine neue, :
dafs sie mit Recht zu den vorzüglicheren Wag
Eine genaue Abbildung uud Beschreibung derselbe,
düng der Eigenschwere erforderlichen, Apparate it
finden.
Diese Wage soll vor ändern folgende Vorlheile voraus haben :
1) Tragt die Achse des Wagbalkcns, aufser dessen Gewicht, nur das
einfache Gewicht des zu wiegenden Körpers, während diejenige mit gleich
langen Armen, . aufser dem Gewichte derselben, auch noch das doppelte
Gewicht des zu wiegenden Körpers zu tragen hat.
2) Ist das Gegengewicht einfach, und daher geringere Zeit zur Auffindung
des Gleichgewichts erforderlich.
3) Ist der .lange Arm des Wagbalkens in 200 Theile eingctheilet I
igescztcr Folg
littclst der genau
die Eigenschwere
und anderer Flüss.
nalen erhalten w
-eigte die Zweckm
etische Berechnung
auf den
h bear-
:e eines
mal de Physiqu,
:in Kupfer erläut«
diese Bezeichnung von 10 zu 10 Theilen, in entge
beiden Seitenflächen 'des Arms getragen, -so dafs
beiteten Gewichte und des erforderlichen Apparate
Mineralkörpers, sowie diejenige von Mineralwassern u
ten (Gasarten), durch einfache Rechnung in Dezim
kann. H.assekvb.axz (Journ, des Mines. a. a. O.) ze
keit der P a u l’schen Einrichtung früher durch theore
dieser Leztere sie so praktisch ausführte.
G. Fabroni beschrieb (in D e lam e th e r ie ’s Joi
am gleicharmigen Wag-
dazu dient die Menge
su bestimmen, bis die
erreicht hat. Das eine
Tome L X V I. ,p . 2 3 2 ) einen zweckmäfsigen, durch
-Wäg-Apparat von folgender Einrichtung:
Die Spizze des, nach unten stehenden, Zeigers .1
kalken bewegt sich längs einem Gradbogen, weichet
des auf5h liegenden Gewichtes durch Annälierihig
Spizze des Zeigers den Punkt des Gleichgewichtes
Ende des Wagbalkens trägt eine, in Metalldrätlien hängende, Wagschaie;
das andere Ende ein, dieser Wagschaie das Gleichgewicht haltendes, • Gegengewicht,
dessen obere Flüche Gewichtstücke aufzunehmen im Stande ist.
An dem unteren Theile dieses Gegengewichts befindet sich ein Häkchen,
zum Einhängen■ des, in einer Haarschleife befestigten, Mineralkörpers. Der
diesen Apparat, besonders auszeichnende Theil ist ein viereckiges Krystallglas,
worin sich das Wasser befindet. Es rulit auf einem beweglichen Fufse,
der durch eine Stellschraube ohne Ende, ähnlich derjenigen bei Argand’schen
Lampen, erhöhet oder erniedriget werden kann, bis der Mineralkörper hinlänglich
unter das Wasser tauchet. . Durch eine Feder, welche in ein Zahnrad
.eingreift, wird die Stellschraube in dem Zuriickweichen gehindert.
Die Beschreibung einer ' sehr vollkommenen Schalwage befindet sich in
V oiot’s Magazin f ü r das Neueste in der Physik Bd., 9. St. 3 . S. 71 ff.
L amfadius beschreibt (im neuen Journale für Chemie und Physik,
lierausgegeben von Schweioger. Bd. lö - S. 171) eine Wage zu hydrostatischen
Versuchen, die mit' Einfachheit eine gi-ofse Genauigkeit verbindet;
ihre Anfertigung ist mit geringem Koetenaufyvaude verknüpft. (Auch als
Magnetometer anwendbar.)
Vergoldete Gewichte sind bei diesen Abwägungen sehr zu empfehlen,
und die Tlieiluug derselben von 10. zu 10 erleichtert allgemein die Berechnung.
i der Auffindung der Eigenschwere von Flüssiggebühret
dem Dichtigkeitsmesser mit Gewichten,
r sehen Probeglase der Vorzug. Er macht zugleich
Dieser von Meissker, Apotheker zu Wien, ver-
imung der Eigenschwere
tvendbar. Es wird davon
Unter den Apparaten z
keiteu und festen Körpern
oder dem Hoinberg - Meifsn
die Aräometer entbehrlich. •
fertigt werdende Schweremesser, ist zu der Bei
aller Mineralkörper, auch von kleinstem Volum ,
gröfsere und < i kleinere Sorte verkauft, welchen folgende Einrichtung
gemein ist :
1) Ein GläschenJ welches 1000 Tlieile des, jeder Sorte eigenen zehri-
theilio-en , Gewichts an reinem Wasser fafst und dessen Mündung
bei der gröfseren Sorte mittelst eines luftdicht zugeschliffenen Glastäfelchöns,
bei der feineren Sorte durch einen Glasstöpfel verschlossen werden kann.
2) Eine gröfsere und eine kleinere, fiii beide Arteil ausnehmend fein
gearbeitete, Wage.' Die Wagschalen der ersteren aus Messing, der lezteren
aus Silber. Ein zweckmäfsiger Waghalter aus Messing dient als Aufhänger
. punkt, das Erhöhen uud Senken der Wage zulassend.
3 ) Für beide Apparate zehntheilige Gewichte aus Messing und Silber.
.— Das' Ganze ist in einem säubern- Küstolien enthalten, welches bei der
feineren Sorte noch einen Thermometer, eine kleine Zange und einen kleinen
Glastrichter enthält.
14. D i e B i e g s a m k e i t .
Die Biegsamkeit isf die, nur wenigen Mineralkörpcrn zustehende» Eigenschaft,
vermöge welcher sich Stücke derselben aus einer geraden Riclitjing
in eine krumme versezzen lassen, ohne zu zerbrecheur Man theilt die bieg-.
samen Fossilien ab in elastisch biegsame und- in gemein biegsame.
E l ak t i s c h b i e g s a m e M in e r a 1 ie n , die wenn die biegende Kraft
nachläfst, sofort von selbst ihre vorige Lage wieder aunehmen (elastisches
Erdpech, Blätterthon, Glimmer), seltner liegt der Grund der elastischen
Biegsainkeit in der Konstruktion und Artikulation der abgesonderten Stücke
(biegsamer Ouarz) . .
G em e in b i e g s a m e M in o r a l i e n » deren The ile, nachdem die biegende
Kraft nicht mehr auf sie w irk t, dennoch die veränderte Richtung:
beibehalten, welche ihnen durch das Biegen gegeben wurde. (Die Blättchen
des gemeinen Talkes, die Fasern des biegsamen Asbestes, das PVasserblei f
u . s . yi.) ■
Das Merkmal der Biegsamkeit wird am häufigsten nur bei solchen
Substanzen angewendet, welche in der Form dünner Blättchen
oder Fädchen Vorkommen, oder denen man doch leicht diese
Gestalt geben kann.
15. D e r K l a n g . ,
Viele. Fossilien geben, wenn man an sie schlägt, oder wenn sie gebogen
werden, oft auch schon wenn man nur Uber sie liiustreicht, -einen eigenen
Ton. Man unterscheidet hiernach:
Den Klang, das Klipgen, ein heller Thon, welchen Mineralien, die man
mit einem harten Körper schlägt, hören lassen. Diese Eigenschaft ist im
Ganzen selten und in-de r Regel nur Fossilien von dichtem Bruche^eigen.
(Dünne Tafeln von Klingstein, lange dünne Bergkrystalle, Scheiben von.
; späthigem Gypse.)
Das Rauschen, ein dumpfer T on , den man an manchen Fossilien be- ,
merkt, wenn, man mit der flachen Hand über sie hinstreieht und der etwas
Ähnliches mit dem Geräusche hat, das man hört, wenn'man über gebrannte
Ziegel mit dem Finger hinfährt. (Erdiger Z eo lith, Bergkork.)
Das Knirschen, welches man wahrnimmt, wenn man. gewisse Mineralien
mit der Hand drückt. (Amalgam, gemeiner Talk.)
16. D a s A n h ä n g e n a n d e r
Z u n g e . -
Manche Fossilien, zumal die weichen und sehr weichen mit erdigem
Bruche, besizzen das Vermögen Feuchtigkeiten an sich zu ¿ziehen in einem
höheren -oder' geringeren Grade. Diese Eigenschaft zeigt sich , wenn man
auf das zu untersuchende Mineral einen Tropfen Wasser fallen läfst und die
Geschwindigkeit bemerkt, mit welcher derselbe eingesogen wird. Auch
wenn man solche Substanzen mit- der Spizze der Zunge oder mit den
feuchten Lippen in Berührung' bringt, kann mau sich über das Vermögen
des Auhängens unterrichten, denn man findet bei allen Mineralkörpern,
welche dies Merkmal darbieten, einen gröfseren oder geringeren Widerstand,
wenn man sie wieder von der Zunge u. s. w . entfernen will-- Der Körper
entzieht -nämlich den Poren der Zunge ihre Feuchtigkeit, es entsteht ein
luftleerer Raum, weshalb die Uufseve Luft jenen Körper an die Zunge
drückt, deren Poren sie wieder auszufüllcii bemüht ist.
Nach der Stärke des Auhängens unterscheidet man drei Grade:
S t a r k a n d e r Z u n g e h ä n g e n d : Klebschiefer, W e lta u g e , Steinmark
, B o l, Meerschaum..
Z i e m l i c h s ta r k an d e r Z .iv f f^ e y ia n g e n d : JCreide, Töpferthon.
W e n i » an d e r Z u n g e . 'h ä n g e n d : Porzellanerde, Thonstein,
Tripel. , .
17. D a s A n f ü h l e n.
Auf das Gefühl äufsern die Mineralien einen verschiedenartigen Eindruck,
indem man sie mit den Fingern berührt. Auf diese Eigenschaft hat man
gewisse Kennzeichen begründet, die für manche Gattungen und Arten -sehr
bezeichnend sind, nämlich :
A. D i e F e t t i g k e i t im A h f ü h l e n .
V '' D ie Fossilien, welchen dieses Merkmal eigen ist und die-sich-meist
durch Weichheit, Milde und den Glanz charakterisiren, welchen ihnen der
Strich gibt, zeigen auf ihrer Oberfläche eine gewisse Schlüpfrigkeit, wodurch
sie dem Fett ähnlich werden,' ,dahingegen andere, und dahin gehört der