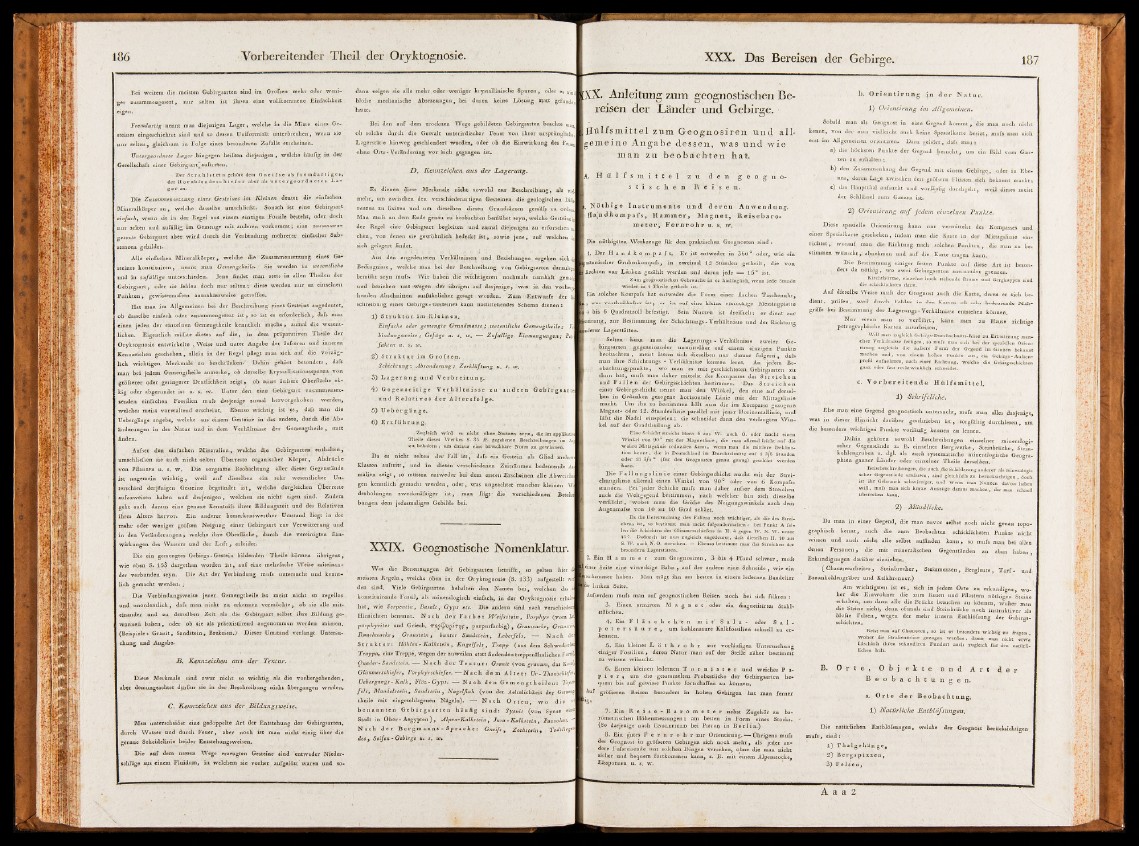
Bei weitem die meisten Gebirgsarten sind im GroTsen' melir oder weniger
zusammengesezt, nur selten ist ihren eine vollkommene Einfachheit
Fremdartig nennt man diejenigen Lager, welche in die Mitte eines Gesteines
eingeschichtet sind und so dessen Uniformität unterbrechen, wenn sie
nur selten, gleichsam in Folge eines besonderen Zufalls erscheinen.
Untergeordnete Lager .hingegen heifsen diejenigen , welche häufig in der
Gesellschaft einer Gebirgsart^auftreteu.
Der S t r a h 1 s t e-i n gehört dem G n e i f j s als f r e m d ' a r t i g e s ,
der H o r nb l e n d e s c h i e . f e r aber als u n t e r g e o r d n e t e ! L a g
e r an.
Die Zusammcflsezzung eines, Gesteines im Kleinen deutet die einfachen
Miueralkörper a n , welche dasselbe umschliefst. Sonach ist .eine Gebirgsart
einfach, wenn sie in der Regel aus einem einzigen Fossile, besteht, oder doch
nur selten und zufällig im Gemenge mit anderen vorkommt; eine zusammen-
<reseate Gebirgsavt aber wird durch die Verbindung mehrere* einfacher Substanzen
gebildet.
Alle einfachen Mineralkörper, welche die Zusammensetzung eines Gesteines
konstituiren, nennt man Gemengtlieile• Sie werden in wesentliche
und in zufällige unterschieden. Jene findet man stets in allen Theilen der
Gebirgsart, oder sie fehlen doch nur selten; diese werden nur. an einzelnen
Punkten, gewissermafsen ausnahmsweise getroffen.
I-Iat man im Allgemeinen bei der Beschreibung’ eines Gesteins angedeutet,
ob dasselbe einfach oder zusammengesezt i s t , so ist es erforderlich, däfs man
einen jeden der einzelnen Gemengtheile kenntlich mache, zumal die wesentlichen.
Eigentlich miifste dieses auf die, ,in dem präparativen Theile der
Oryktognosie entwickelte , Weise und unter Angabe der äufsereu und inneren
Kennzeichen geschehen, allein in der Regel pflegt man sich auf die vorzüglich
wichtigen Merkmale zu beschränken.' Dahin gehört besonders, dafs
man bei jedem Gemengtheile anmerke, ob derselbe Krystallisationsspureiv von
gröfserer oder geringerer Deutlichkeit zeigt, ob seine äufsere .Oberfläche ek-
kig oder abgerundet ist u. s. w . Unter .den eine Gebirgsart zusammensez-
xenden einfachen Fossilien mufs dasjenige zumal hervorgehoben werden,
welches meist vorwaltend erscheint. Ebenso wichtig ist 'es, dafs man die
Uebergänge angebe, welche aus einem Gesteine in das andere, durch die Ab-
1 änderungen in der Natur und in dem Verhältnisse der Gemengtheile , statt
finden.
Aufser den einfachen Mineralien.,, welche die Gebirgsarten enthalten,
umschliefsen sie auch nicht'selten Überreste organischer Körper, Abdrücke
von Pflanzen u. s. w . Die sorgsame Beobachtung aller dieser Gegenstände
ist ungemein w ich tig , weil auf dieselben ein sehr wesentlicher Unterschied
derjffnigen Gesteine begründet is t, welche dergleichen Überresto
aufzuweisen haben und derjenigen , welchen sie nicht eigen sind. Zudem
geht auch daraus eine genaue Kenntnifs ihrer Bildungszeit und des Relativen
ihres Alters hervor. Ein anderer bemerkenswerther Umstand liegt in der
mehr oder weniger grofsen Neigung einer Gebirgsart zur Verwitterung und
in den Veränderungen, welche ihre Oberfläche, durch die vereinigten Einwirkungen
des Wassers und der L u ft, erleidet.
Die ein gemengtes Gebirgs - Gestein bildenden Theile können übrigens,
wie oben S. 153 dargetlian worden is t, auf eine mehrfache Weise miteinander
verbunden seyn. Die Art der Verbindung mufs untersucht und kenntlich
gemacht werden, j
Dia Verbindungsweise jener Gemengtheile ist meist nicht so regellos
und unordentlich, dafs man nicht zu erkennen vermöchte, ob sie alle miteinander
und zu derselben Zeit als die Gebirgsart selbst ihre Bildung g e -.
wonneu haben, oder ob sie als präexistirend angenommen werden müssen.
(Beispiele: Granit, Sandstein, Brekzien.) Dieser Umstand verlangt Untersuchung
und Angabe.
JB. Kennzeichen aus der Textur.
Diese Merkmale sind zwar nicht so wichtig als die vorhergehenden,
aber demungeachtet dürfen- sie in der Beschreibung nicht übergangen werden.
C. Kennzeichen aus der Bildungsweise.
Man unterscheidet eine gedoppelte Art der Entstehung der Gebirgsarten,
durch Wasser und durch Feuer, aber noch ist man nicht einig Uber die
genaue Scheidelinie beider Entstehungsweisen.
Die auf dem nassen Wege erzeugten Gesteine sind entweder Niederschläge
aus einem Fluidum, in welchem sie vorher aufgelöst waren und sodann
zeigen sie alle mehr. oder -weniger krystallinische Spuren, oder es sind
blöfse mechanische Absezzungen, bei denen keine Lösung statt gefunden
hatte.
Bei den auf dem trocknen Wege gebildeten Gebirgsarten beachte nian
ob solche durch die Gewalt unterirdischer Feuer von ihrer ursprüngliche,,
Lagerstätte hinweg geschleudert worflen, oder ob die Einwirkung des Feueri
ohne Orts - Veränderung vor "sich gegangen ist.
D . Kemizeichen. aus der Lagerung.
Es dienen <jiese Merkmale nicht sowohl zur Beschreibung, als viel-
mehr, um zwischen den verschiedenartigen Gesteinen die geologischen Uiff,
renzen zu fixiren und um dieselben diesen Grundsäzzen gemäfs zu ordnen
Man mufs zu dem Ende genau zu beobachten bemühet seyn, welche Gesteinei,
der Regel ciile Gebirgsart begleiten und zumal diejenigen zu erforschen sj,
dien, von denen sie gewöhnlich bedeckt is t , .sowie jene, auf welchen j,
sich gelagert flndet.
Aus den an gedeuteten Verhältnissen und Beziehungen ergeben sich
Bediugnisse, welche man bei der Beschreibung von Gebirgsarten darzulc^
bemüht seyn mufs. Wir haben ,die wichtigeren nochmals namliaft genial
und beziehen uns .-Wegen.¿deir übrigen auf dasjenige, was> in den vorher^
henden Abschnitten ausführlicher gesagt Worden. Zum Entwürfe der &
Schreibung eines Gebirgs - Gesteines kann nachstehendes Schema dienen:
1) S t r u k tu r , im k l e i n e n .
Einfache oder gemengte Grundmasse,;,wesentliche Gemengtheile; Vi
bindungsweise; Gefüge u. s. w. — Zufälliges Einmengungen; Peti
■Jas:., u. s. u,. .
2 ) S t r u k t u r i,m G r o f s e^i.
Schichtung; Absonderung Zerklüftung u. s. w. .
. 7. 3 ) L a g e r u n g u.pd V e r b r e i t u n g .
4 ) G e g e n s e i t i g e V e r h ä l tn is s 'e z u - ä n d e r n G e b i r g s arm
.u n d R e l a t i v e s d e r A l t e r s f o l g e .
5 ) U e b e r g ä n g e .
6) E r z f ü h r u n g ,
; Zugleich w ir d es nich t ohne -Nuzzen s e y n , die im applikativt
Theile dieses Werkes S. 85 f f. gegebenen Beschreibungen im Au!
z u behalten , um daraus eine brauchbare Norm zu g ewinnen.
Da es nicht selten der Fall is t, däfs ein Gestein als Glied mehren
Klassen auftritt, und in diesen verschiedenen Zeiträumen bedeutende .Am
mälien zeigt, so müssen entweder bei dem ersten Erscheinen alle Abweiclim
gen kenntlich gemacht werden, oder, was ungeachtet mancher kleinen \V»
derholungen zweckmäfsiger is t, man fügt- die verschiedenen Besclut
bangen dem jedesmaligen Gebilde bei.
XXIX. Geognostische Nomenklatur.
Was die Benennungen der Gebirgsarten b e t r i f f t so gelten hier i
meisten Regeln, welche oben in der Oryktognosie (S. 133) aufgestellc \vor
den sind. Viele Gebirgsarten behalten den Namen bei, welchen das ¡i
konstituirende Fossil, als mineralogisch einfach, in der Oryktognosie erhall*
hat, wie Serpentin, Basalt, Gyps etc. Die ändern sind nach verschieden*
Hinsichten benannt. N a c h d e r F a r b e : W e ifsstein , Porphyr (vom L«
porphyrites und Griech. nroffivq 'i'rfö, purpurfarbig) , Grauwacke, Grünsten
JRauchwacke, Grauste.in, bunter Sandstein, Leberfels. — N a c h dt
S t r u k t u r : Höhlen - Kalkstein, Kugelfels , Trapp (aus dem Schwedisch*1
Trappa, eine Treppe, wegen der zuweilen statt findenden treppenähnlichen Form)
Quader - Sandstein. — Nach d e r T e x t u r : Granit (von granum, das Korn)
Glimmerschiefer, Porphyrschiefer. — N a c h d om A l t e r : Ur- Thon's chief*r\
Uebergangs - K a lk , Flöz - Gyps. — N a c h d en G em e n g t h e i l e n : Top“1
f e ls , Mandelstein, Sandstein , Nagelfluh (von der Aehnlichkeit der Genie«?'
theile mit eingeschlagenen Nägeln). — N a c h O r t e n w o die
b e n a n n t e n G e b i r g s a r t e n h ä u f ig s in d : Sypnit (von Syene ein«
Stadt in Ober-Aegypten ) , Alpen-Kalkstein i Jura - Kalkstein , Puzzolan. "
N a c h d e r B e r g m a n n s - S p r a c h e : Gneifs , Zechstein, < Todtli*See'
des , Seifen - Gebirge u. s. w.
XX. Anleitung zum geognostischen Bereisen
der Länder und Gebirge.
Hül f smi t t e l zum Geoguos i re n und al l gemein
e Angabe, dessen, was und wie.
inan zu be o b a c h t e n hat.
\ . H ü 1 r s m i t t e 1 z ti d e n ' g e o g n .o -
s ' t i s c h e n R e i s e n .
N ö t h i g e I n s t r u m e n t e u n d d e r e n A n w e n d u n g .
H a ,n d k o m p a f s , H a m m e r , M a g n e t , R e i s e k a r o -
m e t e r ; F e r n r o h r u. s. vV.
Die nötliigsten Werkzeuge für den praktischen Geognosten sind :
1. Der H a n d k o m p a f s . Er ist entweder in 3 6 0 ° oder, wie ein
.männisclier Grubenkompafs, in zweimal 1.2 Stünden getheilt, die von
[Rechten zur Linken gezählt werden und deren jede = . 1 5 ° ist.
Zum gfcögnostisc'heh Gebrauche ist es hinlänglich, wenn jede Stunde
wiede r in. 4 Theile getheilt ist.
Ein solcher Kompafs hat entweder die Form einer flachen Taschenuhr;
, was-vprtheilhafter is t, er ist auf eine kleine viereckige Messingplatte
4 bis 6 Quadratzoll befestigt. Sein Nuzzen ist dreifach : er dient zur
mtirung, zur Bestimmung der Schichtungs-Verhältnisse und der Richtung
inderer Lagerstätten.
Selten- kann man die Lagerungs - Verhältnisse zweier Ge-
birgsarten gegeneinander unmittelbar auf einem einzigen Punkto
beobachten , meist lassen sich dieselben nur daraus folgern , dafs
man ihre Schichtungs - Verhältnisse kennen lernt. An jedem Be-
' obachtuugspunkte * wo man es mit geschichteten.: Gebirgsarten zu
tliun hat, mufs man daher mittelst des Kompasses das S t r e i c h e n
und F a l l e n der Gehirgsscliichteii bestimmen. Das S t r e i c h e n
einer Gebirgsschiclit nennt man den Winkel, 'den eine auf derselben
in Gedanken gezogene horizontale Linie mit der Mittagslinie
macht. Um ihn zu bestimmen hält man die im Kompasse gezogene
Magnet- oder 12. Stunderilinie parallel mit jener Horizontallinie, und
läfst die Nadel einspielen; sie schneidet dann den verlangten Winkel
auf der Gradtheildng ab. -
Eine Schicht streicht Hora 6 aus W . nach Ö. oder macht einen
Win ke l von 9 0 ° mit der Magnetlinie, die man allemal leicht auf die
■wahre Mittagslinie reduziren k a n n , wen n man die mittlere Deklination
k e n n t , die in Deutschland im Durchschnitte auf 1 2j8 Stunden
oder 18 3 /4 ° (für den Geognosten genau genug) gescliäzt werden
kann. - (.
Die F a l l u u g s l i n i e einer Gebirgssckicht macht mit der Streichungslinie
allemal einen Winkel von 9 0 ° oder von 6 Kompafs-
stutiden. Bei'jeder Schicht mufs man daher aufser dem Streichen
auch die Wcltgegend bestimmen, nach welcher hin sich dieselbe
verfläclit, 'wobei man die Gröfse des Neigungswinkels nach dem
Augenmafse von .10 zu 10 Grad schäzt.
Da die Untersuchung des Fallens noch wichtiger, als die des Streichens
is t , so bestimmt man meist folgendermaßen : bei Punkt A fallen
die Schichten des Glimmerschiefers in H. 4 gegen W . N. W. unter
4 5 ° . Dadurch ist nun zugleich angedeutet, dafs dieselben H. 10 aus
S. W. nach N. O. streichen. — Ebenso bestimmt man das Streichen der
besondern Lagerstätten.
2. Ein H a m m e r zum Geognosireu, 3 bis 4 Pfund schwer, mufs
¡einer .Seite eine viereckige Bahn , auf der ändern eine Schneide, wie ein
irerliammer haben. Man trägt ihn am besten in einem ledernen Bandelier
kr linken Seite.
Aufserdem mufs man auf geognostischen Reisen noch bei sich führen :
3. Einen armirten M a g n e t . oder ein Aagnetisirtes Stahl-'
Stäbchen.
4 . Ein F 1 ä s c h c h -e n m i t‘ S a 1 z - oder S a l p
e t e r s ä u r e , um kohlensaure Kalkfossilien schnell zu erkennen.
5. .Ein kleines L ö t h r o li r zur vorläufigen Untersuchung
einiger Fossilien, deren Natur man auf der Stelle näher bestimme
zu wissen wünscht.
6. Einen kleinen ledernen T o r n i s t e r und weiches P a-
p i e r , um die gesammelten Probestücke der Gebirgsarten bequem
bis auf gewisse Punkte fortschaffeii zu können.
Auf gröfseren Reisen besonders in hohen Gebirgen hat man ferner
7. Ein R e i s e - B a r o m e t e r nebst Zugehör zu barometrischen
Höhenmessungen; am besten in Form eines Stocks.
(So dasjenige nach Emolefield bei Pistoq in B e r l in .)
,8. Ein gutes F e r n r o li r zur Orientirung. *— Übrigens mufs mufs ,
der Geognost. in gröfseren Gebirgen sicli noch mehr, als jeder andere
Fufsreisende mit solchen Dingen versehen, ohne die man nicht
sicher und bequem foitkommen kann, z. B. mit einem Alpenstocke,
Eissporuen, u. s. w.
b. O r i e n t i r u n g jn d e r N a tu r .
1) Orientirung im Allgemeinen.
Sobald man als Geognost in eine Gegend kommt, die man noch nicht
kennt, von der man vielleicht auch keine Spezialkarte bcsizt, mufs man sich
erst im Allgemeinen orientiren. Dazu gehört, dafs mau :
a) die höchsten Punkte der Gegend besuchtf um ein Bild vom Gan-
, zen zu erhalten ;
b) den Zusammenhang der Gegend mit einem Gebii-ge, oder in Ebenen,
deren Lage zwischen den gröfsetn Flüssen sich bekannt macht;
c) das Haupttbal aufsucht und vorläufig durchgeht, we il dieses meist
der Schlüssel zum Ganzen ist.
- 2) Orientirung a u f jed em einzelnen Punkte.
Diese spezielle Orientirung kann nur vermittelst des Kompasses und
einer Spczialkarte geschehen, indem man die Karte in der Mitta»siinie ein-
ric'htet, worauf man die. Richtung nach solchen Punkten, die man zu bestimmen
wünscht > abnehmen und auf die Karte tragen kann.
Die Bestimmung einiger festen Punkte auf diese Art ist besonders
da npthig, wo zwei Gebirgsarten aneinander grenzen.
Kirchthürme, einzelne hoch stehende Bäume und Bergkuppen sind
die schicklichsten dazu.
Auf dieselbe Weise mufs der Geognost .auch die Karte, deren er sich bedient
, prüfen, weil durch Fehler in den Karten oft sehr bedeutende Mifs-
griffe bei Bestimmung der Lagerungs-Verhältnisse entstehen können.
Nur wenn man so verfährt, kann man zu Hause richtige
petrographische Karten ausarbeiten.'
W ill man zugleich Gelnrgs-Durehschnitts-Risse zu Erläuterung mancher
Verhältnisse fer tig en, so mufs man sich hei der speziellen Orientirung
zugleich die äufsere F orm der Gegend im Ganzen bekannt
machen u n d , v on einem hohen Punkte au s , ein Gebirgs - Auften-
profil aufnehmen, nach einer Bichtung, welch e die Gelurgsschicluen
ganz oder fast rechtwinkiich schneidet.
c. V o r b e r e i t e n d e H ü l f sm i t t e l .
1) Schriftliche.
Ehe man eine Gegend geognostisch untersucht, mufs man alles dasjenige,
was in dieser Hinsicht darüber geschrieben is t , sorgfältig durchlesen, um
die besonders wichtigen Punkte vorläufig kennen zu lernen.
Dahin gehören sowohl Beschreibungen einzelner mineralogischer
Gegenstände z. B. einzelner Bergwerke, Steinbrüche, Steinkohlengruben
u. dgl. als auch systematische mineralogische Geographien
ganzer Länder oder einzelner Theile derselben.
Reisebeschreibungen, die auch (die Schilderung anderer als mineralogischer
Gegenstände umfassen, sind gleichfalls z u berücksichtigen , doch
ist ih r Gebrauch schwieriger, und w en n man Nuzzen davon haben
w ill, mufs man sich kurze Auszüge daraus machen, die man schnell
übersehen kann.
2) Mündliche.
Da man in einer Gegend, die man zuvor selbst noch nicht genau topographisch
kennt, auch die zum Beobachten schicklichsten Punkte nicht
wissen und aucli nicht alle selbst auffinden kann, so mufs man bei allen
denen Personen, die mit mineralischen Gegenständen zu thun haben
Erkundigungen darüber einziehen.
( ChaUsseearbfeiter, Steinbrecher, Steinmezzen, Bergleute, T o r f- und
Braunkohlengräber und Kalkbrenuer.)
Am wichtigsten ist e s, sich in jedem Orte zu erkundigen, woher
die Einwohner die zum Bauen und Pflastern nötliigen Steine
erhalten, um dann alle die Brüche besuchen zu können, woher man
die Steine zieht, denn oftmals sind Steinbrüche noch instruktiver als
blofte Felsen, wegen der mehr innern Entblöfsung der Gebirgs-
schichten.
Reist man auf Chausseen , so ist es besonders w ichtig zu fragen
w ohe r die Strafsensteine gezogen w e r d e n , damit man nicht e tw a
fälschlich ihren sekundären Fundort auch zugleich fü r den n a tü r lichen
hält.
B. O r t e , O b j e k t e u n d A r t d e r
B e o b a c h t u n g e n .
a. O r t e d e r B e o b a c h tu n g .
1) N atürliche Entblöfsungen.
Die natürlichen Entblöfsungen, welche der Geognost berücksichtigen
1) T h a l g e h ä n g e , '
2) B e r g s p i z z e n ,
3) F e l s e n ,
A a a 2