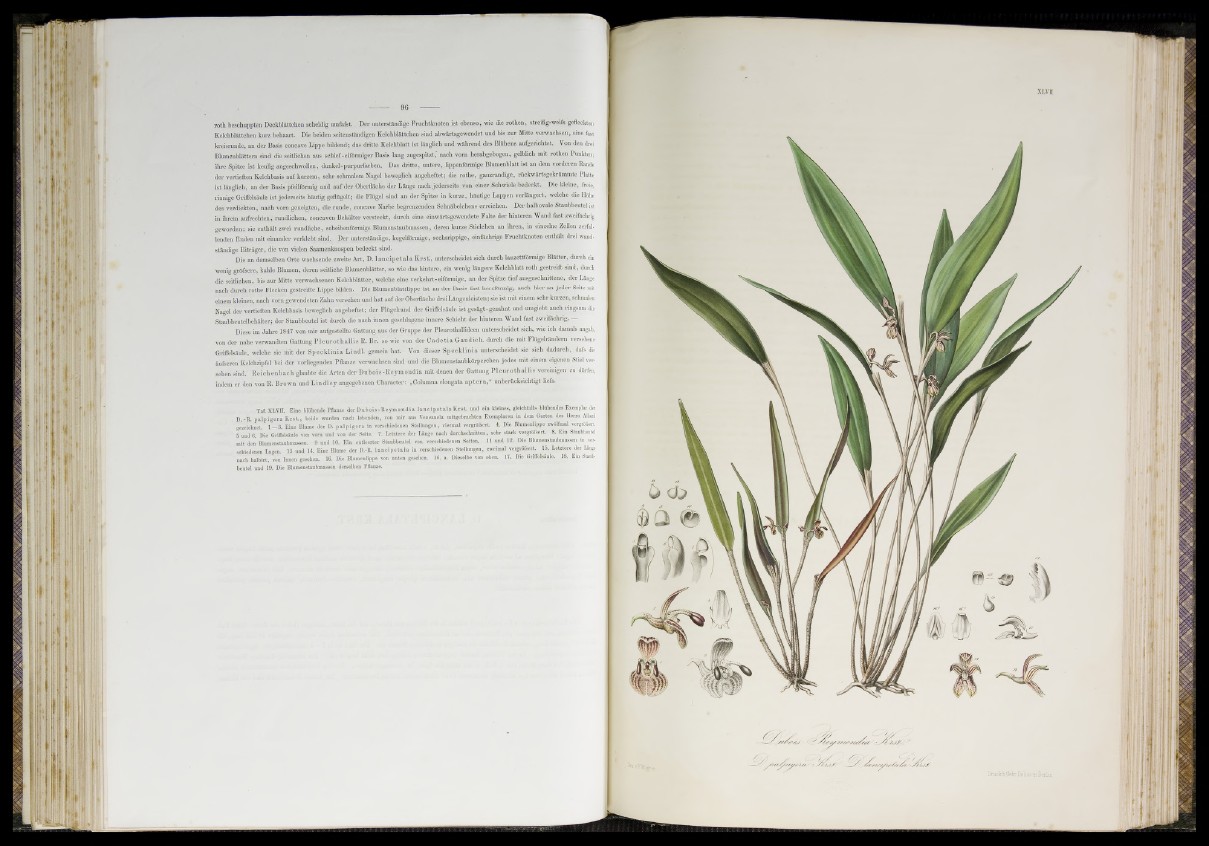
roth beschuppten Deckblättchen scheidig umfafet. Der unterständige Fruchtknoten ist ebenso, wie die rothen, strafig-weifs gefleckten
Kelchblättchen kurz behaart. Die beiden seitenständigen Kelchblättchen sind abwärtsgewendet und bis zur Mitte verwachsen, eine fast
kreisrunde, an der Basis concave Lippe bildend; das dritte Kelchblatt ist länglich und während des Blühens aufgerichtet. Von den drei
Blumenblättern sind die seitlichen aus schief-eiförmiger B asis lang zugespitzt,‘ nach vom herabgebogen, gelblich mit rothen Punkten;
ihre Spitze ist keulig angeschwollen, dunkel-purpurfarben. Das dritte, untere,.lippenförmige Blumenblatt ist an dem vorderen Rande
der vertieften Kelchbasis auf kurzem, sehr schmalem Nagel beweglich angeheftet; die rothe, ganzrandige, rückwärtsgekrömmte Platte
ist länglich, an der Basis pfeilförmig und auf der Oberfläche der Länge nach jederseits von einer Schwiele bedeckt. D ie k leb e , freie,
rinnige Griffelsäule ist jederseits häutig geflügelt; die Flügel sind an der Spitze in kurze, häutige Lappen verlängert, welche die Höhe
des verdickten, nach vom geneigten, die runde, concave Narbe begrenzenden Schnäbelchens erreichen. Der halbovale Staubbeutel ist.
in ihrem aufrechten, rundlichen, concaven Behälter versteckt, durch eine ebwärtsgewendete Falte der hinteren Wand fast zweifächrig
geworden; sie enthält zwei rundliche, scheibenförmige Blumenstaubmassen, deren kurze Stielchen an ihren, in ebzelne Zellen zerfallenden
Enden mit ebander verklebt sb d . Der unterständige, kegelförmige, sechsrippige, einfüchrige Fruchtknoten enthält drei wandständige
Eiträger, die von vielen Saamenknospen bedeckt sb d .
D ie an demselben Orte wachsende zweite Art, D. la n c ip e t a la Kr st!, unterscheidet sich durch lanzettförmige Blätter, durch ein
w en b «röfsere, kahle Blumen, deren seitliche Blumenblätter, so wie das h b te r e , e b wenig längere Kelchblatt roth gestreift sind, durch
die seitlichen, bis zur Mitte verwachsenen Kelchblätter, welche e b e verkehrt-eiförmige, an der Spitze tie f ausgeschnittene, der Länge
nach durch rothe Flecken gestreifte Lippe bilden. Die Blumenblattlippe ist an der Basis fast herzförmig, auch hier an jeder Seite mit,
einem k leben, nach vorn gewendeten Zahn versehen und hat auf der Oberfläche drei Längenleisten; sie ist mit einem sehr kurzen, schmalen
Nagel der vertieften Kelchbasis beweglich angeheftet; der Flügelrand der Griffelsäule ist g esägt-gezahnt und umgiebt auch ringsum die
Staubbeutelbehälter; der Staubbeutel ist durch die nach innen geschlagene b n e r e Schicht der hinteren Wand fast zweifächrig. —
Diese im Jahre 1847 von mir aufgestellte Gattung aus der Gruppe der Pleurothallideen unterscheidet sich, wie ich damals angab,
von der nahe verwandten Gattung P l e u r o t h a l l i s R. Br. so wie von der O a d e t ia G a u d ich . durch die mit Flügelrändern versehene
Griffelsäule, welche sie mit der S p e c k lim a L in d l. g em eb hat. Von dieser S p e c k lin ia unterscheidet sie sich dadurch, dafs die
äufseren Kelchzipfel bei der vorliegenden Pflanze verwachsen s b d und die Blumenstaubkörperchen jedes mit einem eigenen Stiel versehen
sind. R e ic h e n b a c h glaubte die Arten der D u b o is -R e ym o n d ia mit denen der Gattung P l e u r o t h a l l i s vereinigen zu dürfen,
b d em er den von R. B r ow n und L in d le y angegebenen Charaeter: „Columna elongata a p t e r a ,“ unberücksichtigt liefs.
Taf. XLVII. Eine blühendo Pflanze der D ubois-Reymondia la n c ip e ta la Erst, und ein kleines, gleichfalls blühendos Exemplar der
. D.-R. palpigera Er st., beide wurden nach lebenden, von mir aus Venezuela mitgebrachten Exemplaren in dem Garten des Herrn Allard
gezeichnet 1—3. Eine Blume der D. p a lpige ra in verschiedenen Stellungen, viermal vergröfsert 4. Die Blumenlippe zwölfmal vergröfsert.
5 und 6. Die Griffelsäule von vom und von der Seite. 7. Letztere der Länge nach durchschnitten, sehr stark vorgröfsert. 8. Ein Staubbeutel
mit den Blumenstaubmassen. 9 und 10. Ein entleerter Staubbeutel von verschiedenen Seiten. 11 und 12. Die Blumenstaubmassen in verschiedenen
Lagen. 13 und 14. Eine Blume der D.-R. la n c ip e ta la in verschiedenen Stellungen, zweimal vergröfsert. 15. Letztere der Länge
nach halbirt, von Innen gesehen. 16. Die Blumenlippe von unten gesehen. 16. a. Dieselbe von oben. 17. Die Griffelsaule. 18. Ein Staubbeutel
und 19. Die Blumenstaubmassen derselben Pflanze.