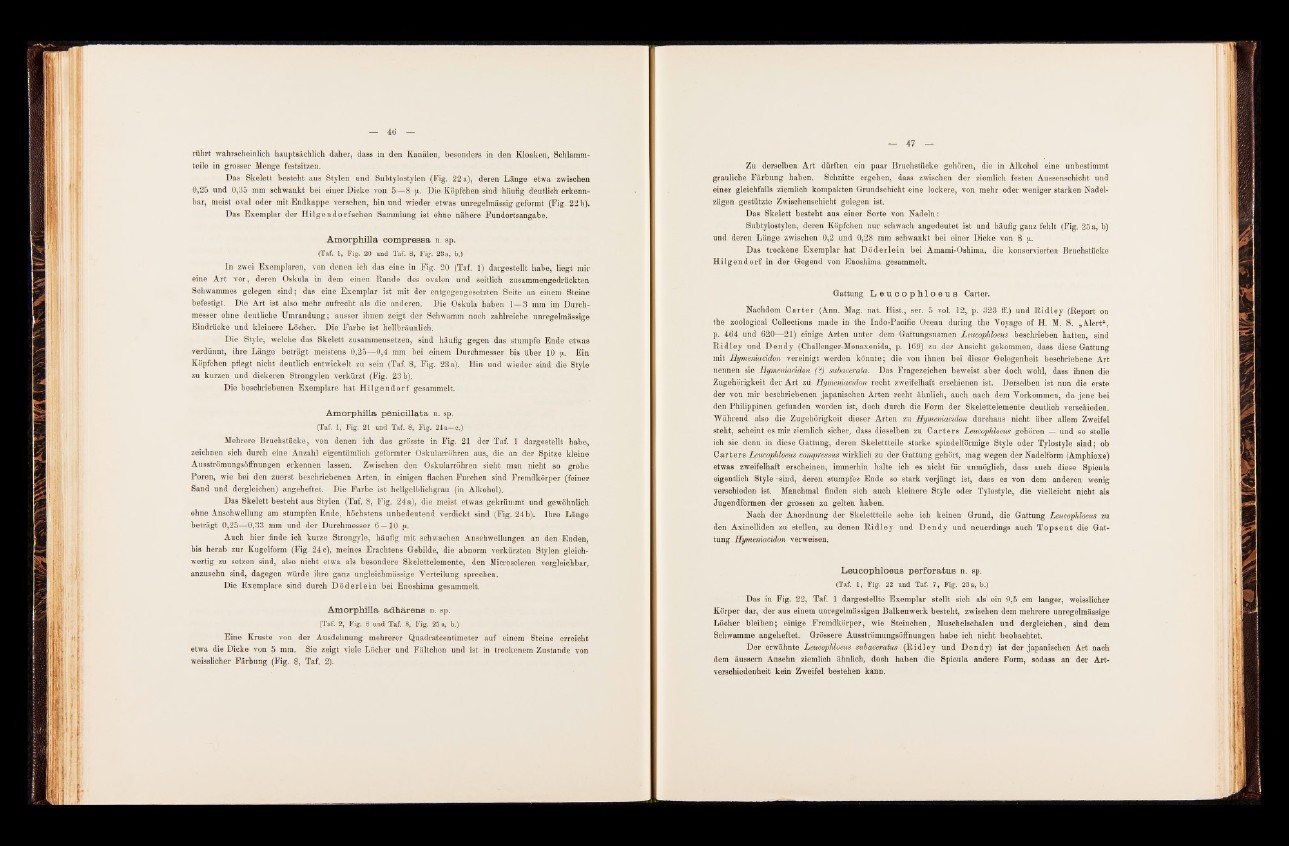
rührt wahrscheinlich hauptsächlich daher, dass in den Kanälen, besonders in den Kloaken, Schlammteile
in grösser Menge festsitzen.
Das Skelett besteht aus Stylen und Subtylostylen (Fig. 22 anderen Länge etwa zwischen
0,25 und 0,35 mm schwankt bei einer Dicke von 5—8 p. Die Köpfchen sind häufig deutlich erkennbar,
meist oval oder mit Endkappe versehen, hin und wieder etwas unregelmässig geformt (Fig. 22 b).
Das Exemplar der Hilgendorfschen Sammlung ist ohne nähere Fundortsangabe.
Amorphilla compressa n. sp.
(Taf. 1, Fig. 20 und Taf. 8, Fig. 23 a, b.)
In zwei Exemplaren, von denen ich das eine in Fig. 20 (Taf. 1) dargestellt habe, liegt mir
eine Art vor, deren Oskula in dem einen Rande des ovalen und seitlich zusammengedrückten
Schwammes gelegen sind; das eine Exemplar ist mit der entgegengesetzten Seite an einem Steine
befestigt. Die Art ist also mehr aufrecht als die anderen. Die Oskula haben 1—3 mm im Durchmesser
ohne deutliche Umrandung; ausser ihnen zeigt der Schwamm noch zahlreiche unregelmässige
Eindrücke und kleinere Löcher. Die Farbe ist hellbräunlich.
Die Style, welche das Skelett zusammensetzen, sind häufig gegen das stumpfe Ende etwas
verdünnt, ihre Länge beträgt meistens 0,25—0,4 mm bei einem Durchmesser bis über 10 p. Ein
Köpfchen pflegt nicht deutlich entwickelt zu sein (Taf. 8, Fig. 23 a). Hin und wieder sind die Style
zu kurzen und dickeren Strongylen verkürzt (Fig. 23 b).
Die beschriebenen Exemplare hat Hilgendorf gesammelt.
Amorphilla penicillata n. sp.
(Taf. 1, Fig. 21 und Taf. 8, Fig. 24 a—c;)
Mehrere Bruchstücke, von denen ich das grösste in Fig. 21 der Taf. 1 dargestellt habe,
zeichnen sich durch eine Anzahl eigentümlich geformter Oskularröhren aus, die an der Spitze kleine
AusströmungsöffnuDgen erkennen lassen. Zwischen den Oskularröhren sieht man nicht so grobe
Poren, wie bei den zuerst beschriebenen Arten, in einigen flachen Furchen sind Fremdkörper (feiner
Sand und dergleichen) angeheftet. Die Farbe ist hellgelblichgrau (in Alkohol).
Das Skelett besteht aus Stylen (Taf. 8, Fig. 24 a), die meist etwas gekrümmt und gewöhnlich
ohne Anschwellung am stumpfen Ende, höchstens unbedeutend verdickt sind (Fig. 24 b). Ihre Länge
beträgt 0,25—0,33 mm und der Durchmesser 6 — 10 p.
Auch hier finde ich kurze Strongyle, häufig mit schwachen Anschwellungen an den Enden,
bis herab zur Kugelform (Fig. 24 c), meines Erachtens Gebilde, die abnorm verkürzten Stylen gleichwertig
zu setzen sind, also nicht etwa als besondere Skelettelemente, den Microscleren vergleichbar,
anzusehn sind, dagegen würde ihre ganz ungleichmässige Verteilung sprechen.
Die Exemplare sind durch Döderlein bei Enoshima gesammelt.
Amorphilla adhärens n. sp.
(Taf. 2, Fig. 8 und Taf. 8, Fig. 25 a, b.)
Eine Kruste von der Ausdehnung mehrerer Quadratcentimeter auf einem Steine erreicht
etwa die Dicke von 5 mm. Sie zeigt viele Löcher und Fältchen und ist in trockenem Zustande von
weisslicher Färbung (Fig. 8, Taf. 2).
Zu derselben Art dürften ein paar Bruchstücke gehören, die in Alkohol eine unbestimmt
grauliche Färbung haben. Schnitte ergeben, dass zwischen der ziemlich festen Aussenschicht und
einer gleichfalls ziemlich kompakten Grundschicht eine lockere, von mehr oder weniger starken Nadelzügen
gestützte Zwischenschicht gelegen ist.
Das Skelett besteht aus einer Sorte von Nadeln:
Subtylostylen, deren Köpfchen nur schwach angedeutet ist und häufig ganz fehlt (Fig. 25 a, b)
und deren Länge zwischen 0,2 und 0,28 mm schwankt bei einer Dicke von 8 p.
Das trockene Exemplar hat Döderlein bei Amami-Oshima, die konservierten Bruchstücke
Hilgendorf in der Gegend von Enoshima gesammelt.
Gattung L e u c o p h l o e u s Carter.
Nachdem Carter (Ann. Mag. nat. Hist., ser. 5 vol. 12, p. 323 ff.) und Ridley (Report on
the zoological Collections made in the Indo-Pacific Ocean during the Voyage of H. M. S. „Alert“,
p. 464 und 620—21) einige Arten unter dem Gattungsnamen Leucophloeus beschrieben hatten, sind
Ridley und Dendy (Challenger-Monaxonida, p. 169) zu der Ansicht gekommen, dass diese Gattung
mit Hymeniacidon vereinigt werden könnte; die von ihnen bei dieser Gelegenheit beschriebene Art
nennen sie Hymeniacidon (?) subacerata. Das Fragezeichen beweist aber doch wohl, dass ihnen die
Zugehörigkeit der Art zu Hymeniacidon recht zweifelhaft erschienen ist. Derselben ist nun die erste
der von mir beschriebenen japanischen Arten recht ähnlich, auch nach dem Vorkommen, da jene bei
den Philippinen gefunden worden ist, doch durch die Form der Skelettelemente deutlich verschieden.
"Während also die Zugehörigkeit dieser Arten zu Hymeniacidon durchaus nicht über allem Zweifel
steht, scheint es mir ziemlich sicher, dass dieselben zu Carters Leucophloeus gehören — und so stelle
ich sie denn in diese Gattung, deren Skelettteile starke spindelförmige Style oder Tylostyle sind; ob
Carters Leucophloeus compressus wirklich zu der Gattung gehört, mag wegen der Nadelform (Amphioxe)
etwas zweifelhaft erscheinen, immerhin halte ich es nicht für unmöglich, dass auch diese Spicula
eigentlich Style -sind, deren stumpfes Ende so stark verjüngt ist, dass es von dem anderen wenig
verschieden ist. Manchmal finden sich auch kleinere Style oder Tylostyle, die vielleicht nicht als
Jugendformen der grossen zu gelten haben.
Nach der Anordnung der Skelettteile sehe ich keinen Grund, die Gattung Leucophloeus zu
den Axinelliden zu stellen, zu denen Ridley und Dendy und neuerdings auch Topsent die Gattung
Hymeniacidon verweisen.
Leucophloeus perforatus n. sp.
(Taf. 1, Fig. 22 und Taf. 7, Fig. 23 a, b.)
Das in Fig. 22, Taf. 1 dargestellte Exemplar stellt sich als ein 9,5 cm langer, weisslicher
Körper dar, der aus einem unregelmässigen Balkenwerk besteht, zwischen dem mehrere unregelmässige
Löcher bleiben; einige Fremdkörper, wie Steinchen, Muschelschalen und dergleichen, sind dem
Schwamme angeheftet. Grössere Ausströmungsöffnungen habe ich nicht beobachtet.
Der erwähnte Leucophloeus subaceratus. (Ridley und Dendy) ist der japanischen Art nach
dem äussern Ansehn ziemlich ähnlich, doch haben die Spicula andere Form, sodass an der Art-
versohiedenheit kein Zweifel bestehen kann.