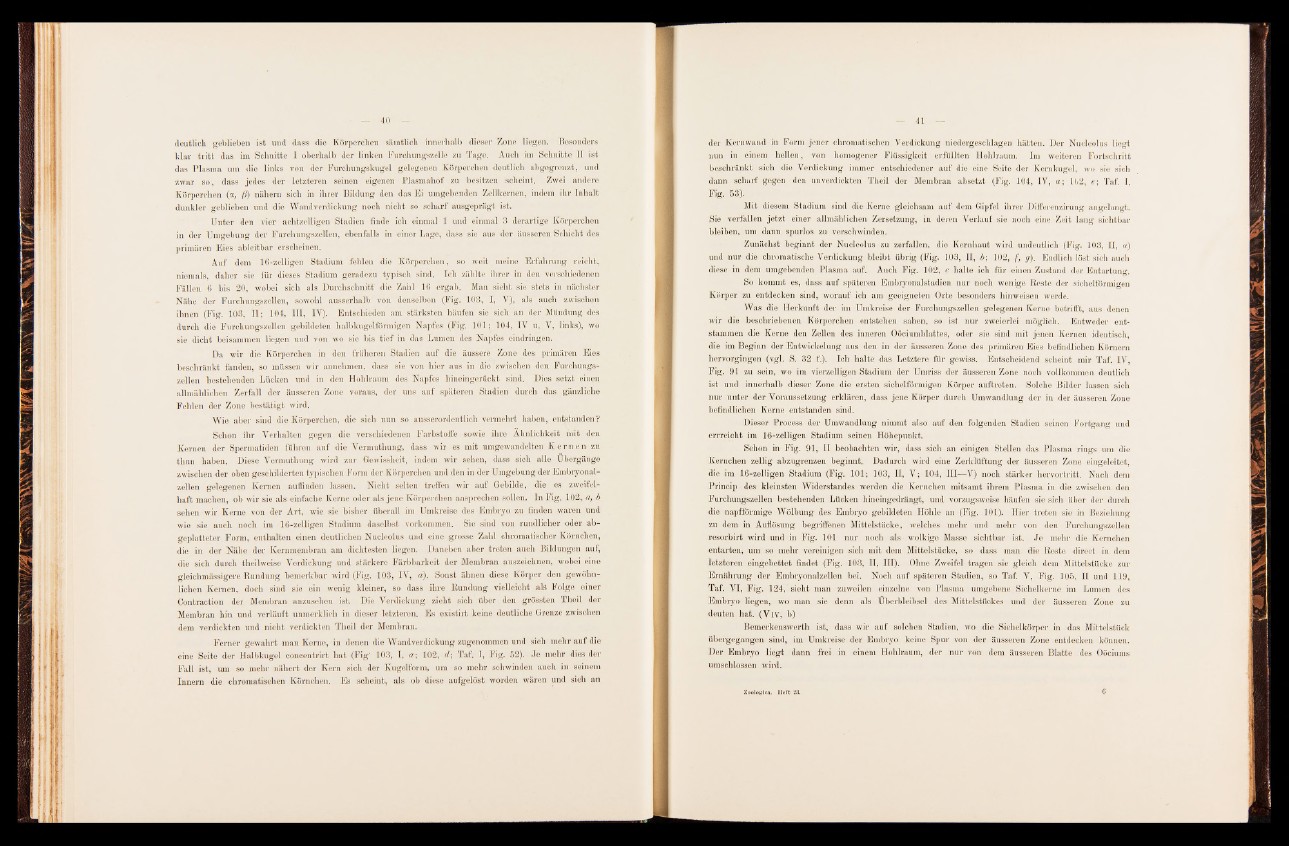
deutlich geblieben ist und dass die Körperchen sämtlich innerhalb dieser Zone liegen. Besonders
klar tritt das im Schnitte I oberhalb der linken Furchungszelle zu Tage. Auch im Schnitte II ist
das Plasma um die links von der Furchungskugel gelegenen Körperchen deutlich abgegrenzt, und
zwar so, dass jedes der letzteren seinen eigenen Plasmahof zu besitzen scheint. Zwei andere
Körperchen (a, ß) nähern sich in ihrer Bildung den das Ei umgebenden Zellkernen, indem ihr Inhalt
dunkler geblieben und die Wandverdickung noch nicht so scharf ausgeprägt ist.
Unter den vier achtzeiligen Stadien finde ich einmal 1 und einmal 3 derartige Körperchen
in der Umgebung der Furchungszellen, ebenfalls in einer Lage, dass sie aus der äusseren Schicht des
primären Eies ableitbar erscheinen.
Auf dem 16-zelligen Stadium fehlen die Körperchen, so weit meine Erfahrung reicht,
niemals, daher sie für dieses Stadium geradezu typisch sind. Ich zählte ihrer in den verschiedenen
Fällen 6 bis 20, wobei sich als Durchschnitt' die Zahl 16 ergab. Man sieht sie stets in nächster
Nähe der Furchungszellen, sowohl ausserhalb von denselben (Fig. 103, I, V), als auch zwischen
ihnen (Fig. 103, II; 104, III, IV). Entschieden am stärksten häufen sie sich an der Mündung des
durch die Furchungszellen gebildeten halbkugelförmigen Napfes (Fig. 101; 104, IV u. V, links), wo
sie dicht beisammen liegen und von wo sie bis tief in das Lumen des Napfes eindringen.
Da wir die Körperchen in den früheren Stadien auf die äussere Zone des primären Eies
beschränkt fanden, so müssen wir annehmen, dass sie von hier aus in die zwischen den Furchungszellen
bestehenden Lücken und in den Hohlraum des Napfes hineingerückt sind. Dies setzt einen
allmählichen Zerfall der äusseren Zone voraus, der uns auf späteren Stadien durch das gänzliche
Fehlen der Zone bestätigt wird.
Wie aber sind die Körperchen, die sich nun so ausserordentlich vermehrt haben, entstanden?
Schon ihr Verhalten gegen die verschiedenen Farbstoffe sowie ihre Ähnlichkeit mit den
Kernen der Spermatiden führen auf die Vermuthung, dass wir es mit umgewandelten K e r n e n zu
thun haben. Diese Vermuthung wird zur Gewissheit, indem wir sehen, dass sich alle Übergänge
zwischen der oben geschilderten typischen Form der Körperchen und den in der Umgebung der Embryonalzellen
gelegenen Kernen auffinden lassen. Nicht selten treffen wir auf Gebilde, die es zweifelhaft
machen, ob wir sie als einfache Kerne oder als jene Körperchen ansprechen sollen. In Fig. 102, a, b
sehen wir Kerne von der Art, wie sie bisher überall im Umkreise des Embryo zu finden waren und
wie sie auch noch im 16-zelligen Stadium daselbst Vorkommen. Sie sind von rundlicher oder abgeplatteter
Form, enthalten einen deutlichen Nucleolus und eine grosse Zahl chromatischer Körnchen,
die in der Nähe der Kernmembran am dichtesten liegen. Daneben aber treten auch Bildungen auf,
die sich durch theilweise Verdickung und stärkere Färbbarkeit der Membran auszeichnen, wobei eine
gleich «lässigere Rundung bemerkbar wird (Fig. 103, IV, a). Sonst ähnen diese Körper den gewöhnlichen
Kernen, doch sind sie ein wenig kleiner, so dass ihre Rundung vielleicht als Folge einer
Contraction der Membran anzusehen ist. Die Verdickung zieht sich über den grössten Theil der
Membran hin und verläuft unmerklich in dieser letzteren. Es existirt keine deutliche Grenze zwischen
dem verdickten und nicht verdickten Theil der Membran.
Ferner gewahrt man Kerne, in denen die Wandverdickung zugenommen und sich mehr auf die
eine Seite der Halbkugel concentrirt hat (Fig' 103, I, <z; 102, d\ Taf. I, Fig. 52). Je mehr dies der
Fall ist, um so mehr nähert der Kern sich der Kugelform, um so mehr schwinden auch in seinem
Innern die chromatischen Körnchen. Es scheint, als ob diese aufgelöst worden wären und sich an
der Kernwand in Form jener chromatischen Verdickung niedergeschlagen hätten. Der Nucleolus liegt
nun in einem hellen, von homogener Flüssigkeit erfüllten Hohlraum. Im weiteren Fortschritt
beschränkt sich die Verdickung immer entschiedener auf die eine Seite der Kernkugel, wo sie sich
dann scharf gegen den unverdickten Theil der Membran absetzt (Fig. 104, IV, a; 102, e ; Taf. I,
Fig. 53).
Mit diesem Stadium sind die Kerne gleichsam auf dem Gipfel ihrer Differenzirung angelangt.
Sie verfallen jetzt einer allmählichen Zersetzung, in deren Verlauf sie noch eine Zeit lang sichtbar
bleiben, um dann spurlos zu verschwinden.
Zunächst beginnt der Nucleolus zu zerfallen, die Kernhaut wird undeutlich (Fig. 103, II, a)
und nur die chromatische Verdickung bleibt übrig (Fig. 103, II, b; 102, f, g). Endlich löst sich auch
diese in dem umgebenden Plasma auf. Auch Fig. 102, c halte ich für einen Zustand der Entartung.
So kommt es, dass auf späteren Embryonalstadien nur noch wenige Reste der sichelförmigen
Körper zü entdecken sind, worauf ich am geeigneten Orte besonders hinweisen werde.
Was die Herkunft der im Umkreise der Furchungszellen gelegenen Kerne betrifft, aus denen
wir die beschriebenen Körperchen entstehen sahen, so ist nur zweierlei möglich. Entweder entstammen
die Kerne den Zellen des inneren Oöciumblattes, oder sie sind mit jenen Kernen identisch,
die im Beginn der Entwickelung aus den in der äusseren Zone des primären Eies befindlichen Körnern
hervorgingen (vgl. S. 32 f.). Ich halte das Letztere für gewiss. Entscheidend scheint mir Taf. IV,
Fig. 91 zu sein, wo im vierzeiligen Stadium der Umriss der äusseren Zone noch vollkommen deutlich
ist und innerhalb dieser Zone die ersten sichelförmigen Körper auftreten. Solche Bilder lassen sich
nur unter der Voraussetzung erklären, dass jene Körper durch Umwandlung der in der äusseren Zone
befindlichen Kerne entstanden sind.
Dieser Process der Umwandlung nimmt also auf den folgenden Stadien seinen Fortgang und
errreicht im 16-zelligen Stadium seinen Höhepunkt.
Schon in Fig. 91, II beobachten wir, dass sich an einigen Stellen das Plasma rings um die
Kernchen zellig abzugrenzen beginnt. Dadurch wird eine Zerklüftung der äusseren Zone eingeleitet,
die im 16-zelligen Stadium (Fig. 101; 103, II, V ; 104, III—V) noch stärker hervortritt. Nach dem
Princip des kleinsten Widerstandes werden die Kernchen mitsamt ihrem Plasma in die zwischen den
Furchungszellen bestehenden Lücken hineingedrängt, und vorzugsweise häufen sie sich über der durch
die napfförmige Wölbung des Embryo gebildeten Höhle an (Fig. 101). Hier treten sie in Beziehung
zu dem in Auflösung begriffenen Mittelstücke, welches mehr und mehr von den Furchungszellen
resorbirt wird und in Fig. 101 nur noch als wolkige Masse sichtbar ist. Je nlehr die Kernchen
entarten, um so mehr vereinigen sich mit dem Mittelstücke, so dass man die Reste direct in dem
letzteren eingebettet findet (Fig. 103, II, III). Ohne Zweifel tragen sie gleich dem Mittelstücke zur
Ernährung der Embryonalzellen bei. Noch auf späteren Stadien, so Taf. V, Fig. 105, II und 119,
Taf. VI, Fig. 124, sieht man zuweilen einzelne von Plasma umgebene Sichelkerne im Lumen des
Embryo liegen, wo man sie denn als Überbleibsel des Mittelstückes und der äusseren Zone zu
deuten hat. (VlV, b)
Bemerkenswerth ist, dass wir auf solchen Stadien, wo die Sichelkörper in das Mittelstück
übergegangen sind, im Umkreise der Embryo keine Spur von der äusseren Zone entdecken können.
Der Embryo liegt dann frei in einem Hohlraum, der nur von dem äusseren Blatte des Oöciums
umschlossen wird.