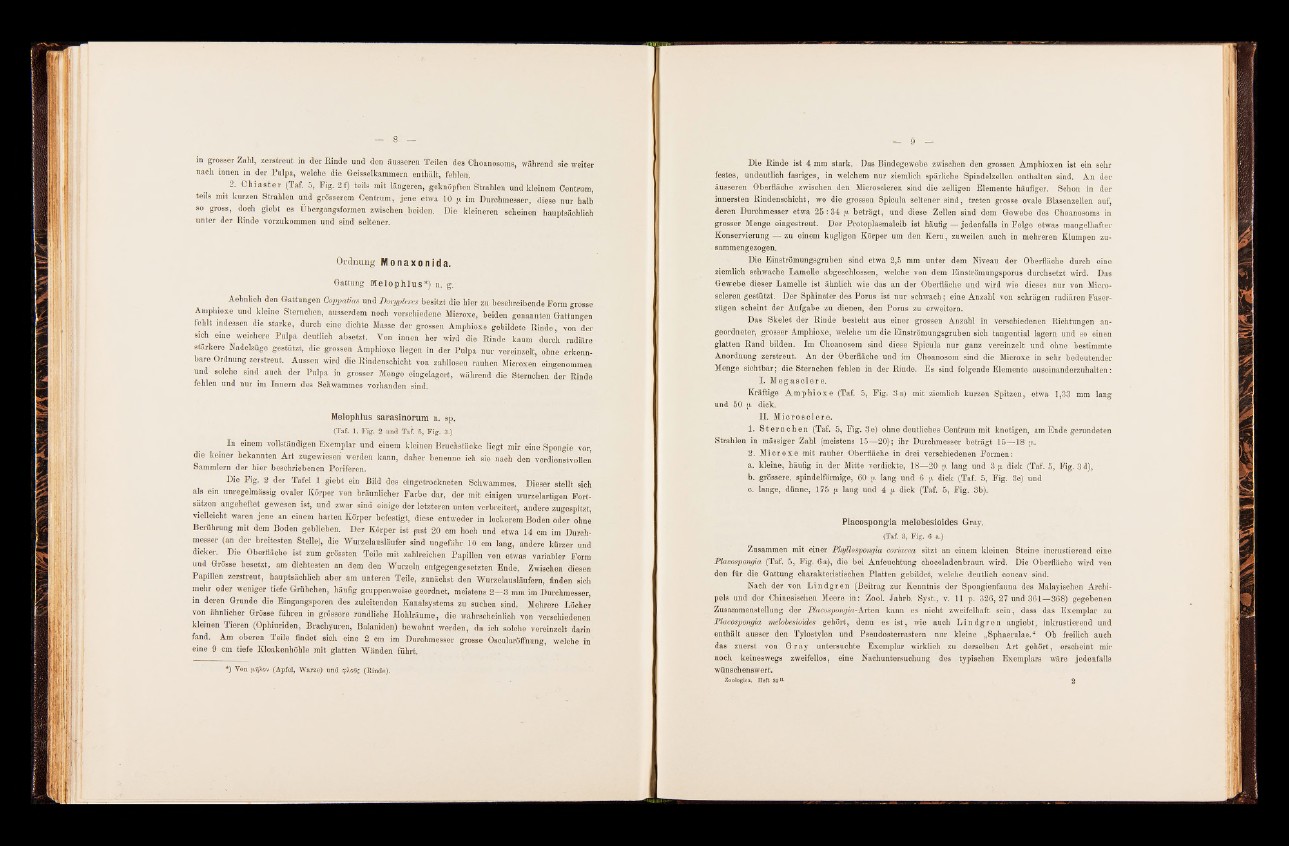
in grösser Zahl, zerstreut in der Rinde und den äusseren Teilen des Choanefems, während sie weiter
nach innen in der Pulpa, welche die Geisselkammern enthält., fehlen.
2. Chiaster (Taf. 5, Fig. $ $ teils mit längeren, geknöpften Strahlen und kleinem Centrum,
teils mit kurzen Strahlen und grösserem Centrum, jene etwa im Durchmesser, diese nur halb
so gross, doch giebt es Übergangsformen zwischen beiden. Die kleineren scheinen hauptsächlich
unter der Rinde vorzukommen und sind seltener.
Ordnung Monaxonida.
Gattung M e lo p h lu s* ) n. g.'
Aehnlich den Gattungen Coppatias und Dorypleres besitzt die hier zu beschreibende Form grosse
Amphioxe und kleine Sternchen, ansserdem noch verschiedene Microxe, beiden genannten Gattungen
fehlt indessen die starke, durch eine dichte Masse der grossen Amphioxe gebildete Rinde,, von der
sich eine weichere Pulpa deutlich absetzt. Von innen her wird die Rinde kaum durch radiäre
stärkere Nadelzüge gestützt, die grossen Amphioxe liegen in der Pulpa nur vereinzelt,* ohne erkennbare
Ordnung zerstreut. Aussen wird die Rindenschicht von zahllosen rauhen Mioroxen eingenommen
und solche sind auch der Pulpa in grösser Menge ;eingelagert, während die Sternchen, der Rinde
fehlen und nur im Innern des Schwammes vorhanden sind.
Melophlus sarasinorum n. sp.
(Taf. 2 und Taf. 5, Fig. | | f P
In einem vollständigen Exemplar und einem kleinen Bruchstücke liegt mir eine Spongie vor,
die keiner bekannten Art zugewieseri werden kann, daher benenne ich sie nach den verdienstvollen
Sammlern der hier beschriebenen Poriferen.
Die Fig. 2 der Tafel .1 .giebt ein Bild des eingetrockneten Schwammes. Dieser stellt sich
als ein unregelmässig ovaler Körper von bräunlicher Farbe dar, der mit einigen wurzelartigen Fortsätzen
angeheftet gewesen ist, und zwar sind einige der letzteren unten verbreitert, andere zugespitzt,
vielleicht waren jene an einem harten Körper befestigt, diese entweder in lockerem Boden oder ohne
Berührung mit dem Boden geblieben. Der Körper ist fast 20 cm hoch und etwa 14 cm im Durchmesser
(an der breitesten Stelle), die Wurzelansläufer sind ungefähr & cm lang, andere kürzer und
dicker. Die Oberfläche ist zum grössten Teile mit zahlreichen Papillen von etwas variabler Form
und Grösse besetzt, am dichtesten an dem den Wurzeln entgegengesetzten Ende. Zwischen diesen
Papillen zerstreut, hauptsächlich aber am unteren Teile, zunächst den Wnrzelansläufern, finden sich
mehr oder weniger tiefe Grübchen, häufig gruppenweise geordnet, meistens 2 - ||in m im Durchmesser,
in deren Grunde die Eingangsporen des znleitenden Kanalsystems zu suchen sind. Mehrere Löcher
von ähnlicher Grösse führen in grössere rundliche Hohlräume, die wahrscheinlich von verschiedenen
kleinen Tieren (Ophiuriden, Brachyuren, Balaniden) bewohnt werden, da ich solche vereinzelt darin
fand. Am oberen Teile findet sioh eine 2 cm im Durchmesser grosse Oscnlaröffnnng, welche in
eine 9 cm tiefe Kloakenhöhle mit glatten Wänden führt.
*) Von jiijXov (Apfel, Warze) und «pXoög (Rinde).
Die Rinde ist 4 mm stark. Das Bindegewebe zwischen den grossen Amphioxen ist ein sehr
festes, undeutlich fasriges, in welchem nur ziemlich spärliche Spindelzellen enthalten sind. An der
äusseren Oberfläche zwischen den Microscleren sind die zelligen Elemente häufiger. Schon in der
innersten Rindenschicht, wo die grossen Spicula seltener sind, treten grosse ovale Blasenzellen auf,
deren Durchmesser etwa 25 :34 p beträgt, und diese Zellen sind dem Gewebe des Choanosoms in
grösser Menge eingestreut. Der Protoplasmaleib ist häufig — jedenfalls in Folge etwas mangelhafter
Konservierung -pfzu einem kugligen Körper um den Kern, zuweilen auch in mehreren Klumpen zusammengezogen.
Die Einströmungsgruben sind etwa 2,5 mm unter dem Niveau der Oberfläche durch eine
ziemlich schwache Lamelle abgeschlossen, welche von dem Einströmungsporus durchsetzt wird. Das
Gewebe dieser Lamelle ist ähnlich wie das an der Oberfläche und wird wie dieses nur von Microscleren
gestützt. Der Sphincter des Porus ist nur schwach; eine Anzahl von schrägen radiären Faserzügen
scheint der Aufgabe zu dienen, den Porus zu erweitern.
Das Skelet der Rinde besteht aus einer grossen Anzahl in verschiedenen Richtungen angeordneter,
grösser Amphioxe, welche um die Einströmungsgruben sich tangential lagern und so einen
glatten Rand bilden. Im Choanosom sind diese Spicula nur ganz vereinzelt und ohne bestimmte
Anordnung zerstreut. An der Oberfläche und im Choanosom sind die Microxe in sehr bedeutender
Menge sichtbar; die Sternchen fehlen in der Rinde. Es sind folgende Elemente auseinanderzuhalten:
I. M eg a sc le re .
Kräftige Amph ioxe (Taf. 5, Fig. 3a) mit ziemlich kurzen Spitzen, etwa 1,33 mm lang
und 50 dick.
II. M ic ro sc ler e .
1. S tern ch en (Taf. 5, Fig. 3e) ohne deutliches Centrum mit knotigen, am Ende gerundeten
Strahlen in mässiger Zahl (meistens 15—20); ihr Durchmesser beträgt 15—18 p.
2. M icroxe mit rauher Oberfläche in drei verschiedenen Formen:
a. kleine, häufig in der Mitte verdickte, 18—20 p lang und 3 p dick (Taf. 5, Fig. 3d),
b. grössere, spindelförmige, 60 p lang und 6 p dick (Taf. 5, Fig. 3c) und
c. lange, dünne, 175 p lang und 4 p dick (Taf. 5, Fig. 3b).
Placospongia melobesioides Gray.
(Taf. 3, Fig. 6 a.)
Zusammen mit einer Phyllospongia coriacea sitzt an einem kleinen Steine incrustierend eine
Placospongia (Taf. 5, Fig. 6 a), die bei Anfeuchtung chocoladenbraun wird. Die Oberfläche wird von
den für die Gattung charakteristischen Platten gebildet, welche deutlich concav sind.
Nach der von Lindgren (Beitrag zur Kenntnis der Spongienfauna des Malayischen Archipels
und der Chinesischen Meere in: Zool. Jahrb. Syst., v. 11 p. 326, 27 und 361—368) gegebenen
Zusammenstellung der Placospongia-Arten kann es nicht zweifelhaft sein, dass das Exemplar zu
Placospongia melobesioides gehört, denn es ist, wie auch L in d g r en angiebt, inkrustierend und
enthält ausser den Tylostylen und Pseudosterrastern nur kleine „Sphaerulae.“ Ob freilich auch
das zuerst von Gray untersuchte Exemplar wirklich zu derselben Art gehört, erscheint mir
noch keineswegs zweifellos, eine Nachuntersuchung des typischen Exemplars wäre jedenfalls
wünschenswert.
Zoologica. Heft 24 "■ 2