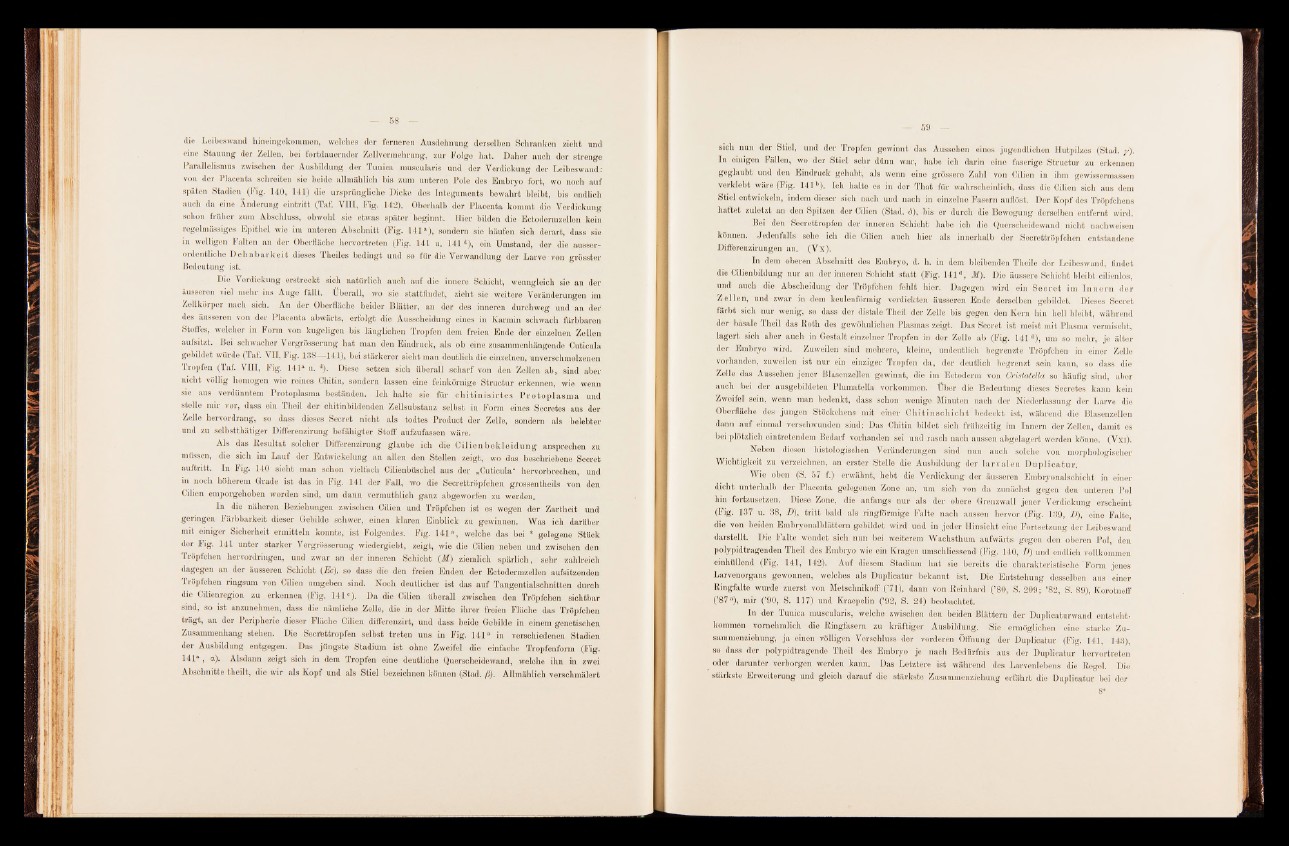
die Leibeswand hineiugekommen, welches der ferneren Ausdehnung derselben Schranken zieht und
eine Stauung der Zellen, bei fortdauernder Zellvermehrung, zur Folge hat. Daher auch der strenge
Parallelismus zwischen der Ausbildung der Tunica muscularis und der Verdickung der Leibeswaud:
von der Placenta schreiten sie beide allmählich bis zum unteren Pole des Embryo fort, wo noch auf
späten Stadien (Fig. HO, 141) die ursprüngliche Dicke des Integuments bewahrt bleibt, bis endlich
auch da eine Änderung eintritt (Taf. VIII, Fig. 142). Oberhalb der Placenta kommt die Verdickung
schon früher zum Abschluss, obwohl sie etwas später beginnt. Hier bilden die Ectodermzellen kein
regelmässiges Epithel wie im unteren Abschnitt (Fig. 141“), sondern sie häufen sich derart, dass sie
in welligen Falten an der Oberfläche heryortreten (Fig. 141 u. 141 d), ein Umstand, der die ausserordentliche
D ehnbarkeit dieses Theiles bedingt und so für die Verwandlung der Larvevon grösster
Bedeutung ist.
Die Verdickung erstreckt sich natürlich auch auf die innere Schicht, wenngleich sie an der
äusseren viel mehr ins Auge fallt. Überall, wo sie stattfindet, zieht sie weitere Veränderungen im
Zellkörper nach sieb. An der Oberfläche beider Blätter, an der des inneren durchweg und an der
des äusseren von der Placenta abwärts, erfolgt die Ausscheidung eines in Karmin schwach färbbaren
Stoffes, welcher in Form von kugeligen bis länglichen Tropfen dem freien Ende der einzelnen Zellen
aufsitzt. Bei schwacher Vergrösserung hat man den Eindruck, als ob eine zusammenhängende Cuticula
gebildet würde (Taf. VII, Fig. 138—141), bei stärkerer sieht man deutlich die einzelnen, unverschmolzenen
Tropfen (Taf. VIII, Fig. 141“ u. d). Diese setzen sich überall scharf von den Zellen ab, sind aber
nicht völlig homogen wie reines Chitin, sondern lassen eine feinkörnige Structur erkennen, wie wenn
sie aus verdünntem Protoplasma beständen. Ich halte sie für c h itin is ir t e s Protop la sm a und
stelle mir vor, dass ein Theil der chitinbildenden Zellsubstanz selbst in Form eines Secretes aus der
Zelle hervordrang, so dass dieses Secret nicht als todtes Product der Zelle, sondern als belebter
und zu selbstthätiger Differenzirung befähigter Stoff aufzufassen wäre.
Als das Resultat solcher Differenzirung glaube ich die C ilien b ek le id u n g ansprechen zu
müssen, die sich im Lauf der Entwickelung an allen den Stellen zeigt, wo das beschriebene Secret
auftritt. In Fig. 140 sieht man schon vielfach Cilienbüschel aus der „Cuticula“ hervorbrechen, und
in noch höherem Grade ist das in Fig. 141 der Fall, wo die Secrettröpfchen grossentheils von den
Cilien emporgehoben worden sind, um dann vermuthlich ganz abgeworfen zu werden.
In die näheren Beziehungen zwischen Cilien und Tröpfchen ist es wegen der Zartheit und
geringen Färbbarkeit dieser Gebilde schwer, einen klaren Einblick zu gewinnen. Was ich darüber
mit einiger Sicherheit ermitteln konnte, ist Folgendes. Fig. 141“, welche das bei * gelegene Stück
der Fig. 141 unter starker Vergrösserung wiedergiebt, zeigt, wie die Cilien neben und zwischen den
Tröpfchen hervordringen, und zwar an der inneren Schicht (M) ziemlich spärlich, sehr zahlreich
dagegen an der äusseren Schicht {Ec), so dass die den freien Enden der Ectodermzellen aufsitzenden
Tröpfchen ringsum von Cilien umgeben sind. Noch deutlicher ist das auf Tangentialschnitten durch
die Cilienregion zu erkennen (Fig. 141°), Da die Cilien überall zwischen den Tröpfchen sichtbar
sind, so ist anzunehmen, dass die nämliche Zelle, die in der Mitte ihrer freien Fläche das Tröpfchen
trägt, an der Peripherie dieser Fläche Cilien differenzirt, und dass beide Gebilde in einem genetischen
Zusammenhang stehen. Die Secrtittropfen selbst treten uns in Fig. 141 “ in verschiedenen Stadien
der Ausbildung entgegen. Das jüngste Stadium ist ohne Zweifel die einfache Tropfenform (Fig.
141“ , a). Alsdann zeigt sich in dem Tropfen eine deutliche Querscheidewand, welche ihn in zwei
Abschnitte theilt, die wir als Kopf und als Stiel bezeichnen können (Stad. ß). Allmählich verschmälert
sich nun der Stiel, und der Tropfen gewinnt das Aussehen eines jugendlichen Hutpilzes (Stad. y).
In einigen Fällen, wo der Stiel sehr dünn war, habe ich darin eine faserige Structur zu erkennen
geglaubt und den Eindruck gehabt, als wenn eine grössere Zahl von Cilien in ihm gewissermassen
verklebt wäre (Fig. 141b). Ich halte es in der Thot für wahrscheinlich, dass die Cilien sich aus dem
Stiel entwickeln, indem dieser sich nach und nach in einzelne Fasern auflöst. Der Kopf des Tröpfchens
haftet zuletzt an den Spitzen der Cilien (Stad, ö), bis er durch die Bewegung derselben entfernt wird.
Bei den Secrettropfen der inneren Schicht habe ich die Querscheidewand nicht nachweisen
können. Jedenfalls sehe ich die Cilien auch hier als innerhalb der Secrettröpfchen entstandene
Differenzirungen an. (Vx).
In dem oberen Abschnitt des Embryo, d. h. in dem bleibenden Theile der Leibeswand, findet
die Cilienbildung nur an der inneren Schicht statt (Fig. 1414, M). Die äussere Schicht bleibt cilienlos,
und auch die Abscheidung der Tröpfchen fehlt hier. Dagegen wird ein S ecret im Innern der
Zellen, und zwar in dem keulenförmig verdickten äusseren Ende derselben gebildet. Dieses Secret
färbt sich nur wenig, so dass der distale Theil der Zelle bis gegen den Kern hin hell bleibt, während
der basale Theil das Roth des gewöhnlichen Plasmas zeigt. Das Secret ist meist mit Plasma vermischt,
lagert sich aber auch in Gestalt einzelner Tropfen in der Zelle ab (Fig. 141d), um so mehr, je älter
der Embryo wird. Zuweilen sind mehrere, kleine, undeutlich begrenzte Tröpfchen in einer Zelle
vorhanden, zuweilen ist nur ein einziger Tropfen da, der deutlich begrenzt sein kann, so dass die
Zelle das Aussehen jener Blasenzellen gewinnt, die im Ectoderm von Cristatella so häufig sind, aber
auch bei der ausgebildeten Plumatella Vorkommen. Über die Bedeutung dieses Secretes kann kein
Zweifel sein, wenn man bedenkt, dass schon wenige Minuten nach der Niederlassung der Larve die
Oberfläche des jungen Stückchens mit einer C h itin sch ich t bedeckt ist, während die Blasenzellen
dann auf einmal verschwunden sind: Das Chitin bildet sich frühzeitig im Innern der Zellen, damit es
bei plötzlich eintretendem Bedarf vorhanden sei und rasch nach aussen abgelagert werden könne. (Vxi).
Neben diesen histologischen Veränderungen sind nun auch solche von morphologischer
Wichtigkeit zu verzeichnen, an erster Stelle die Ausbildung der larvalen Duplicatur.
Wie oben (S. 57 f.) erwähnt, hebt die Verdickung der äusseren Embryonalschicht in einer
dicht unterhalb der Placenta gelegenen Zone an, um sich von da zunächst gegen den unteren Pol
hin fortzusetzen. Diese Zone, die anfangs nur als der obere Grenzwall jener Verdickung erscheint
(Fig. 137 u. 38, D), tritt bald als ringförmige Falte nach aussen hervor (Fig. 139, Z>), eine Falte,
die von beiden Embryonalblättern gebildet wird und in jeder Hinsicht eine Fortsetzung der Leibeswand
darstellt. Die Falte wendet sich nun bei weiterem Wachsthum aufwärts gegen den oberen Pol, den
polypidtragenden Theil des Embryo wie ein Kragen umschliessend (Fig. 140, D) und endlich vollkommen
einhüllend (Fig. 141, 142). Auf diesem Stadium hat sie bereits die charakteristische Form jenes
Larvenorgans gewonnen, welches als Duplicatur bekannt ist. Die Entstehung desselben aus einer
Ringfalte wurde zuerst von Metschnikoff (’71), dann von Reinhard (’80, S. 209; ’82, S. 89), Korotneff
(’87*), mir ('90, S. 117) und Kraepelin (’92, S. 24) beobachtet.
In der Tunica muscularis, welche zwischen den beiden Blättern der Duplicaturwand entsteht,
kommen vornehmlich die Ringfasem zu kräftiger Ausbildung. Sie ermöglichen eine starke Zusammenziehung,
ja einen völligen Verschluss der vorderen Öffnung der Duplicatur (Fig. 141, 143)
so dass der polypidtragende Theil des Embiyo je nach Bedürfnis aus der Duplicatur hervortreten
oder darunter verborgen werden kann. Das Letztere ist während des Larvenlebens die Regel. Die
stärkste Erweiterung und gleich darauf die stärkste Zusammenziehung erfährt die Duplicatur bei der
8*