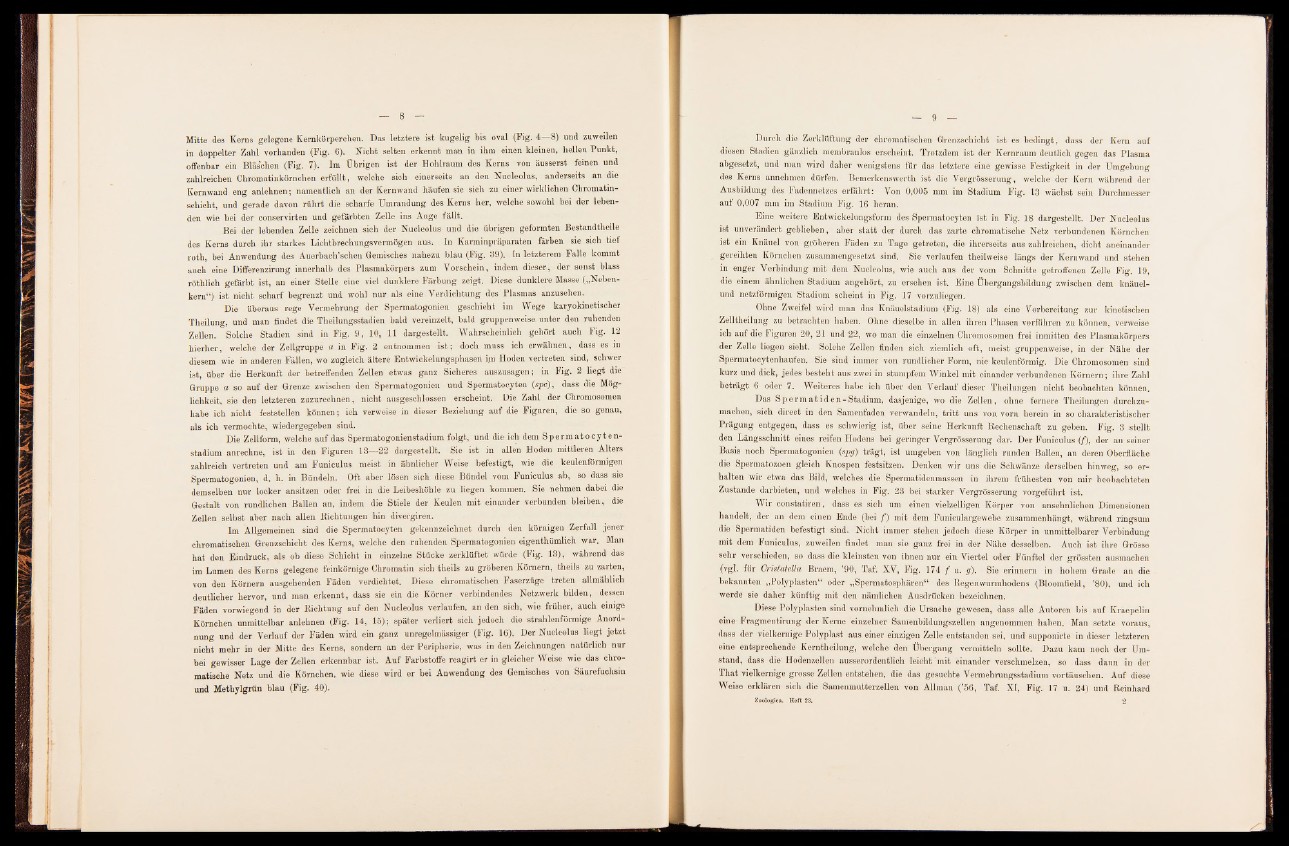
Mitte des Kerns gelegene Kernkörperchen. Das letztere ist kugelig bis oval (Fig. 4 8) und zuweilen
in doppelter Zahl vorhanden (Fig. 6). Nicht selten erkennt man in ihm einen kleinen, hellen Punkt,
offenbar ein Bläschen (Fig. 7). Im Übrigen ist der Hohlraum des Kerns von äusserst feinen und
zahlreichen Chromatinkörnchen erfüllt, welche sich einerseits an den Nucleolus, anderseits an die
Kernwand eng anlehnen; namentlich an der Kern wand häufen sie sich zu einer wirklichen Chromatin-
schicht, und gerade davon rührt die scharfe Umrandung des Kerns her, welche sowohl bei der lebenden
wie bei der conservirten und gefärbten Zelle ins Auge fällt.
Bei der lebenden Zelle zeichnen sich der Nucleolus und die übrigen geformten Bestandtheile
des Kerns durch ihr starkes Lichtbrechungsvermögen aus* In Karminpräparaten färben sie sich tief
roth, bei Anwendung des Auerbach’schen Gemisches nahezu blau (Fig. 89). In letzterem Falle kommt
auch eine Differenzirung innerhalb des Plasmakörpers zum Vorschein, indem dieser, der sonst blass
röthlich gefärbt ist, an einer Stelle eine viel dunklere Färbung zeigt. Diese dunklere Masse („Nebenkern“)
ist nicht scharf begrenzt und wohl nur als eine Verdichtung des Plasmas anzusehen.
Die überaus rege Vermehrung der Spermatogonien geschieht im Wege karyokinetischer
Theilung, und man findet die Th eilungsstad ien bald vereinzelt, bald gruppenweise unter den ruhenden
Zellen. Solche Stadien sind in Fig. 9 , 10, 11 dargestellt. Wahrscheinlich gehört auch Fig. 12
hierher, welche der Zellgruppe a in Fig. 2 entnommen ist; doch muss ich erwähnen, dass es in
diesem wie in anderen Fällen, wo zugleich ältere Entwickelungsphaseri ipi Hoden vertreten sind, schwer
ist, über die Herkunft der betreffenden Zellen etwas ganz Sicheres auszusagen; in Fig. 2 liegt die
Gruppe a so auf der Grenze zwischen den Spermatogonien und Spermatocyten (spc) , dass die Möglichkeit,
sie den letzteren zuzurechnen, nicht ausgeschlossen erscheint. Die Zahl der Chromosomen
habe ich nicht feststellen können; ich verweise in dieser Beziehung auf die Figuren, die so genau,
als ich vermochte, wiedergegeben sind.
Die Zellform, welche auf das Spermatogonienstadium folgt, und die ich dem S p e rm a to c y t e n -
stadium anrechne, ist in den Figuren 13—22 dargestellt. Sie ist in allen Hoden mittleren Alters
zahlreich vertreten und am Funiculus meist in ähnlicher Weise befestigt, wie die keulenförmigen
Spermatogonien, d. h. in Bündeln. Oft aber lösen sich diese Bündel vom Funiculus ab, so dass sie
demselben nur locker ansitzen oder frei in die Leibeshöhle zu liegen kommen. Sie nehmen dabei die
Gestalt von rundlichen Ballen an, indem die Stiele der Keulen mit einander verbunden bleiben, die
Zellen selbst aber nach allen Richtungen hin divergiren.
Im Allgemeinen sind die Spermatocyten gekennzeichnet durch den körnigen Zerfall jener
chromatischen Grenzschicht des Kerns, welche den ruhenden Spermatogonien eigentümlich war. Man
hat den Eindruck, als ob diese Schicht in einzelne Stücke zerklüftet würde (Fig. 13), während das
im Lumen des Kerns gelegene feinkörnige Chroraatin sich theils zu gröberen Körnern, theils zu zarten,
von den Körnern ausgehenden Fäden verdichtet. Diese chromatischen Faserzüge treten allmählich
deutlicher hervor, und man erkennt, dass sie ein die Körner verbindendes Netzwerk bilden, dessen
Fäden vorwiegend in der Richtung auf den Nucleolus verlaufen, an den sich, wie früher, auch einige
Körnchen unmittelbar anlehnen (Fig. 14, 15); später verliert sich jedoch die strahlenförmige Anordnung
und der Verlauf der Fäden wird ein ganz unregelmässiger (Fig. 16). Der Nucleolus liegt jetzt
nicht mehr in der Mitte des Kerns, sondern an der Peripherie, was in den Zeichnungen natürlich nur
bei gewisser Lage der Zellen erkennbar ist. Auf Farbstoffe reagirt er in gleicher Weise wie das chromatische
Netz und die Körnchen, wie diese wird er bei Anwendung des Gemisches von Säurefuchsin
und Methylgrün blau (Fig. 40).
Durch die Zerklüftung der chromatischen Grenzschicht ist es bedingt, dass der Kern auf
diesen Stadien gänzlich membranlos erscheint. Trotzdem ist der Kernraum deutlich gegen das Plasma
abgesetzt, und man wird daher wenigstens für das letztere eine gewisse Festigkeit in der Umgebung
des Kerns annehmen dürfen. Bemerkenswerth ist die Vergrösserung, welche der Kern während der
Ausbildung des Fadennetzes erfährt: Von 0,005 mm im Stadium Fig. 13 wächst sein Durchmesser
auf 0,007 mm im Stadium Fig. 16 heran.
Eine weitere Entwickelungsform des Spermatocyten ist in Fig. 18 dargestellt. Der Nucleolus
ist unverändert geblieben, aber statt der durch das zarte chromatische Netz verbundenen Körnchen
ist ein Knäuel von gröberen Fäden zu Tage getreten, die ihrerseits aus zahlreichen, dicht aneinander
gereihten Körnchen zusammengesetzt sind. Sie verlaufen theilweise längs der Kernwand und stehen
in enger Verbindung mit dem Nucleolus, wie auch aus der vom Schnitte getroffenen Zelle Fig. 19,
die einem ähnlichen Stadium angehört, zu ersehen ist. Eine Übergangsbildung zwischen dem knäuel-
und netzförmigen Stadium scheint in Fig. 17 vorzuliegen.
Ohne Zweifel wird man das Knäuelstadium (Fig. 18) als eine Vorbereitung zur kinetischen
Zelltheilung zu betrachten haben. Ohne dieselbe in allen ihren Phasen vorführen zu können, verweise
ich auf die Figuren 20, 21 und 22, wo man die einzelnen Chromosomen frei inmitten des Plasmakörpers
der Zelle liegen sieht. Solche Zellen finden sich ziemlich oft, meist gruppenweise, in der Nähe der
Spermatocytenhaufen. Sie sind immer von rundlicher Form, nie keulenförmig. Die Chromosomen sind
kurz und dick, jedes besteht aus zwei in stumpfem Winkel mit einander verbundenen Körnern; ihre Zahl
beträgt 6 oder 7. Weiteres habe ich über den Verlauf dieser Theilungen nicht beobachten können.
Das S p e rm a tid en -S ta d ium , dasjenige, wo die Zellen, ohne fernere Theilungen durchzumachen,
sich direct in den Samenfaden verwandeln, tritt uns von vorn herein in so charakteristischer
Prägung entgegen, dass es schwierig ist, über seine Herkunft Rechenschaft zu geben. Fig. 3 stellt
den Längsschnitt eines reifen Hodens bei geringer Vergrösserung dar. Der Funiculus (/), der an seiner
Basis noch Spermatogonien (spc/) trägt, ist umgeben von länglich runden Ballen, an deren Oberfläche
die Spermatozoen gleich Knospen festsitzen. Denken wir uns die Schwänze derselben hinweg, so erhalten
wir etwa das Bild, welches die Spermatidenmassen in ihrem frühesten von mir beobachteten
Zustande darbieten, und welches in Fig. 23 bei starker Vergrösserung vorgeführt ist.
Wir constatiren, dass es sich um einen vielzelligen Körper von ansehnlichen Dimensionen
handelt, der an dem einen Ende (bei f ) mit dem Funiculargewebe zusammenhängt, während ringsum
die Spermatiden befestigt sind. Nicht immer stehen jedoch diese Körper in unmittelbarer Verbindung
mit dem Funiculus, zuweilen findet man sie ganz frei in der Nähe desselben. Auch ist ihre Grösse
sehr verschieden, so dass die kleinsten von ihnen nur ein Viertel oder Fünftel der grössten ausmachen
(vgl. für Cristatella Braem, ’90, Taf. XV, Fig. 174 f u. g). Sie erinnern in hohem Grade an die
bekannten „Polyplasten“ oder „Spermatosphären“ des Regenwurmhodens (Bloomfield, ’80), und ich
werde sie daher künftig mit den nämlichen Ausdrücken bezeichnen.
Diese Polyplasten sind vornehmlich die Ursache gewesen, dass alle Autoren bis auf Kraepelin
eine Fragmentirung der Kerne einzelner Sanienbildungszellen angenommen haben. Man setzte voraus,
dass der vielkernige Polyplast aus einer einzigen Zelle entstanden sei, und supponirte in dieser letzteren
eine entsprechende Kerntheilung, welche den Übergang vermitteln sollte. Dazu kam noch der Umstand,
dass die Hodenzellen ausserordentlich leicht mit einander verschmelzen, so dass dann in der
That vielkemige grosse Zellen entstehen, die das gesuchte Vermehrungsstadium vortäuschen. Auf diese
Weise erklären sich die Samenmutterzellen von Allman (’56, Taf. XI, Fig. 17 u. 24) und Reinhard
Zoologica. Heft 23. 2