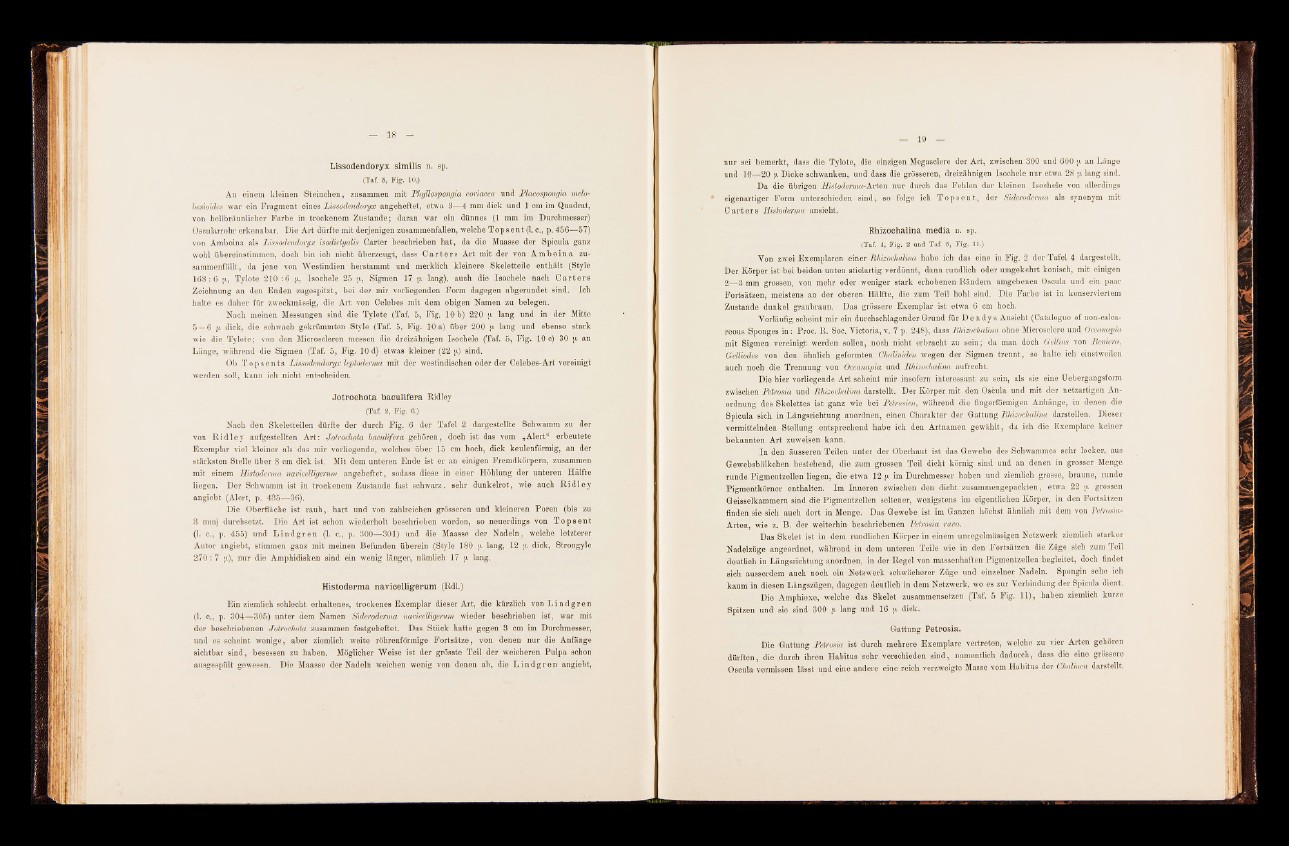
Lissodendoryx similis n. sp.
(Taf. 5, Fig. 10.)
An einem kleinen Steinchen, zusammen mit Phyllospongia coriacea und Placospongia melo-
besioides war ein Fragment eines Lissodendoryx angeheftet, etwa 3—4 mm dick und 1 cm im Quadrat,
von hellbräunlicher Farbe in trockenem Zustande; daran war ein dünnes (L mm im Durchmesser)
Oscularrohr erkennbar. Die Art dürfte mit derjenigen zusamraenfallen, welche Topsent (1. c., p. 456—57)
von Amboina als Lissodendoryx isodictyalis Carter beschrieben hat, da die Maasse der Spicula ganz
wohl übereinstimmen, doch bin ich nicht überzeugt, dass Carters Art mit der von Amboina zusammenfällt,
da jene von "Westindien herstammt und merklich kleinere Skeletteile enthält (Style
168:6 p, Tylote 210 :6 p, Isochele 25 p, Sigmen 17 p lang), auch die Isochele nach Carters
Zeichnung an den Enden zugespitzt, bei der mir vorliegenden Form dagegen abgerundet sind. Ich
halte es daher für zweckmässig, die Art von Celebes mit dem obigen Namen zu belegen.
Nach meinen Messungen sind die Tylote (Taf. 5, Fig. 10 b) 220 p lang und in der Mitte
5 — 6 p dick, die schwach gekrümmten Style (Taf. 5, Fig. 10 a) über 200 p lang und ebenso stark
wie die Tylote; von den Microscleren messen die dreizähnigen Isochele (Taf. 5, Fig. 10c) 30 p an
Länge, während die Sigmen (Taf. 5, Fig. 10 d) etwas kleiner (22 p) sind.
Ob T o p s en ts Lissodendoryx leptoderma mit der westindischen oder der Celebes-Art vereinigt
werden soll, kann ich nicht entscheiden.
Jotrochota baculifera Ridley
(Taf. 2, Fig. 6.) -L
Nach den Skeletteilen dürfte der durch Fig. 6 der Tafel 2 dargestellte Schwamm zu der
von R id le y aufgestellten Art: Jotrochota baculifera gehören, doch ist das vom „Alert“ erbeutete
Exemplar viel kleiner als das mir vorliegende, welches über 15 cm hoch, dick keulenförmig, an der
stärksten Stelle über 8 cm dick ist. Mit dem unteren Ende ist er an einigen Fremdkörpern, zusammen
mit einem Histoderma navicelligerum angeheftet, sodass diese in einer Höhlung der unteren Hälfte
liegen. Der Schwamm ist in trockenem Zustande fast schwarz, sehr dunkelrot, wie auch R id le y
angiebt (Alert, p. 435—36).
Die Oberfläche ist rauh, hart und von zahlreichen grösseren und kleineren Poren (bis zu
3 mm) durchsetzt. Die Art ist schon wiederholt beschrieben worden, so neuerdings von T op sen t
(1. c., p. 455) und L in d g r en (1. c., p. 300—301) und die Maasse der Nadeln, welche letzterer
Autor angiebt, stimmen ganz mit meinen Befunden überein (Style 180 p lang, 12 p dick, Strongyle
270 : 7 p), nur die Amphidisken sind ein wenig länger, nämlich 17 p lang.
Histoderma navicellig*erum (Rdl.)
Ein ziemlich schlecht erhaltenes, trockenes Exemplar dieser Art, die kürzlich von L in d g r en
(1. c., p. 304—305) unter dem Namen Sideroderma naviceUigenm wieder beschrieben ist, war mit
der beschriebenen Jotrochota zusammen festgeheftet. Das Stück hatte gegen 3 cm im Durchmesser,
und es scheint wenige, aber ziemlich weite röhrenförmige Fortsätze, von denen nur die Anfänge
sichtbar sind, besessen zu haben. Möglicher Weise ist der grösste Teil der weicheren Pulpa schon
ausgespült gewesen. Die Maasse der Nadeln weichen wenig von denen ab, die L indg r en angiebt,
nur sei bemerkt, dass die Tylote, die einzigen Megasclere der Art, zwischen 300 und 600 p an Länge
und 10—20 p Dicke schwanken, und dass die grösseren, dreizähnigen Isochele nur etwa 28 p lang sind.
Da die übrigen Histoclerma-Avten nur durch das Fehlen der kleinen Isochele von allerdings
eigenartiger Form unterschieden sind, so folge ich T o p s en t, der Sideroderma als synonym mit
Carters Histoderma ansieht.
Rhizochalina media n. sp.
(Taf. 4, Fig. 2 und Taf. 5, Fig. l l H f l
Yon zwei Exemplaren einer Rhizochalina habe ich das eine in Fig. 2 der Tafel 4 dargestellt.
Der Körper ist bei beiden unten stielartig verdünnt, dann rundlich oder umgekehrt konisch, mit einigen
2—3 mm grossen, von mehr oder weniger stark erhobenen Rändern umgebenen Oscula und ein paar
Fortsätzen, meistens an der oberen Hälfte, die zum Teil hohl sind. Die Farbe ist in konserviertem
Zustande dunkel graubraun. Das grössere Exemplar ist etwa 6 cm hoch.
Vorläufig scheint mir ein durchschlagender Grund für D en d y s Ansicht (Catalogue of non-calca-
reous Sponges in: Proc. R. Soc. Victoria, v. 7 p. 248), dass Rhizochalina ohne Microsclere und Oceanapia
mit Sigmen vereinigt werden sollen, noch nicht erbracht zu sein; da man doch GelUus von Reniera,
Gelliodes von den ähnlich geformten Ghaliniden wegen der Sigmen trennt, so halte ich einstweilen
auch noch die Trennung von Oceanapia und Rhizochalina aufrecht.
Die hier vorliegende Art scheint mir insofern interessant zu sein, als sie eine Uebergangsform
zwischen Petrosia und Rhizochalina darstellt. Der Körper mit den Oscula und mit der netzartigen Anordnung
des Skelettes ist ganz wie bei Petrosien, während die fingerförmigen Anhänge, in denen die
Spicula sich in Längsrichtung anordnen, einen Charakter der Gattung Rhizochalina darstellen. Dieser
vermittelnden Stellung entsprechend habe ich den Artnamen gewählt, da ich die Exemplare keiner
bekannten Art zuweisen kann.
In den äusseren Teilen unter der Oberhaut ist das Gewebe des Schwammes sehr locker, aus
Gewebsbälkchen bestehend, die zum grossen Teil dicht körnig sind und an denen in grösser Menge
runde Pigmentzellen liegen, die etwa 12 p im Durchmesser haben und ziemlich grosse, braune, runde
Pigmentkörner enthalten. Im Inneren zwischen den dicht zusammengepackten, etwa 22 p grossen
Geisselkammern sind die Pigmentzellen seltener, wenigstens im eigentlichen Körper, in den Fortsätzen
finden sie sich auch dort in Menge. Das Gewebe ist im Ganzen höchst ähnlich mit dem von Petrosia-
Arten, wie z. B. der weiterhin beschriebenen Petrosia rava.
Das Skelet ist in dem rundlichen Körper in einem unregelmässigen Netzwerk ziemlich starker
Nadelzüge angeordnet, während in dem unteren Teile wie in den Fortsätzen die Züge sich zum Teil
deutlich in Längsrichtung anordnen, in der Regel von massenhaften Pigmentzellen begleitet, doch findet
sich ausserdem auch noch ein Netzwerk schwächerer Züge und einzelner Nadeln. Spongin sehe ich
kaum in diesen Längszügen, dagegen deutlich in dem Netzwerk, wo es zur Verbindung der Spicula dient.
Die Amphioxe, welche das Skelet zusammensetzen (Taf. 5 Fig. 11), haben ziemlich kurze
Spitzen und sie sind 300 p lang und 16 p dick.
Gattung Petrosia.
Die Gattung Petrosia ist durch mehrere Exemplare vertreten, welche zu vier Arten gehören
dürften, die durch ihren Habitus sehr verschieden sind, namentlich dadurch, dass die eine grössere
Oscula vermissen lässt und eine andere eine reich verzweigte Masse vom Habitus der Chalinen darstellt.