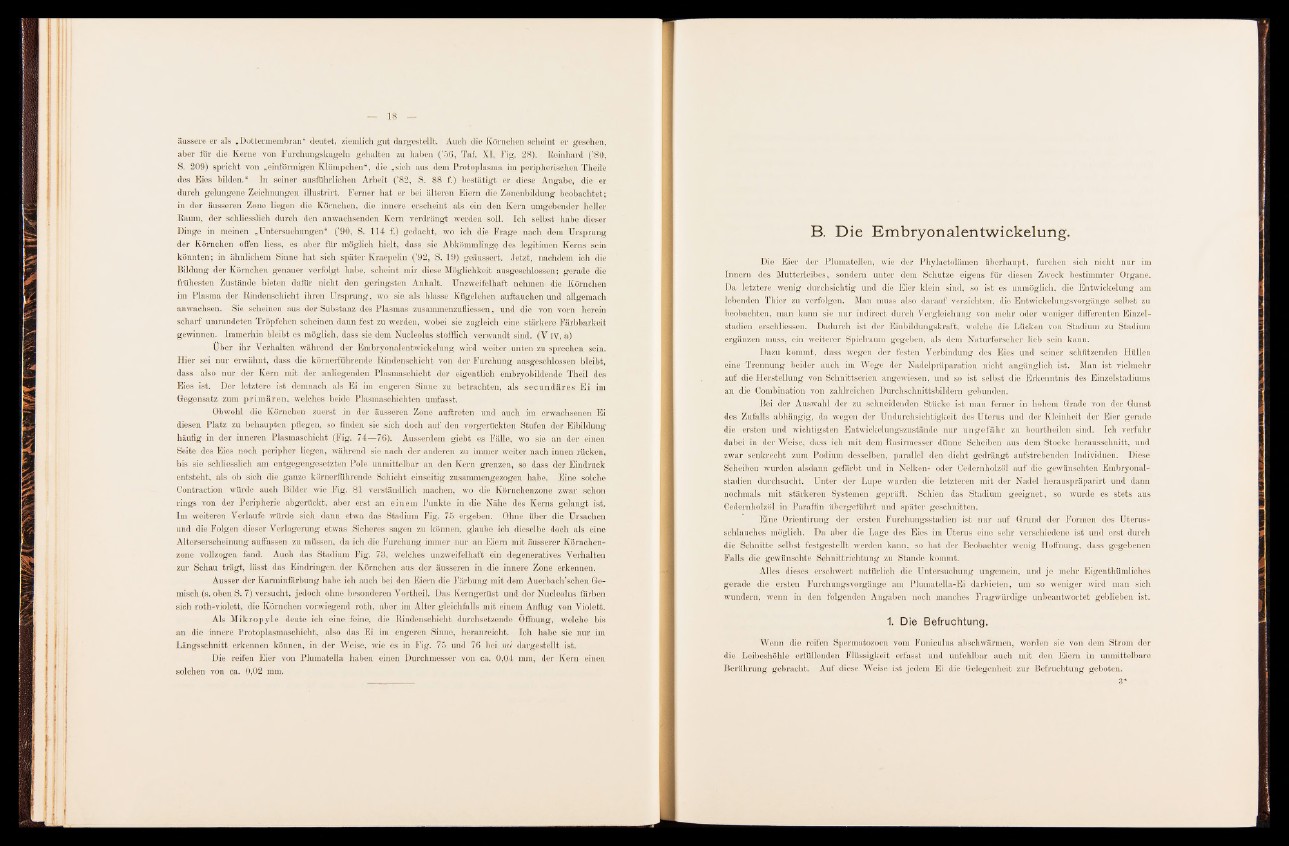
äussere er als „Dottermembran“ deutet, ziemlich gut dargestellt. Auch die Körnchen scheint er gesehen,
aber für die Kerne von Furchungskugeln gehalten zu haben (’56, Taf. XI, Fig. 28). Reinhard (’80,
S. 209) spricht von „einförmigen Klümpchen“, die „sich aus dem Protoplasma im peripherischen Theile
des Eies bilden.“ In seiner ausführlichen Arbeit (’82, S. 88 f.) bestätigt er diese Angabe, die er
durch gelungene Zeichnungen illustrirt. Ferner hat er bei älteren Eiern die Zonenbildung beobachtet;
in der äusseren Zone liegen die Körnchen, die innere erscheint als ein den Kern umgebender heller
Raum, der schliesslich durch den anwachsenden Kern verdrängt werden soll. Ich selbst habe dieser
Dinge in meinen „Untersuchungen“ (’90, S. 114 f.) gedacht, wo ich die Frage nach dem Ursprung
der Körnchen offen liess, es aber für möglich hielt, dass, sie Abkömmlinge des legitimen Kerns sein
könnten; in ähnlichem Sinne hat sich später Kraepelin (’92, S. 19) geäussert. Jetzt, nachdem ich die
Bildung der Körnchen genauer verfolgt habe, scheint mir diese Möglichkeit ausgeschlossen; gerade die
frühesten Zustände bieten dafür nicht den geringsten Anhalt. Unzweifelhaft nehmen die Körnchen
im Plasma der Rindenschicht ihren Ursprung, wo sie als blasse Kügelchen äuftauchen und allge mach
anwachsen. Sie scheinen aus der Substanz des Plasmas zusammenzufliessen, und die von vorn herein
scharf umrandeten Tröpfchen scheinen dann fest zu werden, wobei sie zugleich eine stärkere Färbbarkeit
gewinnen. Immerhin bleibt es möglich, dass sie dem Nucleolus stofflich verwandt sind. (V IV , ä)
Uber ihr Verhalten während der Embryonalentwickelung wird weiter unten zu sprechen sein.
Hier sei nur erwähnt, dass die körnerführende Rindenschicht von der Furchung ausgeschlossen bleibt,
dass also nur der Kern mit der anliegenden Plasmaschicht der eigentlich embryobildende Theil des
Eies ist. Der letztere ist demnach als Ei im engeren Sinne zu betrachten, als secundäres Ei im
Gegensatz zum primären, welches beide Plasmaschichten umfasst.
Obwohl die Körnchen zuerst in der äusseren Zone auftreten und auch im erwachsenen Ei
diesen Platz zu behaupten pflegen, so finden sie sich doch auf den vorgerückten Stufen der Eibildung
häufig in der inneren Plasmaschicht (Fig. 74—76). Ausserdem giebt es Fälle, wo sie an der einen
Seite des Eies noch peripher liegen, während sie nach der anderen zu immer weiter nach innen rücken,
bis sie schliesslich am entgegengesetzten Pole unmittelbar an den Kern grenzen, so dass der Eindruck
entsteht, als ob sich die ganze körnerführende Schicht einseitig zusammengezogen habe. Eine solche
Contraction würde auch Bilder wie Fig. 81 verständlich machen, wo die Körnchenzone zwar schon
rings von der Peripherie abgerückt, aber erst an einem Punkte in die Nähe des Kerns gelangt ist.
Im weiteren Verlaufe würde sich dann etwa das Stadium Fig. 75 ergeben. Ohne über die Ursachen
und die Folgen dieser Verlagerung etwas Sicheres sagen zu können, glaube ich dieselbe doch als eine
Alterserscheinung auffassen zu müssen, da ich die Furchung immer nur an Eiern mit äusserer Körnchenzone
vollzogen fand. Auch das Stadium Fig. 73, welches unzweifelhaft ein degeneratives Verhalten
zur Schau trägt, lässt das Eindringen der Körnchen aus der äusseren in die innere Zone erkennen.
Ausser der Karminfärbung habe ich auch bei den Eiern die Färbung mit dem Auerbach’schen Gemisch
(s. oben S. 7) versucht, jedoch ohne besonderen Vortheil. Das Kerngerüst und der Nucleolus färben
sich roth-violett, die Körnchen vorwiegend roth, aber im Alter gleichfalls mit einem Anflug von Violett.
Als Mikropyle deute ich eine feine, die Rindenschicht durchsetzende Öffnung, welche bis
an die innere Protoplasmaschicht, also das Ei im engeren Sinne, heranreicht. Ich habe sie nur im
Längsschnitt erkennen können, in der Weise, wie es in Fig. 75 und 76 bei mi dargestellt ist.
Die reifen Eier von Plumatella haben einen Durchmesser von ca. 0,04 mm, der Kern einen
solchen von ca. 0,02 mm.
B. Die Embryonalentwickelung.
Die Eier der Plumatellen, wie .der Phylactolämen überhaupt, furchen sich nicht nur im
Innern des Mutterleibes, sondern unter dem Schutze eigens für diesen Zweck bestimmter Organe.
Da letztere wenig durchsichtig und die Eier klein sind, so ist es unmöglich, die Entwickelung am
lebenden Thier zu verfolgen. Man muss also darauf verzichten, die Entwickelungsvorgänge selbst zu
beobachten, man kann sie nur indirect durch Vergleichung von mehr oder weniger differenten Einzelstadien
erschliessen. Dadurch ist der Einbildungskraft, welche die Lücken von Stadium zu Stadium
ergänzen muss, ein weiterer Spielraum gegeben, als dem Naturforscher lieb sein kann.
Dazu kommt, dass wegen der festen Verbindung des Eies und seiner schützenden Hüllen
eine Trennung beider auch im Wege der Nadelpräparation nicht angänglich ist. Man ist vielmehr
auf die Herstellung von Schnittserien angewiesen, und so ist selbst die Erkenntnis des Einzelstadiums
an die Combination von zahlreichen Durchschnittsbildern gebunden.
Bei der Auswahl der zu schneidenden Stücke ist man ferner in hohem Grade von der Gunst
des Zufalls abhängig, da wegen der Undurchsichtigkeit des Uterus und der Kleinheit der Eier gerade
die ersten und wichtigsten Entwickelungszustände nur un ge fäll r zu beurtheilen sind. Ich verfuhr
dabei in der Weise, dass ich mit dem Rasirmesser dünne Scheiben aus dem Stocke herausschnitt, und
zwar senkrecht zum Podium desselben, parallel den dicht gedrängt aufstrebenden Individuen. Diese
Scheiben wurden alsdann gefärt )t und in Nelken- oder Cedernholzöl auf die gewünschten Embryonalstadien
durchsucht. Unter der Lupe wurden die letzteren mit der Nadel herauspräparirt und dann
nochmals mit stärkeren Systemen geprüft. Schien das Stadium geeignet, so wurde es stets aus
Cedernholzöl in Paraffin übergeführt und später geschnitten.
Eine Orientirung der ersten Furchungsstadien ist nur auf Grund der Formen des Uterusschlauches
möglich. Da aber die Lage des Eies im Uterus eine sehr verschiedene ist und erst durch
die Schnitte selbst festgestellt werden kann, so hat der Beobachter wenig Hoffnung, dass gegebenen
Falls die gewünschte Schnittrichtung zu Stande kommt.
Alles dieses erschwert natürlich die Untersuchung ungemein, und je mehr Eigenthümliches
gerade die/ ersten Furchungsvorgänge am Plumatella-Ei darbieten, um so weniger wird man sich
wundern, wenn in den folgenden Angaben noch manches Fragwürdige unbeantwortet geblieben ist.
1. Die Befruchtung.
Wenn die reifen Spermatozoen vom Funiculus abschwärmen, werden sie von dem Strom der
die Leibeshöhle erfüllenden Flüssigkeit erfasst und unfehlbar auch mit den Eiern in unmittelbare
Berührung gebracht. Auf diese Weise ist jedem Ei die Gelegenheit zur Befruchtung geboten.
8*