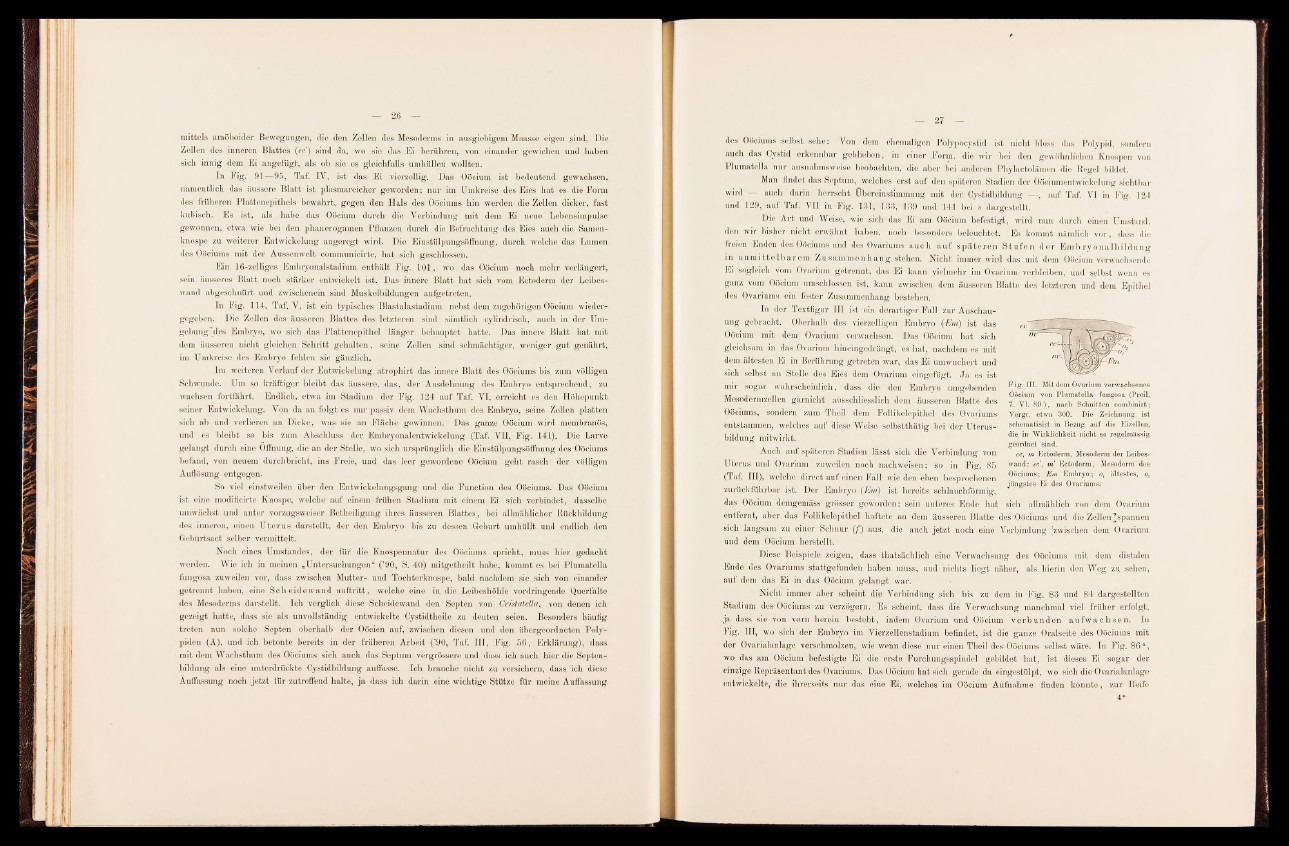
mittels amöboider Bewegungen, die den Zellen des Mesoderms in ausgiebigem Maasse eigen sind. Die
Zellen .des inneren Blattes (ec') sind da, wo sie das Ei berühren, von einander gewichen und haben
sich innig dem Ei angefügt, als ob sie es gleichfalls umhüllen wollten.
In Fig. 91—95, Taf. IV, ist das Ei vierzellig. Das Oöcium ist bedeutend gewachsen,
namentlich das äussere Blatt ist plasmareicher geworden; nur im Umkreise des Eies hat es die Form
des früheren Plattenepithels bewahrt, gegen den Hals des Oöciums hin werden die Zellen dicker, fast
kubisch. Es ist, als habe das Oöcium durch die Verbindung mit dem Ei neue Lebensimpulse
gewonnen, etwa wie bei den phanerogamen Pflanzen durch die Befruchtung des Eies auch die Samenknospe
zu weiterer Entwickelung angeregt wird. Die Einstülpungsöffnung, durch welche das Lumen
des Oöciums mit der Aussenwelt communicirte, hat sich geschlossen.
Ein 16-zelliges Embryonalstadium enthält Fig. 101, wo das Oöcium noch mehr verlängert,
sein äusseres Blatt noch stärker entwickelt ist. Das innere Blatt hat sich vom Ectoderm der Leibeswand
abgeschnürt und zwischenein sind Muskelbildungen aufgetreten.
In Fig. 114, Taf. V, ist ein typisches Blastul astadium nebst dem zugehörigen Oöcium wiedergegeben.
Die Zellen des äusseren Blattes des letzteren sind sämtlich cylindrisch, auch in der Umgebung
_des Embryo, wo sich das Plattenepithel länger behauptet hatte* Das innere Blatt hat mit
dem äusseren nicht gleichen Schritt gehalten, seine Zellen sind schmächtiger, weniger gut genährt,
im Umkreise des Embryo fehlen sie gänzlich.
Im weiteren Verlauf der Entwickelung atrophirt das innere Blatt des Oöciums bis. zum völligen
Schwunde. Um so kräftiger bleibt das äussere, das, der Ausdehnung des Embryo entsprechend, zu
wachsen fortfährt. Endlich, etwa im Stadium der Fig. 124 auf Taf. VI, erreicht es den Höhepunkt
seiner Entwickelung. Von da an folgt es nur passiv dem Wachsthum des Embryo, seine Zellen platten
sich ab und verlieren an Dicke, was sie an Fläche gewinnen. Das ganze Oöcium wird membranös,
und es bleibt so bis zum Abschluss der Embryonalentwickelung (Taf. VII, Fig. 141). Die Larve
gelangt durch eine Öffnung, die an der Stelle, wo sich ursprünglich die Einstülpungsöffhung des Oöciums
befand, von neuem durchblicht, ins Freie, und das leer gewordene Oöcium geht rasch der völligen
Auflösung entgegen.
So viel einstweilen über den Entwickelungsgang und die Function des Oöciums. Das Oöcium
ist eine modificirte Knospe, welche auf einem frühen Stadium mit einem Ei sich verbindet, dasselbe
umwächst und unter vorzugsweiser Betheiligung ihres äusseren Blattes, bei allmählicher Rückbildung
des inneren, einen Ute rus darstellt, der den Embryo bis zu dessen Geburt umhüllt und endlich den
Geburtsact selber vermittelt.
Noch eines Umstandes, der für die Knospennatur des Oöciums spricht, muss hier gedacht
werden. Wie ich in meinen „Untersuchungen“ (’90, S. 40) mi tgetheilt habe, kommt es bei Plumatella
fungosa zuweilen vor, dass zwischen Mutter- und Tochterknospe, bald nachdem sie sich von einander
getrennt haben, eine S ch e id ew an d auftritt, welche eine in die Leibeshöhle vordringende Querfalte
des Mesoderms darstellt. Ich verglich diese Scheidewand den Septen von Cristatella, von denen ich
gezeigt hatte, dass sie als unvollständig entwickelte Cystidtheile zu deuten seien. Besonders häufig
treten nun solche Septen oberhalb der Oöcien auf, zwischen diesen und den übergeordneten Poly-
piden (A), und ich betonte bereits in der früheren Arbeit (’90, Taf. III, Fig. 56, Erklärung), dass
mit dem Wachsthum des Oöciums sich auch das Septum vergrössere und dass ich auch hier die Septen-
bildung als eine unterdrückte Cystidbildung auffasse. Ich brauche nicht zu versichern, dass ich diese
Auffassung noch jetzt für zutreffend halte, ja dass ich darin eine wichtige Stütze für meine Auffassung
des Oöciums selbst sehe: Von dem ehemaligen Polypocystid ist nicht bloss das Polypid, sondern
auch das Cystid erkennbar geblieben, in einer Form, die wir bei den gewöhnlichen Knospen von
Plumatella nur ausnahmsweise beobachten, die aber bei anderen Phylactolämen die Regel bildet.
Man findet das Septum, welches erst auf den späteren Stadien der Oöciumentwickelung sichtbar
wifd — auch darin herrscht Übereinstimmung mit der Cystidbildung —, auf Taf. VI in Fig. 124
und 129, >auf Taf. VII in Fig. 131, 133, 139 und 141 bei .s dargestellt.
Die Art und Weise, wie sich das Ei am Oöcium befestigt, wird nun durch einen Umstand,
den wir bisher nicht erwähnt haben, noch besonders beleuchtet. Es kommt nämlich vor, dass die
freien Enden des Oöciums und des Ovariums auch a u f sp ä te r en S tu fe n der Em b r y o n a lb ild u n g
in u nm itte lb a r em Z u sammenhan g stehen. Nicht immer wird das mit dem Oöcium verwachsende
Ei sogleich vom Ovarium getrennt, das Ei kann vielmehr im Ovarium verbleiben, und selbst wenn es
ganz vom Oöcium umschlossen ist, kann zwischen dem äusseren Blatte des letzteren und dem Epithel
des Ovariums ein fester Zusammenhang bestehen.
In der Textfigur III ist ein derartiger Fall zur Anschau-
ung gebracht. Oberhalb des vierzelligen Embryo (Em) ist das
Oöcium mit dem Ovarium verwachsen. Das Oöcium hat sich
gleichsam in das Ovarium hineingedrängt, es hat, nachdem es mit
dem ältesten Ei in Berührung getreten war, das Ei umwuchert und
sich selbst an Stelle des Eies dem Ovarium eingefügt. Ja es ist
mir sogar wahrscheinlich, dass die den Embryo umgebenden
Mesodermzellen garnicht ausschliesslich dem äusseren Blatte des
Oöciums, sondern zum Theil dem Follikelepithel des Ovariums
entstammen, welches auf diese Weise selbstthätig bei der Uterusbildung
mitwirkt.
Auch auf späteren Stadien lässt sich die Verbindung von
Oöcium von Plumatella fungosa (Preil,
7. VI. 89.), nach Schnitten combinirt;
Vergv. etwa 300. Die Zeichnung ist
schematisirt in Bezug auf die Eizellen,
die in Wirklichkeit nicht so regelmässig
geordnet sind.
ec, m Ectoderm, Mesoderm der Leibeswand;
Uterus und Ovarium zuweilen noch nachweisen; so in Fig. 85
(Taf. III), welche direct auf einen Fall wie den eben besprochenen
zurückführbar ist. Der Embryo (Em) ist bereits schlauchförmig,
das Oöcium demgemäss grösser geworden; sein unteres Ende hat sich allmählich von dem Ovarium
entfernt, aber das Follikelepithel haftete an dem äusseren Blatte des Oöciums und die Zellen'*spannen
sich langsam zu einer Schnur (f) aus, die auch jetzt noch eine Verbindung 'zwischen dem Ovarium
und dem Oöcium herstellt.
ec', ' m Ectoderm, Mesoderm des
Oöciums; Em Embryo; o, ältestes, o3
jüngstes Ei des Ovariums.
Diese Beispiele zeigen, dass thatsächlich eine Verwachsung des Oöciums mit dem distalen
Ende des Ovariums stattgefunden haben muss, und nichts liegt näher, als hierin den Weg zu sehen,
auf dem das Ei in das Oöcium gelangt war.
Nicht immer aber scheint die Verbindung sich bis zu dem in Fig. 83 und 84 dargestellten
Stadium des Oöciums zu verzögern. Es scheint, dass die Verwachsung manchmal viel früher erfolgt,
ja dass sie von vorn herein besteht, indem Ovarium und Oöcium v erb und en a u fw a c h s e n . In
Fig. III, wo sich der Embryo im Vierzellenstadium befindet, ist die ganze Oralseite des Oöciums mit
der Ovarialanlage verschmolzen, wie wenn diese nur einen Theil des Oöciums selbst wäre. In Fig. 86a,
wo das am Oöcium befestigte Ei die erste Furchungsspindel gebildet hat, ist dieses Ei sogar der
einzige Repräsentant des Ovariums. Das Oöcium hat sich gerade da eingestülpt, wo sich die Ovarialanlage
entwickelte, die ihrerseits nur das eine Ei, welches im Oöcium Aufnahme finden konnte, zur Reife
4*