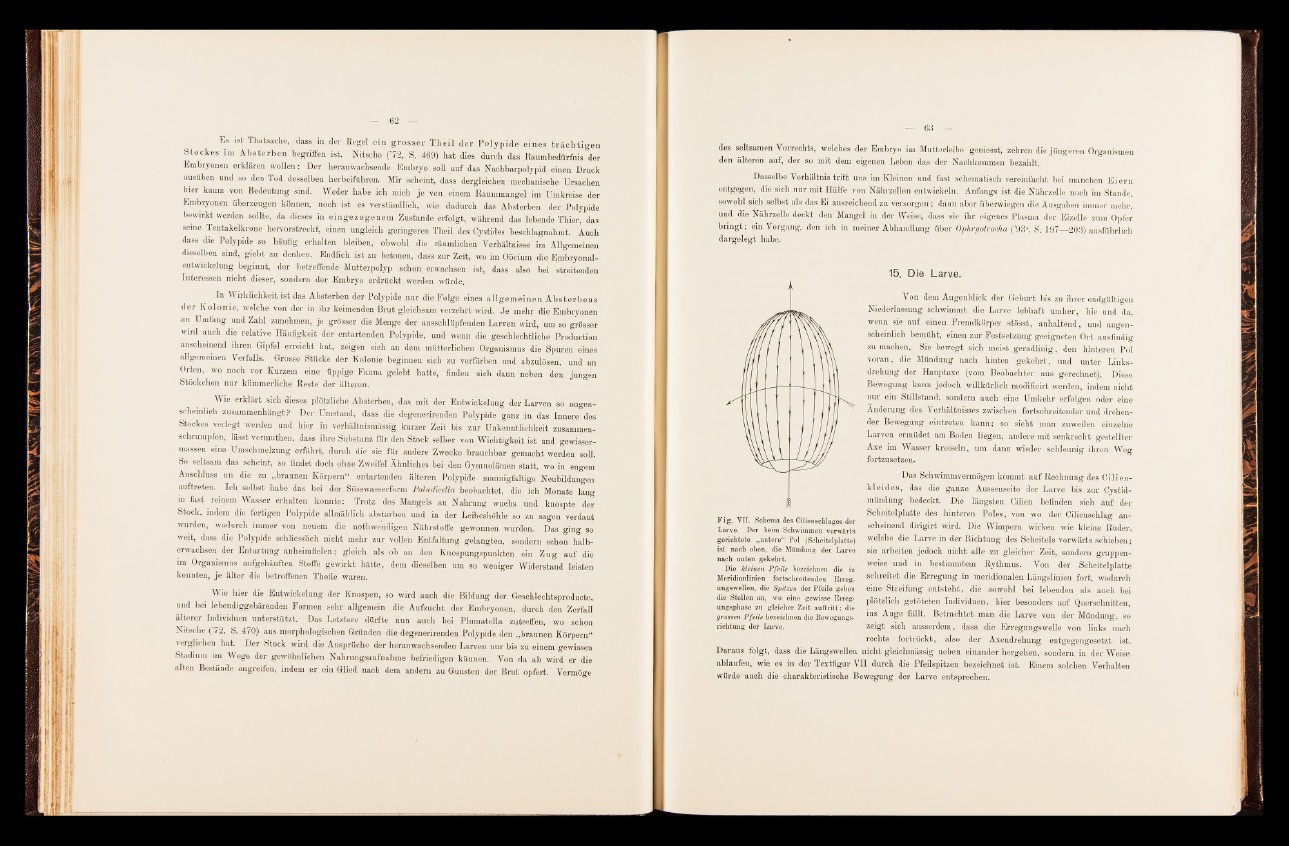
Es ist Thatsache, dass in der Regel ein g rösser T h e il der P o lyp id e -e in e s trä ch tig en
Stock es im Absterben begriffen ist. Nitsche (’72, S. 469) hat dies durch das Raumbedürfnis der
Embryonen erklären wollen: Der heranwachsende Embryo soll auf das Nachbarpolypid einen Druck
ausüben und so den Tod desselben berbeiführen. Mir scheint, dass dergleichen mechanische Ursachen
hier kaum von Bedeutung sind. Weder habe ich mich je von einem Raummangel im Umkreise der
Embryonen überzeugen können, noch ist es verständlich, wie dadurch das Absterben der Polypide
bewirkt werden sollte, da dieses in eingezogen em Zustande erfolgt, während das lebende Thier, das
seine Tentakelkrone hervorstreckt, einen ungleich geringeren Theil des Cystides beschlagnahmt. Auch
dass die Polypide so häufig erhalten bleiben, obwohl die räumlichen Verhältnisse im Allgemeinen
dieselben sind, giebt zu denken. Endlich ist zu betonen, dass zur Zeit, wo im Oöcium die Embryonalentwickelung
beginnt, der betreffende Mutterpolyp schon erwachsen ist,' dass also bei streitenden
Interessen nicht dieser, sondern der Embryo erdrückt werden würde.
In Wirklichkeit ist das Absterben der Polypide nur die Folge eines allgemeinen Absterbens
der Kolonie, welche von der in ihr keimenden Brut gleichsam verzehrt wird. Je mehr die Embryonen
an Umfang und Zahl zunehmen, je grösser die Menge der ausschlüpfenden Larven wird, um so grösser
wird auch die relative Häufigkeit der entartenden Polypide, und wenn die geschlechtliche Production
anscheinend ihren Gipfel erreicht hat, zeigen sich an dem mütterlichen Organismus die Spuren eines
allgemeinen Verfalls. Grosse Stücke der Kolonie beginnen sich zu verfärben und abzulösen, und an
Orten, wo noch vor Kurzem eine üppige Fauna gelebt hatte, finden sich dann neben den jungbn
Stöckchen nur kümmerliche Reste der älteren.
Wie erklärt sich dieses plötzliche Absterben, das mit der Entwickelung der Larven g l augenscheinlich
zusammenhängt? Der-Ümstand, dass die degenerirenden Polypide ganz in das Innere des'
Stockes verlegt werden lind hier in verhältnismässig kurzer Zeit bis zur ^Unkenntlichkeit .zusammen-
schrumpfen, lässt vermutheil, dass ihre Substanz für den Stock selber von Wichtigkeit ist und gewisser-
massen eine Umschmelzung erfährt, durch die sie für andere Zwecke brauchbar gemacht werden soll.
So seltsam das scheint, so findet doch ohne Zweifel Ähnliches bei den Gymnolämen statt, wo in engem _
Anschluss an die zu „braunen Körpern“ entartenden älteren Polypide mannigfaltige Neubildungen
auftreten. Ich selbst habe das bei der Süsswasserform Paludicclla beobachtet, die ich Monate lang
in fast reinem Wasser erhalten konnte: Trotz des Mangels an Nahrung wuchs und knospte der
Stock, indem die fertigen Polypide allmählich abstarben und in der Leibeshöhle so zu sagen verdaut
wurden, 'wodurch immer von neuem die nothweiidigen Nährstoffe gewonnen wurden. Das ging so
weit, dass die Polypide schliesslich nicht mehr zur vollen Entfaltung gelangten, sondern schon halberwachsen
der Entartung anheimfielen; gleich als ob an den Knospungspunkten ein Zug auf die
im Organismus aufgehäuften Stoffe gewirkt hätte, dem dieselben um so weniger Widerstand leisten
konnten, je älter die betroffenen Theile waren.
Wie hier die Entwickelung der Knospen, so wird auch die Bildung der Geschlechtsproducte,
und bei lebendiggebärenden Formen sehr allgemein die Aufzucht der Embryonen, durch den Zerfall
älterer Individuen unterstützt. Das Letztere dürfte nun auch bei Plumatella zutreffen, wo schon
Nitsche (’72, S. 470) aus morphologischen Gründen die degenerirenden Polypide den „braunen Körpern“
verglichen hat. Der Stock wird die Ansprüche der heranwachsenden Larven nur bis zu einem gewissen
Stadium im Wege der gewöhnlichen Nahrungsaufnahme befriedigen können. Von da ab wird er die
alten Bestände angreifen, indem er ein Glied nach dem ändern zu Gunsten der Brut opfert. Vermöge
des seltsamen Vorrechts, welches der Embryo im Mutterleibe geniesst, zehren die jüngeren Organismen
den älteren auf, der so mit dem eigenen Leben das der Nachkommen bezahlt.
Dasselbe Verhältnis tritt uns im Kleinen und fast schematisch vereinfacht bei manchen Eiern
entgegen, die sich nur mit Hülfe von Nährzellen entwickeln. Anfangs ist die Nährzelle noch im Stande,
sowohl sich selbst als das Ei ausreichend zu versorgen; dann aber überwiegen die Ausgaben immer mehr
und die Nährzelle deckt den Mangel in der Weise, dass sie ihr eigenes Plasma der Eizelle zum Opfer
bringt; ein Vorgang, den ich in meiner Abhandlung über Ophryotrocha ('93a, S. 197—203) ausführlich
dargelegt habe.
15. Die Larve.
Von dem Augenblick der Geburt bis zu ihrer endgültigen
Niederlassung schwimmt die Larve lebhaft umher,- hie und da,
wenn sie auf einen Fremdkörper stösst, anhaltend, und augenscheinlich
bemüht, einen zur Festsetzung geeigneten Ort ausfindig
zu machen. Sie bewegt sich meist geradlinig, den hinteren Pol
voran, die Mündung nach hinten gekehrt, und unter Linksdrehung
der Hauptaxe (vom Beobachter aus gerechnet). Diese
Bewegung kann jedoch willkürlich modificirt werden, indem nicht
nur ein Stillstand, sondern auch eine Umkehr erfolgen oder eine
Änderung des Verhältnisses zwischen fortschreitender und drehender
Bewegung eintreten kann; so sieht man zuweilen einzelne
Larven ermüdet am Boden liegen, andere mit senkrecht gestellter
Axe im Wasser kreiseln, um dann wieder schleunig ihren Weg
fortzusetzen.
Das Schwimmvermögen kommt auf Rechnung des Ci lienk
le id es, das die ganze Aussenseite der Larve bis zur Cystid-
mündung bedeckt. Die längsten Cilien befinden sich auf der
Scheitelplatte des hinteren Poles, von wo der Cilienschlag anscheinend
dirigirt wird. Die Wimpern wirken wie kleine Ruder,
welche die Larve in der Richtung des Scheitels vorwärts schieben;
sie arbeiten jedoch nicht alle zu gleicher Zeit, sondern gruppenweise
und in bestimmtem Rythmus. Von der Scheitelplatte
schreitet die Erregung in meridionalen Längslinien fort, wodurch
eine Streifung entsteht, die sowohl bei lebenden als auch bei
plötzlich getöteten Individuen, hier besonders auf Querschnitten,
ins Auge fällt. Betrachtet man die Larve von der Mündung, so
zeigt sich ausserdem, dass die Erregungswelle von links nach
rechts fortrückt, also der Axendrehung entgegengesetzt ist.
F ig . VIT. Schema des Cilienschlages der
Larve. Der beim Schwimmen vorwärts
gerichtete „untere“ Pol (Scheitelplatte)
ist nach oben, die Mündung der Larve
nach unten gekehrt.
Die kleinen Pfeile bezeichnen die in
Meridianlinien fortschreitenden Erregungswellen,
die Spitzen der Pfeile geben
die Stellen an, wo eine gewisse Erregungsphase
zu gleicher Zeit auftritt; die
grossen Pfeile bezeichnen die Bewegungsrichtung
der Larve.
Daraus folgt, dass die Längswellen nicht gleichmässig neben einander hergehen, sondern in der Weise
ablaufen, wie es in der Textfigur VII durch die Pfeilspitzen bezeichnet ist. Einem solchen Verhalten
würde auch die charakteristische Bewegung der Larve entsprechen.