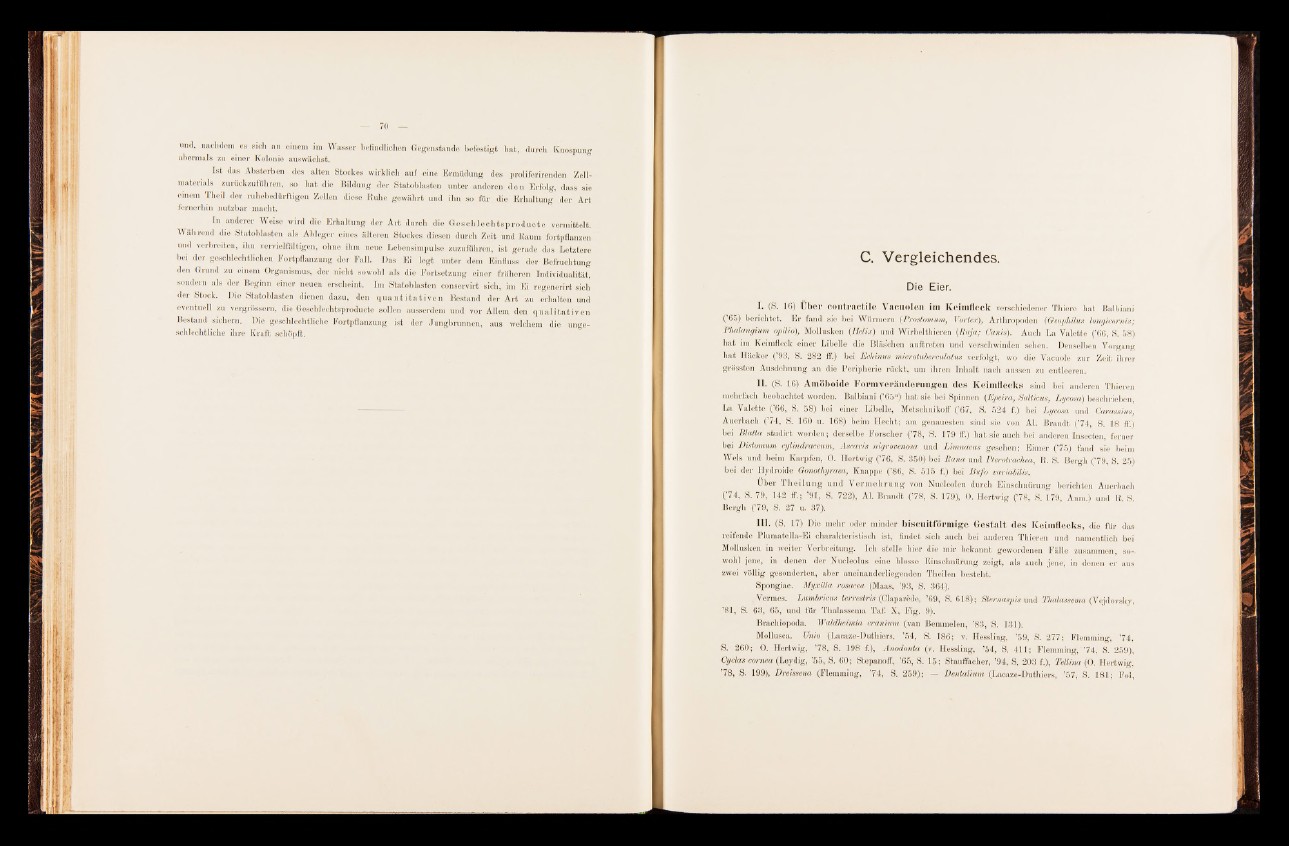
und, nachdem es sich an einem im Wasser befindlichen Gegenstände befestigt hat, durch Knospung
abermals zu einer Kolonie auswächst.
Ist das Absterben des alten Stockes wirklich auf eine Ermüdung des proliferirenden Zellmaterials
zurückzuführen, so hat die Bildung der Statoblasten unter anderen den Erfolg, dass sie
einem Theil der ruhebedürftigen Zellen diese Ruhe gewährt und ihn so für die Erhaltung der Art
fernerhin nutzbar macht.
In anderer Weise wird die Erhaltung der Art durch die Gesehlechtsprodu cte vermittelt.
Während die Statoblasten als Ableger eines älteren Stockes diesen durch Zeit und Raum fortpflanzen
und verbreiten, ihn vervielfältigen, ohne ihm neue Lebensimpulse zuzuführen, ist gerade das Letztere
bei der geschlechtlichen Fortpflanzung der Fall. Das Ei legt unter dem Einfluss der Befruchtung
den Grund zu einem Organismus, der nicht sowohl als die Fortsetzung einer Micron Individualität,
sondern als der Beginn einer neuen erscheint. Im Statoblasten conservirt sich, im Ei regenerirt sich
der Stock. Die Statoblasten dienen dazu, den q u a n tita tiv e n Bestand der Art zu erhalten und
eventuell zu vergrössern, die Gesehlechtsproducte sollen ausserdem und vor Allem den q u a lita tiv en
Bestand sichern. Die geschlechtliche Fortpflanzung ist der Jungbrunnen, aus welchem die unge-
schlechtliche ihre Kraft schöpft.
C. Vergleichendes.
Die Eier.
I. (S. 16) Über contractile Vacuolen im Keimfleck verschiedener Thiere hat Balbiani
(’65) berichtet. Er fand sie bei Würmern (Prostomum, Vortex), Arthropoden (Geophüus longicornis;
Phahngiwm opilio), Mollusken (Helix) und Wirbelthieren (Raja; Canis). Auch La Valette ('66, S. 58)
hat im Keimfleck einer Libelle die Bläs’chen auftreten und verschwinden sehen. Denselben Vorgang
hat Häcker (’93, S. 282 ff.) bei Echinus microtuberculatus verfolgt, wo die Vacuole zur Zeit ihrer
grössten Ausdehnung an die Peripherie rückt, um ihren Inhalt nach aussen zu entleeren.
II. (S. 16) Amöboide Formveränderungen des Keimflecks sind bei anderen Thieren
mehrfach beobachtet worden. Balbiani (’65“) hat sie bei Spinnen (Epeira, Satticus, Lycosa) beschrieben
La Valette (’66, S. 58) bei einer Libelle, Metschnikoff (’67, S. 524 f.) bei Lycosa und Carassius,
Auerbach (’74, S. 160 u. 168) beim Hecht; am genauesten sind sie von Al. Brandt (’74, S. 18 ff.)
bei Blatta studirt worden; derselbe Forscher (’78, S. 179 ff.) hat sie auch bei anderen Insecten, ferner
bei Distomum cylindraceum, Ascaris niyrovenosa und Limnaeus gesehen; Eimer f 75) fand sie beim
Wels und beim Karpfen, 0. Hertwig (’76, S. 350) bei Barn und Pterotrachea, R. S. Bergh (’79, S. 25)
bei der Bydroide Gonothyraea, Knappe (’86, S. 515 f.) bei Bufo variabilis.
Über Theilun g und Vermehrung von Nucleolen durch Einschnürung berichten Auerbach
(’74, S. 79, 142 ff.; ’91, S. 722), Al. Brandt (’78, S. 179), 0. Hertwig (’78, S. 179, Anm.) und R. S.
Bergh (’79, S. 27 u. 37).
III. (S. 17) Die mehr oder minder biseuitförmige Gestalt des Keimflecks, die für das
reifende Plumatella-Ei charakteristisch ist, findet sich auch bei anderen Thieren und namentlich bei
Mollusken in weiter Verbreitung. Ich stelle hier die mir bekannt gewordenen Fälle zusammen, sowohl
jene, in denen der Nucleolus eine blosse Einschnürung zeigt, als auch jene, in denen er aus
zwei völlig gesonderten, aber aneinanderliegenden Theilen besteht.
Spongiae. MyxiUa rosacea (Maas, ’93, S. 364).
Vermes. Lumbricus terrestris (ClaparMe, '69, S. 618); Stermspis und Thalassema (Vejdovsky,
’81, S. 63, 65, und für Thalassema Taf. X, Fig. 9).
Brachiopoda. Wcddheimia cranium (van Bemmelen, ’83, S. 131).
Mollusca. Unio (Lacaze-Duthiers, ’54, S. 186; v. Hessling, ’59, S. 277} Flemming, ’74,
S. 260; 0. Hertwig, ’78, S. 198 f.), Anodonta (v. Hessling, ’54, S. 411; Flemming,"’74, S. 259),
Oyclas cornea (Leydig, '55, S. 60; Stepanoff, '65, S. 15; Stauffacher, ’94, S. 203 f.), Tettina (0. Hertwig,
’78, S. 199), Dreissem (Flemming, ’74, S. 259); — Dentalium (Lacaze-Duthiers, ’57, S. 181; Fol,