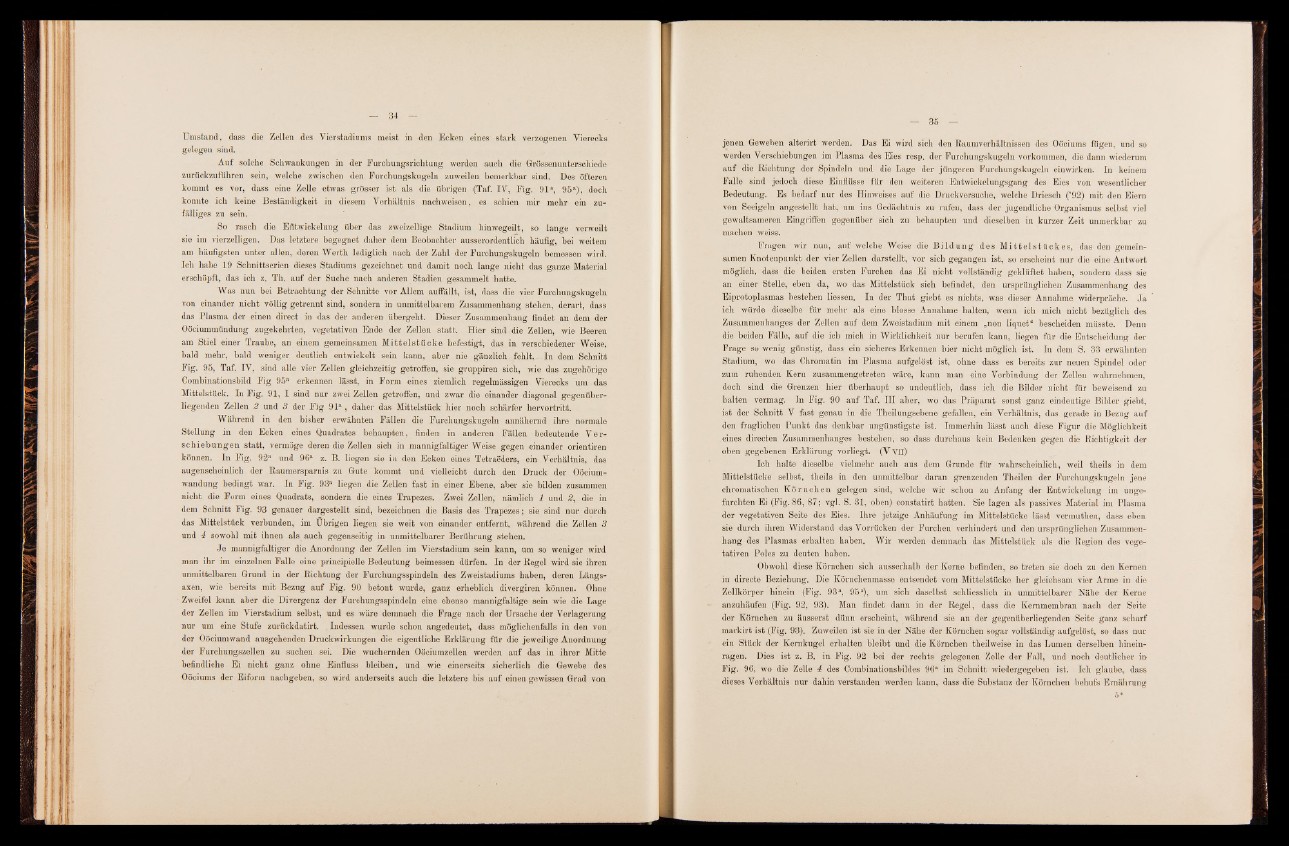
Umstand, dass die Zellen des Vierstadiums meist in den Ecken eines stark verzogenen Vierecks
gelegen sind.
Auf solche Schwankungen in der Furchungsrichtung werden auch die Grössenunterschiede
zurückzuführen sein, welche zwischen den Furchungskugeln zuweilen bemerkbar sind. Des öfteren
kommt es vor, dass eine Zelle etwas grösser ist als die übrigen (Taf. IV, Fig. 91a, 95a), doch
konnte ich keine Beständigkeit in diesem Verhältnis nachweisen, es schien mir mehr ein zufälliges
zu sein.
So rasch die Entwickelung über das zweizeilige Stadium hinwegeilt, so lange verweilt
sie im vierzeiligen. Das letztere begegnet daher dem Beobachter ausserordentlich häufig, bei weitem
am häufigsten unter allen, deren Werth lediglich nach der Zahl der Furchungskugeln bemessen wird.
Ich habe 19 Schnittserien dieses Stadiums gezeichnet und damit noch lange nicht das ganze Material
erschöpft, das ich z. Th. auf der Suche nach anderen Stadien gesammelt hatte.
Was nun bei Betrachtung der Schnitte vor Allem auffällt, ist, dass die vier Furchungskugeln
von einander nicht völlig getrennt sind, sondern in unmittelbarem Zusammenhang stehen, derart, dass
das Plasma der einen direct in das der anderen übergeht. Dieser Zusammenhang findet an dem der
Oöciummündung zugekehrten, vegetativen Ende der Zellen statt. Hier sind die Zellen, wie Beeren
am Stiel einer Traube, an einem gemeinsamen M itte ls tü c k e befestigt, das in verschiedener Weise,
bald mehr, bald weniger deutlich entwickelt sein kann, aber nie gänzlich fehlt.^ In dem Schnitt
Fig. 95, Taf. IV, sind alle vier Zellen gleichzeitig getroffen, sie gruppiren sich, wie das zugehörige
Combinationsbild Fig 95a erkennen lässt, in Form eines ziemlich regelmässigen Vierecks um das
Mittelstück. In Fig. 91, I sind nur zwei Zellen getroffen, und zwar die einander diagonal gegenüberliegenden
Zellen 2 und 3 der Fig 91a , daher das Mittelstück hier noch schärfer hervortritt.
Während in den bisher erwähnten Fällen die Furchungskugeln annähernd ihre normale
Stellung in den Ecken eines Quadrates behaupten, finden in anderen Fällen bedeutende V e r sch
ieb u n g en statt, vermöge deren die Zellen sich in mannigfaltiger Weise gegen einander orientiren
können. In Fig. 92a und 96a z. B. liegen sie in den Ecken eines Tetraeders, ein Verhältnis, das
augenscheinlich der Raumersparnis zu Gute kommt und vielleicht durch den Druck der Oöcium-
wandung bedingt war. In Fig. 93a liegen die Zellen fast in einer Ebene, aber sie bilden zusammen
nicht die Form eines Quadrats, sondern die eines Trapezes. Zwei Zellen, nämlich 1 und 2, die in
dem Schnitt Fig. 93 genauer dargestellt sind, bezeichnen die Basis des Trapezes; sie sind nur durch
das Mittelstück verbunden, im Übrigen liegen sie weit von einander entfernt, während die Zellen 3
und 4 sowohl mit ihnen als auch gegenseitig in unmittelbarer Berührung stehen.
Je mannigfaltiger die Anordnung der Zellen im Vierstadium sein kann, um so weniger wird
man ihr im einzelnen Falle eine principielle Bedeutung beimessen dürfen. In der Regel wird sie ihren
unmittelbaren Grund in der Richtung der Furchungsspindeln des Zweistadiums haben, deren Längs-
axen, wie bereits mit Bezug auf Fig. 90 betont wurde, ganz erheblich divergiren können. Ohne
Zweifel kann aber die Divergenz der Furchungsspindeln eine ebenso mannigfaltige sein wie die Lage
der Zellen im Vierstadium selbst, und es wäre demnach die Frage nach der Ursache der Verlagerung
nur um eine Stufe zuriickdatirt. Indessen wurde schon angedeutet, dass möglichenfalls in den von
der Oöciumwand ausgehenden Druckwirkungen die eigentliche Erklärung für die jeweilige Anordnung
der Furchungszellen zu suchen sei. Die wuchernden Oöciumzellen werden auf das in ihrer Mitte
befindliche Ei nicht ganz ohne Einfluss bleiben, und wie einerseits sicherlich die Gewebe des
Oöciums der Eiform nachgeben, so wird anderseits auch die letztere bis auf einen gewissen Grad von
jenen Geweben alterirt werden. Das Ei wird sich den Raumverhältnissen des Oöciums fügen, und so
werden Verschiebungen im Plasma des Eies resp. der Furchungskugeln Vorkommen, die dann wiederum
auf die Richtung der Spindeln und die Lage der jüngeren Furchungskugeln einwirken. In keinem
Falle sind jedoch diese Einflüsse für den weiteren Entwickelungsgang des Eies von wesentlicher
Bedeutung. Es bedarf nur des Hinweises auf die Druckversuche, welche Driesch (’92) mit den Eiern
von Seeigeln angestellt hat, um ins Gedächtnis zu rufen, dass der jugendliche Organismus selbst viel
gewaltsameren Eingriffen gegenüber sich zu behaupten und dieselben in kurzer Zeit unmerkbar zu
machen weiss.
Fragen wir nun, auf welche Weise die B ild u n g des M it t e ls tü c k e s , das den gemeinsamen
Knotenpunkt der vier Zellen darstellt, vor sich gegangen ist, so erscheint nur die eine Antwort
möglich, dass die beiden ersten Furchen das Ei nicht vollständig geklüftet haben, sondern dass sie
an einer Stelle, eben da, wo das Mittelstück sich befindet, den ursprünglichen Zusammenhang des
Eiprotoplasmas bestehen liessen. In der That giebt es nichts, was dieser Annahme widerpräche. Ja
ich würde dieselbe für mehr als eine blosse Annahme halten, wenn ich mich nicht bezüglich des
Zusammenhanges der Zellen auf dem Zweistadium mit einem „non liquet“ bescheiden müsste. Denn
die beiden Fälle, auf die ich mich in Wirklichkeit nur berufen kann, liegen für die Entscheidung der
Frage so wenig günstig, dass ein sicheres Erkennen hier nicht möglich ist. In dem S. 33 erwähnten
Stadium, wo das Chromatin im Plasma aufgelöst ist, ohne dass es bereits zur neuen Spindel oder
zum ruhenden Kern zusammengetreten wäre, kann man eine Verbindung der Zellen wahrnehmen,
doch sind die Grenzen hier überhaupt so undeutlich, dass ich die Bilder nicht für beweisend zu
halten vermag. In Fig. 90 auf Taf. III aber, wo das Präparat sonst ganz eindeutige Bilder giebt,
ist der Schnitt V fast genau in die Theilungsebene gefallen, ein Verhältnis, das gerade in Bezug auf
den fraglichen Punkt das denkbar ungünstigste ist. Immerhin lässt auch diese Figur die Möglichkeit
eines directen Zusammenhanges bestehen, so dass durchaus kein Bedenken gegen die Richtigkeit der
oben gegebenen Erklärung vorliegt. (V VIl)
Ich halte dieselbe vielmehr auch aus dem Grunde für wahrscheinlich, weil theils in dem
Mittelstücke selbst, theils in den unmittelbar daran grenzenden Theilen der Furchungskugeln jene
chromatischen Körnchen gelegen sind, welche wir schon zu Anfang der Entwickelung im ungefurchten
Ei (Fig. 86, 87; vgl. S. 31, oben) constatirt hatten. Sie lagen als passives Material im Plasma
der vegetativen Seite des Eies. Ihre jetzige Anhäufung im Mittelstücke lässt vermuthen, dass eben
sie durch ihren Widerstand das Vorrücken der Furchen verhindert und den ursprünglichen Zusammenhang
des Plasmas erhalten haben. Wir werden demnach das Mittelstück als die Region des vegetativen
Pol es zu deuten haben.
Obwohl diese Körnchen sich ausserhalb der Kerne befinden, so treten sie doch zu den Kernen
in directe Beziehung. Die Körnchenmasse entsendet vom Mittelstücke her gleichsam vier Arme in die
Zellkörper hinein (Fig. 93a, 95a), um sich daselbst schliesslich in unmittelbarer Nähe der Kerne
anzuhäufen (Fig. 92, 93). Man findet dann in der Regel, dass die Kernmembran nach der Seite
der Körnchen zu äusserst dünn erscheint, während sie an der gegenüberliegenden Seite ganz scharf
markirt ist (Fig. 93). Zuweilen ist sie in der Nähe der Körnchen sogar vollständig aufgelöst, so dass nur
ein Stück der Kernkugel erhalten bleibt und die Körnchen theilweise in das Lumen derselben hineinragen.
Dies ist z. B. in Fig. 92 bei der rechts gelegenen Zelle der Fall, und noch deutlicher in
Fig. 96, wo die Zelle 4 des Combinationsbildes 96a im Schnitt wiedergegeben ist. Ich glaube, dass
dieses Verhältnis nur dahin verstanden werden kann, dass die Substanz der Körnchen behufs Ernährung