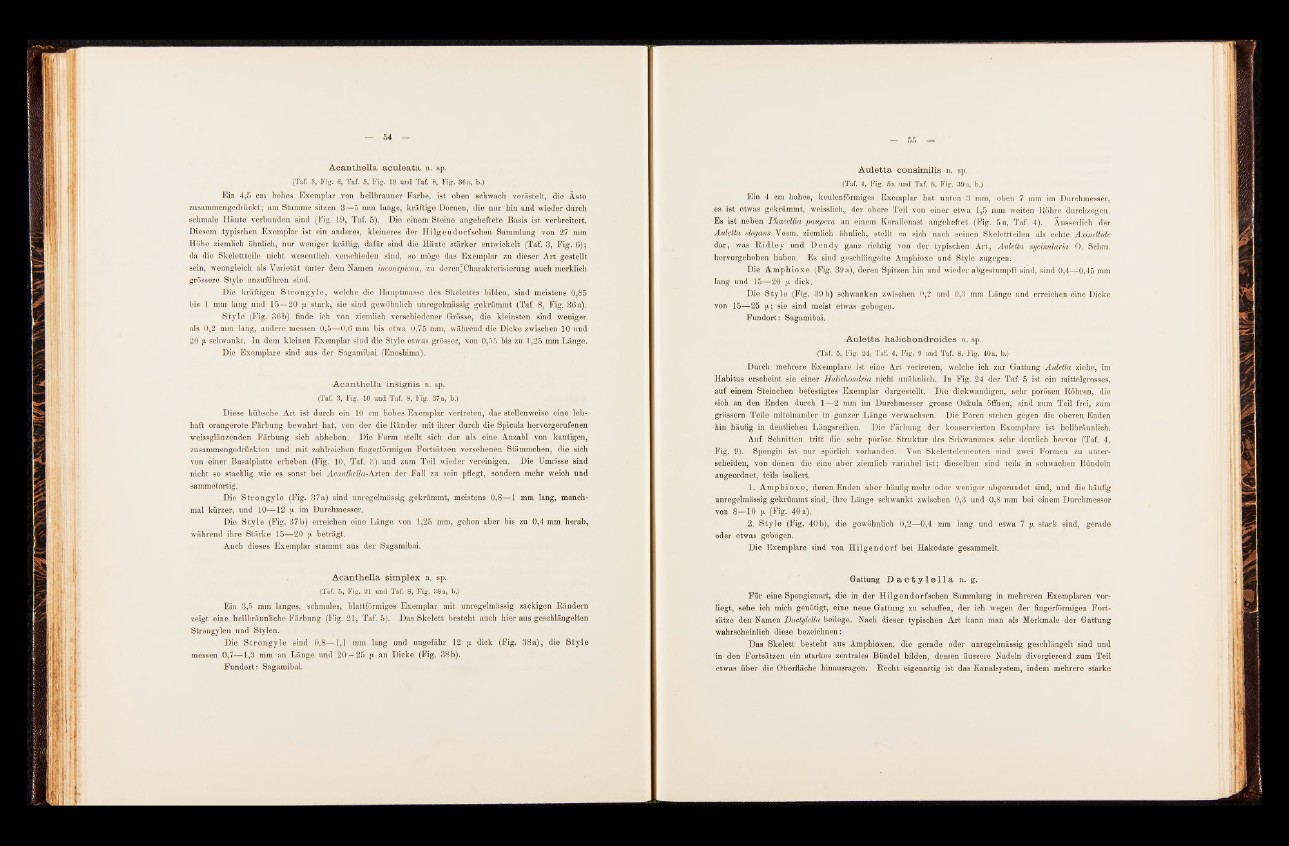
Acanthella aculeata n. sp.
(Taf. 3, Fig. 6, Taf. 5, Fig. 19 und Taf. 8, Fig. 86 a, b.)
Ein 4,5 cm hohes Exemplar von hellbrauner Farbe, ist oben schwach verästelt, die Äste
zusammengedrückt; am Stamme sitzen 3—5 mm lange, kräftige Dornen, die nur hin und wieder durch
schmale Häute verbunden sind (Fig. 19, Taf. 5). Die einem Steine angeheftete Basis ist verbreitert.
Diesem typischen Exemplar ist ein anderes, kleineres der Hilgendorfschen Sammlung von 27 mm
Höhe ziemlich ähnlich, nur weniger kräftig, dafür sind die Häute stärker entwickelt (Taf. 3, Fig. 6);
da die Skelettteile nicht wesentlich verschieden sind, so möge das Exemplar zu dieser Art gestellt
sein, wenngleich als Varietät unter dem Namen inconspicua, zu deren^Charakterisierung auch merklich
grössere Style anzuführen sind.
Die kräftigen Strongyle, welche die Hauptmasse des Skelettes bilden, sind meistens 0,85
bis 1 mm lang und 15 — 20 p stark, sie sind gewöhnlich unregelmässig gekrümmt (Taf. 8, Fig. 36 a).
Style (Fig. 36 b) finde ich von ziemlich verschiedener Grösse, die kleinsten sind weniger
als 0,2 mm lang, andere messen 0,5—0,6 mm bis etwa 0,75 mm, während die Dicke zwischen 10 und
20 p schwankt. In dem kleinen Exemplar sind die Style etwas grösser, von 0,55 bis zu 1,25 mm Länge.
Die Exemplare sind aus der Sagamibai (Enoshima).
Acanthella insignis n. sp.
(Taf. 3, Fig. 10 und Taf. 8, Fig. 37 a, b.)
Diese hübsche Art ist durch ein 10 cm hohes Exemplar vertreten, das stellenweise eine lebhaft
orangerote Färbung bewahrt hat, von der die Ränder mit ihrer durch die Spicula hervorgerufenen
weissglänzenden Färbung sich abheben. Die Form stellt sich dar als eine Anzahl von kantigen,
zusammengedrückten und mit zahlreichen fingerförmigen Fortsätzen versehenen Stämmchen, die sich
von einer Basalplatte erheben (Fig. 10, Taf. 3) und zum Teil wieder vereinigen. Die Umrisse sind
nicht so stachlig wie es sonst bei Acanthella-Arten der Fall zu sein pflegt, sondern mehr weich und
sammetartig.
Die Strongyle (Fig. 37a) sind unregelmässig gekrümmt, meistens 0,8—1 mm lang, manchmal
kürzer, und 10—12 p im Durchmesser.
Die Style (Fig. 37 b) erreichen eine Länge von 1,25 mm, gehen aber bis zu 0,4 mm herab,
während ihre Stärke 15—20 p beträgt.
Auch dieses Exemplar stammt aus der Sagamibai.
Acanthella simplex n. sp.
(Taf. 5, Fig. 21 und Taf. 8, Fig. 38 a, b.)
Ein 3,5 mm langes, schmales, blattförmiges Exemplar mit unregelmässig zackigen Rändern
zeigt eine hellbräunliche Färbung (Fig. 21, Taf. 5). Das Skelett besteht auch hier aus geschlängelten
Strongylen und Stylen.
Die Strongyle sind 0,8—1,1 mm lang und ungefähr 12 p dick (Fig. 38a), die Style
messen 0,7—1,3 mm an Länge und 20 — 25 p an Dicke (Fig. 38b).
Fundort: Sagamibai.
Auletta consimilis n. sp.
(Taf. 4, Fig. 5 a und Taf. 8, Fig. 39 a, b.)
Ein 4 cm hohes, keulenförmiges Exemplar hat unten 3 mm, oben 7 mm im Durchmesser,
es ist etwas gekrümmt, weisslich, der obere Teil von einer etwa 1,5 mm weiten Röhre durchzogen.
Es ist neben Phacellia paupera an einem Korallenast angeheftet (Fig. 5 a, Taf. 4). Äusserlich der
Auletta elegans Vosm. ziemlich ähnlich, stellt es sich nach seinen Skelettteilen als echte Axinettide
dar, was Ridley und Dendy ganz richtig von der typischen Art, Auletta sycinularia O. Schm,
hervorgehoben haben. Es sind geschlängelte Amphioxe und Style zugegen.
Die Amphioxe (Fig. 39a), deren Spitzen hin und wieder abgestumpft sind, sind 0,4—0,45 mm
lang und 15—20 p dick.
Die Style (Fig. 39 b) schwanken zwischen 0,2 und 0,3 mm Länge und erreichen eine Dicke
von 15—25 p; sie sind meist etwas gebogen.
Fundort: Sagamibai.
Auletta halichondroid.es n. sp.
(Taf. 5, Fig. 24, Taf. 4, Fig. 9 und Taf. 8, Fig. 40 a, b.)
Durch mehrere Exemplare ist eine Art vertreten, welche ich zur Gattung Auletta ziehe, im
Habitus erscheint sie einer Halichondria nicht unähnlich. In Fig. 24 der Taf. 5 ist ein mittelgrosses,
auf einem Steinchen befestigtes Exemplar dargestellt. Die dickwandigen, sehr porösen Röhren, die
sich an den Enden durch 1—2 mm im Durchmesser grosse Oskula öffnen, sind zum Teil frei, zum
grössern Teile miteinander in ganzer Länge verwachsen. Die Poren stehen gegen die oberen Enden
hin häufig in deutlichen Längsreihen. Die Färbung der konservierten Exemplare ist hellbräunlich.
Auf Schnitten tritt die sehr poröse Struktur des Schwammes sehr deutlich hervor (Taf. 4,
Fig. 9). Spongin ist nur spärlich vorhanden. Von Skelettelementen sind zwei Formen zu unterscheiden,
von denen die eine aber ziemlich variabel ist; dieselben sind teils in schwachen Bündeln
angeordnet, teils isoliert.
1. Amphioxe, deren Enden aber häufig mehr oder weniger abgerundet sind, und die häufig
unregelmässig gekrümmt sind, ihre Länge schwankt zwischen 0,3 und 0,8 mm bei einem Durchmesser
von 8—10 p (Fig. 40 a).
2. Style (Fig. 40b), die gewöhnlich 0,2—0,4 mm lang und etwa 7 p stark sind, gerade
oder etwas gebogen.
Die Exemplare sind von Hilgendorf bei Hakodate gesammelt.
Gattung D a c t y l e l l a n. g.
Für eine Spongienart, die in der Hilgendorfschen Sammlung in mehreren Exemplaren vorliegt,
sehe ich mich genötigt, eine neue Gattung zu schaffen, der ich wegen der fingerförmigen Fortsätze
den Namen Dactylella beilege. Nach dieser typischen Art kann man als Merkmale der Gattung
wahrscheinlich diese bezeichnen:
Das Skelett besteht aus Amphioxen, die gerade oder unregelmässig geschlängelt sind und
in den Fortsätzen ein starkes zentrales Bündel bilden, dessen äussere Nadeln divergierend zum Teil
etwas über die Oberfläche hinausragen. Recht eigenartig ist das Kanalsystem, indem mehrere starke