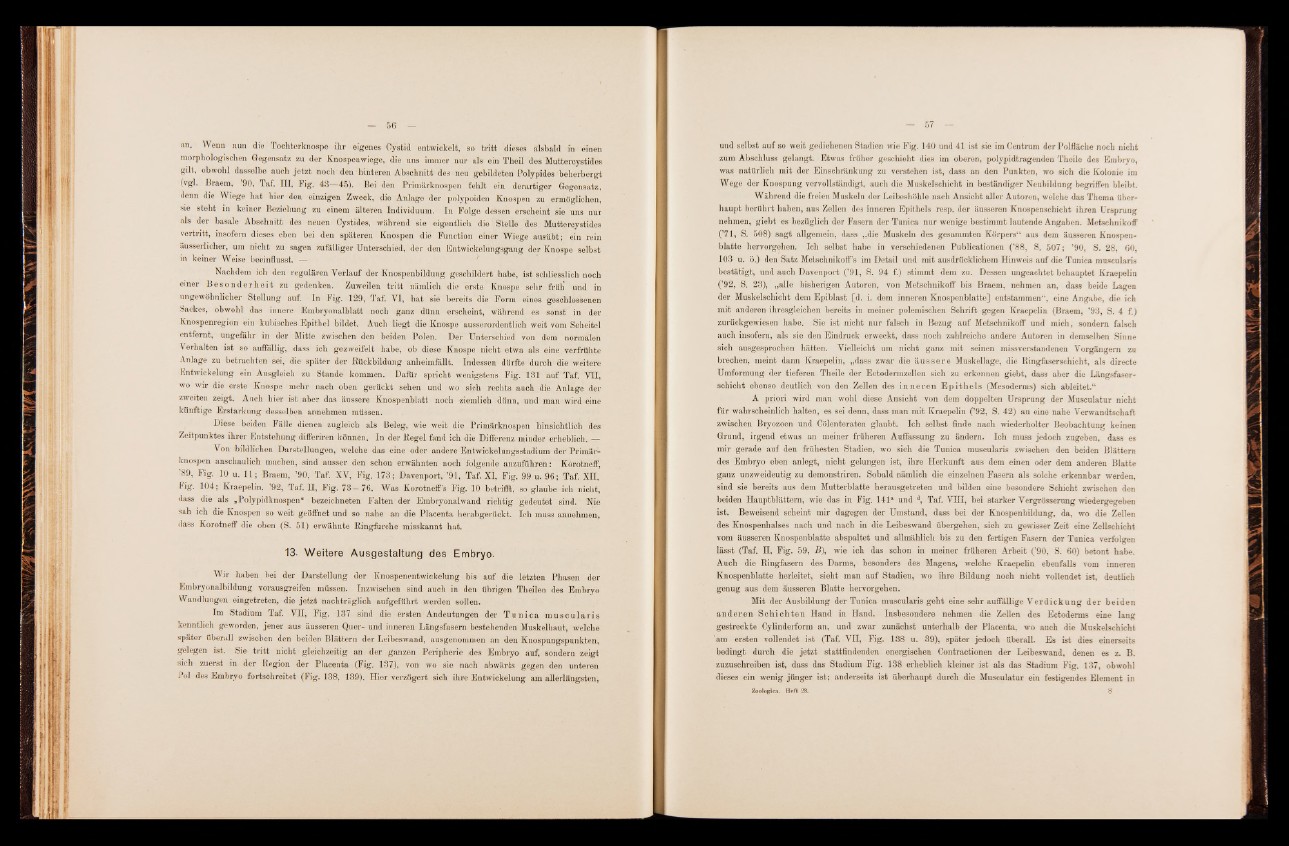
an. Wenn nun die Tochterknospe ihr eigenes Oystid entwickelt, so tritt dieses alsbald in einen
morphologischen Gegensatz zu der Knospenwiege, die uns immer nur als ein Theil des Muttercystides
gilt, obwohl dasselbe auch jetzt noch den hinteren Abschnitt des neu gebildeten Polypides beherbergt
(vgl. Braem, ’90, Taf. III, Fig. 43—45). Bei den Primärknospen fehlt ein derartiger Gegensatz,
denn die Wiege hat hier den einzigen Zweck, die Anlage der polypoiden Knospen zu ermöglichen,
sie steht in keiner Beziehung zu einem älteren Individuum. In Folge dessen erscheint sie uns nur
als der basale Abschnitt des neuen Cystides, während sie eigentlich die Stelle des Muttercystides
vertritt, insofern dieses eben bei den späteren Knospen die Function einer Wiege ausübt; ein rein
äusserlicher, um nicht zu sagen zufälliger Unterschied, der den Ent wickelongsgang der Knospe selbst
in keiner Weise beeinflusst. —
Nachdem ich den regulären Verlauf der Knospenbildung geschildert habe, ist schliesslich noch
einer B e s o n d e r h e it zu gedenken. Zuweilen tritt nämlich die erste Knospe sehr früh und in
ungewöhnlicher Stellung auf. In Fig. 129, Taf. VI, hat sie bereits die Form eines geschlossenen
Sackes, obwohl das innere Embryonalblatt noch ganz dünn erscheint, während es sonst in der
Knospenregion ein kubisches Epithel bildet. Auch liegt die Knospe ausserordentlich weit vom Scheitel
entfernt, ungefähr in der Mitte zwischen den beiden Polen. Der Unterschied von dem normalen
Verhalten ist so auffällig, dass ich gezvveifelt habe, ob diese Knospe nicht etwa als eine verfrühte
Anlage zu betrachten sei, die später der Rückbildung anheimfallt. Indessen dürfte durch die weitere
Entwickelung ein Ausgleich zu Stande kommen. Dafür spricht wenigstens Fig. 131 auf Taf. VII,
wo wir die erste Knospe mehr nach oben gerückt sehen und wo sich rechts auch die Anlage der
zweiten zeigt. Auch hier ist aber das äussere Knospenblatt noch ziemlich dünn, und man wird eine
künftige Erstarkung desselben annehmen müssen.
Diese beiden Fälle dienen zugleich als Beleg, wie weit die Primärknospen hinsichtlich des
Zeitpunktes ihrer Entstehung differiren können. In der Regel fand ich die Differenz minder erheblich. —
Von bildlichen Darstellungen, welche das eine oder andere Entwickelungsstadium der Primärknospen
anschaulich machen, sind ausser den schon erwähnten noch folgende anzuführen: Körotneff,
‘89, Fig. 10 u. 11; Braem, ’90, Taf. XV, Fig. 173; Davenport, ’91, Taf. XI, Fig. 99 u. 96; Taf. XII,
Fig. 104; Kraepelin, ’92, Taf. II, Fig. 73—76. Was Korotneff’s Fig. 10 betrifft, so glaube ich nicht,
dass die als „Polypidknospen “ bezeichneten Falten der Embryonalwand richtig gedeutet sind. Nie
sah ich die Knospen so weit geöffnet und so nahe an die Placenta herabgerückt. Ich muss annehmen,
dass Korotneff die oben (S. 51) erwähnte Ringfurche misskannt hat.
13. Weitere Ausgestaltung des Embryo.
Wir haben bei der Darstellung der Knospenentwickelung bis auf die letzten Phasen der
Embryonalbildung vorausgreifen müssen. Inzwischen sind auch in den übrigen Theiien des Embryo
Wandlungen eingetreten, die jetzt nachträglich aufgeführt werden sollen.
Im Stadium Taf. VII, Fig. 137 sind die ersten Andeutungen der T u n ic a m u s c u la r is
kenntlich geworden, jener aus äusseren Quer- und inneren Längsfasem bestehenden Muskelhaut, welche
später überall zwischen den beiden Blättern der Leibeswand, ausgenommen an den Knospungspunkten,
gelegen ist. Sie tritt nicht gleichzeitig an der ganzen Peripherie des Embryo auf, sondern zeigt
sich zuerst in der Region der Placenta (Fig. 137), von wo sie nach abwärts gegen den unteren
Pol des Embryo fortschreitet (Fig. 138, 139). Hier verzögert sich ihre Entwickelung am allerlängsten,
und selbst auf so weit gediehenen Stadien wie Fig. 140 und 41 ist sie im Centrum der Polfläche noch nicht
zum Abschluss gelangt. Etwas früher geschieht dies im oberen, polypidtragenden Theile des Embryo,
was natürlich mit der Einschränkung zu verstehen ist, dass an den Punkten, wo sich die Kolonie im
Wege der Knospung vervollständigt, auch die Muskelschicht in beständiger Neubildung begriffen bleibt.
Während die freien Muskeln der Leibeshöhle nach Ansicht aller Autoren, welche das Thema überhaupt
berührt haben, aus Zellen des inneren Epithels resp. der äusseren Knospenschicht ihren Ursprung
nehmen, giebt es bezüglich der Fasern der Tunica nur wenige bestimmt lautende Angaben. Metschnikoff
(’71, S. 508) sagt allgemein, dass „die Muskeln des gesammten Körpers“ aus dem äusseren Knospen-
blatte hervorgehen. Ich selbst habe in verschiedenen Publicationen (’88, 8. 507; ’90, S. 28, 60,
103 u. ö.) den Satz Metschnikoff1s im Detail und mit ausdrücklichem Hinweis auf die Tunica muscularis
bestätigt, und auch Davenport (’91, S. 94 f.) stimmt dem zu. Dessen ungeachtet behauptet Kraepelin
(’92, S. 23), „alle bisherigen Autoren, von Metschnikoff bis Braem, nehmen an, dass beide Lagen
der Muskelschicht dem Epiblast [d. i. dem inneren Knospenblatte] entstammen“, eine Angabe, die ich
mit anderen ihresgleichen bereits in meiner polemischen Schrift gegen Kraepelin (Braem, ’93, S. 4 f.)
zurückgewiesen habe. Sie ist nicht nur falsch in Bezug auf Metschnikoff und mich, sondern falsch
auch insofern, als sie den Eindruck erweckt, dass noch zahlreiche andere Autoren in demselben Sinne
sich ausgesprochen hätten. Vielleicht um nicht ganz mit seinen missverstandenen Vorgängern zu
brechen, meint dann Kraepelin, „dass zwar die ä u s se r e Muskellage, die Ringfaserschicht, als directe
Umformung der tieferen Theile der Ectodermzellen sich zu erkennen giebt, dass aber die Längsfaserschicht
ebenso deutlich von den Zellen des in n e r e n E p ith e ls (Mesoderms) sich ableitet.“
A priori wird man wohl diese Ansicht von dem doppelten Ursprung der Muscuiatur nicht
für wahrscheinlich halten, es sei denn, dass man mit Kraepelin (’92, S. 42) an eine nahe Verwandtschaft
zwischen Bryozoen und Cölenteraten glaubt. Ich selbst finde nach wiederholter Beobachtung keinen
Grund, irgend etwas an meiner früheren Auffassung zu ändern. Ich muss jedoch zugeben, dass es
mir gerade auf den frühesten Stadien, wo sich die Tunica muscularis zwischen den beiden Blättern
des Embryo eben anlegt, nicht gelungen ist, ihre Herkunft aus dem einen oder dem anderen Blatte
ganz unzweideutig zu demonstriren. Sobald nämlich die einzelnen Fasern als solche erkennbar werden,
sind sie bereits aus dem Mutterblatte herausgetreten und bilden eine besondere Schicht zwischen den
beiden Hauptblättern, wie das in Fig. 141a und d, Taf. VIU, bei starker Vergrösserung wiedergegeben
ist. Beweisend scheint mir dagegen der Umstand, dass bei der Knospenbildung, da, wo die Zellen
des Knospenhalses nach und nach in die Leibeswand übergehen, sich zu gewisser Zeit eine Zellschicht
vom äusseren Knospenblatte abspaltet und allmählich bis zu den fertigen Fasern der Tunica verfolgen
lässt (Taf. H, Fig. 59, B), wie ich das schon in meiner früheren Arbeit (’90, S. 60) betont habe.
Auch die Ringfasern des Darms, besonders des Magens, welche Kraepelin ebenfalls vom inneren
Knospenblatte herleitet, sieht man auf Stadien, wo ihre Bildung noch nicht vollendet ist, deutlich
genug aus dem äusseren Blatte hervorgehen.
Mit der Ausbildung der Tunica muscularis geht eine sehr auffällige Ve rd ick ung der beiden
anderen S ch ich ten Hand in Hand. Insbesondere nehmen die Zellen des Ectoderms eine lang
gestreckte Cylinderform an, und zwar zunächst unterhalb der Placenta, wo auch die Muskelschicht
am ersten vollendet ist (Taf, VH, Fig. 138 u. 39), später jedoch überall. Es ist dies einerseits
bedingt durch die jetzt stattfindenden energischen Contractionen der Leibeswand, denen es z. B.
zuzuschreiben ist, dass das Stadium Fig. 138 erheblich kleiner ist als das Stadium Fig. 137, obwohl
dieses ein wenig jünger ist; anderseits ist überhaupt durch die Muscuiatur ein festigendes Element in
Zoologica. Heft 28. S