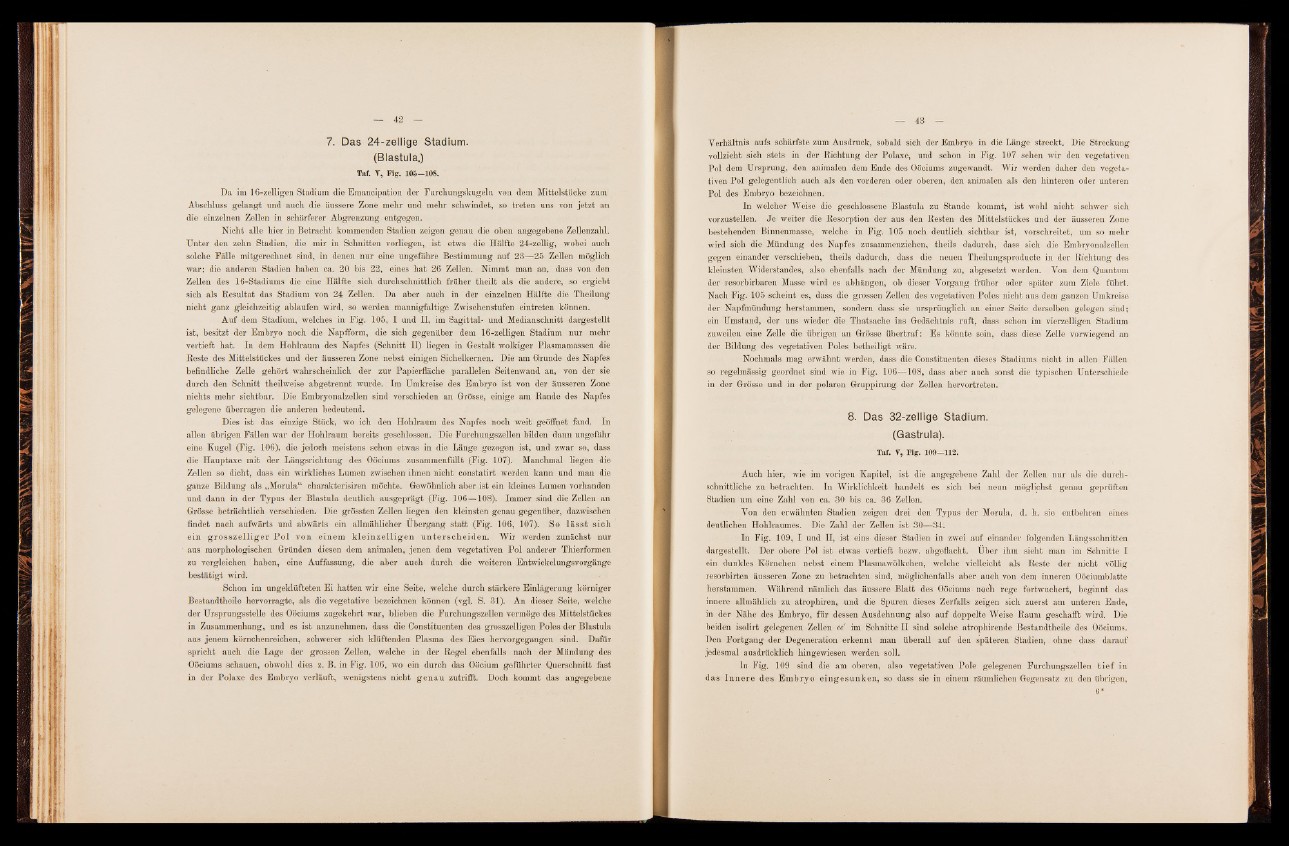
7. Das 24-zellige Stadium.
(Blastula.)
Taf. Y, Fig. 105—108.
Da im 16-zelligen Stadium die Emancipation der Furchungskugeln von dem Mittelstücke zum
Abschluss gelangt und auch die äussere Zone mehr und mehr schwindet, so treten uns von jetzt an
die einzelnen Zellen in schärferer Abgrenzung entgegen.
Nicht alle hier in Betracht kommenden Stadien zeigen genau die oben angegebene Zeilenzahl.
Unter den zehn Stadien, die mir in Schnitten vorliegen,, ist etwa die Hälfte 24-zellig, wobei auch
solche Fälle mitgerechnet sind, in denen nur eine ungefähre Bestimmung auf 23—25 Zellen möglich
war; die anderen Stadien haben ca. 20 bis 22, eines hat 26 Zellen. Nimmt man an, dass von den
Zellen des 16-Stadiums die eine Hälfte sich durchschnittlich früher theilt als die andere, so ergiebt
sich als Resultat das Stadium von 24 Zellen. Da aber auch in der einzelnen Hälfte die Theilung
nicht ganz gleichzeitig ablaufen wird, so werden mannigfaltige Zwischenstufen eintreten können.
Auf dem Stadium, welches in Fig. 105, I und H, im Sagittal- und Medianschnitt dargestellt
ist, besitzt der Embryo noch die Napfform, die sich gegenüber dem 16-zelligen Stadium nur mehr
vertieft hat. In dem Hohlraum des Napfes (Schnitt H) liegen in Gestalt wolkiger Plasmamassen die
Reste des Mittelstückes und der äusseren Zone nebst einigen Sichelkemen. Die am Grunde des Napfes
befindliche Zelle gehört wahrscheinlich der zur Papierfläche parallelen Seitenwand an, von der sie
durch den Schnitt theilweise abgetrennt wurde. Im Umkreise des Embryo ist von der äusseren Zone
nichts mehr sichtbar. Die Embryonalzellen sind verschieden an Grösse, einige am Rande des Napfes
gelegene überragen die anderen bedeutend.
Dies ist das einzige Stück, wo ich den Hohlraum des Napfes noch weit' geöffnet fand. In
allen übrigen Fällen war der Hohlraum bereits geschlossen. Die Furchungszellen bilden dann ungefähr
eine Kugel (Fig. 106), die jedoch meistens schon etwas in die Länge gezogen ist, und zwar so, dass
die Hauptaxe mit der Längsrichtung des Oöciums zusammenfallt (Fig. 107). Manchmal liegen die
Zellen so dicht, dass ein wirkliches Lumen zwischen ihnen nicht constatirt werden kann und man die
ganze Bildung als ,,Morula“ charakterisiren möchte. Gewöhnlich aber ist ein kleines Lumen vorhanden
und dann in der Typus der Blastula deutlich ausgeprägt (Fig. 106—108). Immer sind die Zellen an
Grösse beträchtlich verschieden. Die grössten Zellen liegen den kleinsten genau gegenüber, dazwischen
findet nach aufwärts und abwärts ein allmählicher Übergang statt (Fig. 106, 107). So lä s s t sich
ein g r o s s z e llig e r P o l von einem k le in z e llig e n un terscheiden. Wir werden zunächst nur
aus morphologischen Gründen diesen dem animalen, jenen dem vegetativen Pol anderer Thierformen
zu vergleichen haben, eine Auffassung, die aber auch durch die weiteren Entwickelungsvorgänge
bestätigt wird.
Schon im ungeklüfteten Ei hatten wir eine Seite, welche durch stärkere Einlagerung körniger
Bestandtheile hervorragte, als die vegetative bezeichnen können (vgl, S. 31). An dieser Seite, welche
der Ursprungsstelle des Oöciums zugekehrt war, blieben die Furchungszellen vermöge des Mittelstückes
in Zusammenhang, und es ist anzunehmen, dass die Constituenten des grosszeiligen Poles der Blastula
aus jenem körnchenreichen, schwerer sich klüftenden Plasma des Eies hervorgegangen sind. Dafür
spricht auch die Lage der grossen Zellen, welche in der Regel ebenfalls nach der Mündung des
Oöciums schauen, obwohl dies z. B. in Fig. 106, wo ein durch das Oöcium geführter Querschnitt fast
in der Polaxe des Embryo verläuft, wenigstens nicht genau zutrifft. Doch kommt das angegebene
Verhältnis aufs schärfste zum Ausdruck, sobald sich der Embryo in die Länge streckt. Die Streckung
vollzieht sich stets in der Richtung der Polaxe, und schon in Fig. 107 sehen wir den vegetativen
Pol dem Ursprung, den animalen dem Ende des Oöciums zugewandt. Wir werden daher den vegetativen
Pol gelegentlich auch als den vorderen oder oberen, den animalen als den hinteren oder unteren
Pol des Embryo bezeichnen.
In welcher Weise die geschlossene Blastula zu Stande kommt, ist wohl nicht schwer sich
vorzustellen. Je weiter die Resorption der aus den Resten des Mittelstückes und der äusseren Zone
bestehenden Binnenmasse, welche in Fig. 105 noch deutlich sichtbar ist, vorschreitet, um so mehr
wird sich die Mündung des Napfes zusammenziehen, theils dadurch, dass sich die Embryonalzellen
gegen einander verschieben, theils dadurch, dass die neuen Theilungsproducte in der Richtung des
kleinsten Widerstandes, also ebenfalls nach der Mündung zu, abgesetzt werden. Von dem Quantum
der resorbirbaren Masse wird es abhängen, ob dieser Vorgang früher oder später zum Ziele führt.
Nach Fig. 105 scheint es, dass die grossen Zellen des vegetativen Poles nicht aus dem ganzen Umkreise
der Napfmündung herstammen, sondern dass sie ursprünglich an einer Seite derselben gelegen sind;
ein Umstand, der uns wieder die Thatsache ins Gedächtnis ruft, dass schon im vierzelligen Stadium
zuweilen eine Zelle die übrigen an Grösse übertraf: Es könnte sein, dass diese Zelle vorwiegend an
der Bildung des vegetativen Poles betheiligt wäre.
Nochmals mag erwähnt werden, dass die Constituenten dieses Stadiums nicht in allen Fällen
so regelmässig geordnet sind wie in Fig. 106—108, dass aber auch sonst die typischen Unterschiede
in der Grösse und in der polaren Gruppirung der Zellen hervortreten.
8. Das 32-zelllge Stadium.
(Gastrula).
Taf. V, Fig. 109—112.
Auch hier, wie im vorigen Kapitel, ist die angegebene Zahl der Zellen nur als die durchschnittliche
zu betrachten. In Wirklichkeit handelt es sich bei neun möglichst genau geprüften
Stadien um eine Zahl von ca. 30 bis ca. 36 Zellen.
Von den erwähnten Stadien zeigen drei den Typus der Morula, d. h. sie entbehren eines
deutlichen Hohlraumes. Die Zahl der Zellen ist 30-—34.
In Fig. 109, I und H, ist eins dieser Stadien in zwei auf einander folgenden Längsschnitten
dargestellt. Der obere Pol ist etwas vertieft bezw. abgeflacht. Über ihm sieht man im Schnitte I
ein dunkles Körnchen nebst einem Plasmawölkchen, welche vielleicht als Reste der nicht völlig
resorbirten äusseren Zone zu betrachten sind, möglichenfalls aber auch von dem inneren Oöciumblatte
herstammen. Während nämlich das äussere Blatt des Oöciums noch rege fortwuchert, beginnt das
innere allmählich zu atrophiren, und die Spuren dieses Zerfalls zeigen sich zuerst am unteren Ende,
in der Nähe des Embryo, für dessen Ausdehnung also auf doppelte Weise Raum geschafft wird. Die
beiden isolirt gelegenen Zellen ec' im Schnitte II sind solche atrophirende Bestandtheile des Oöciums.
Den Fortgang der Degeneration erkennt man überall auf den späteren Stadien, ohne dass darauf
jedesmal ausdrücklich hingewiesen werden soll.
ln Fig. 109 sind die am oberen, also vegetativen Pole gelegenen Furchungszellen t i e f in
das Innere des Embryo eingesunken, so dass sie in einem räumlichen Gegensatz zu den übrigen,
6*