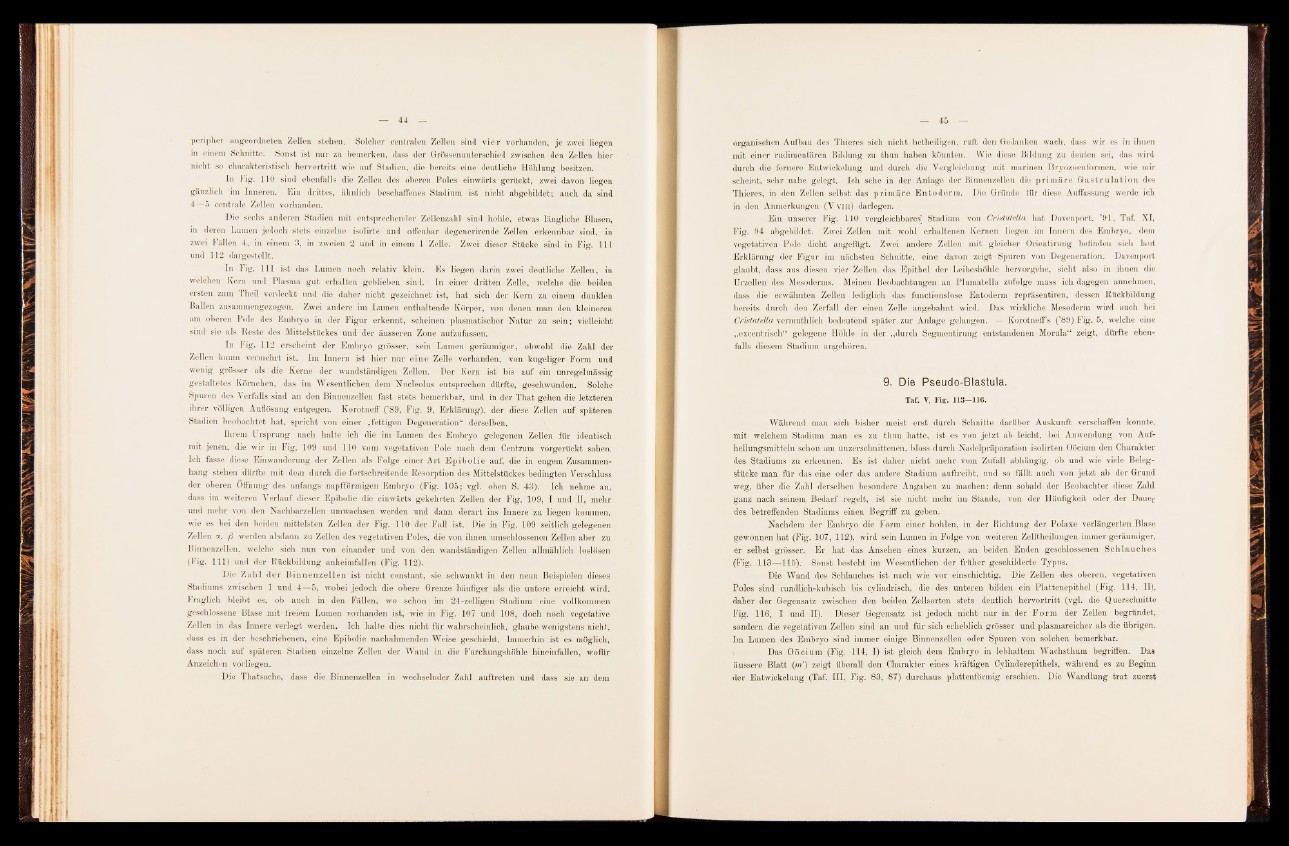
peripher angeordneten Zellen stehen. Solcher centralen Zellen sind v ie r vorhanden, je zwei liegen
in einem Schnitte. Sonst ist nur zu bemerken, dass der Grössenunterschied zwischen den Zellen hier
nicht so charakteristisch hervortritt wie auf Stadien, die bereits eine deutliche Höhlung besitzen.
In Fig. 110 sind ebenfalls die Zellen des oberen Poles einwärts gerückt, zwei davon liegen
gänzlich im Inneren. Ein drittes, ähnlich beschaffenes Stadium ist nicht abgebildet; auch da sind
4—5 centrale Zellen vorhanden.
Die sechs anderen Stadien mit entsprechender Zeilenzahl sind hohle, etwas längliche Blasen,
in deren Lumen jedoch stets einzelne isolirte und offenbar degenerirende Zellen erkennbar sind, in
zwei Fällen 4, in einem 3, in zweien 2 und in einem l Zelle.- Zwei dieser Stücke sind in Fig. 111
und 112 dargestellt.
In Fig. 111 ist das Lumen noch relativ klein. Es liegen darin zwei deutliche Zellen, in
welchen- Kern und Plasma gut erhalten geblieben sind. In einer dritten Zelle, welche die beiden
ersten zum Theil verdeckt und die daher nicht gezeichnet ist, hat sich der Kern zu einem dunklen
Ballen zusammengezogen. Zwei andere im Lumen enthaltende Körper, von denen man den kleineren
am oberen Pole des Embryo in der Figur erkennt, scheinen plasmatischer Natur zu sein; vielleicht
sind sie als Reste des Mittelstückes, und der äusseren Zone aufzufassen.
In Fig. 112 erscheint der Embryo grösser, sein Lumen geräumiger, obwohl die Zahl der
Zellen kaum vermehrt ist. Im Innern ist hier nur eine Zelle vorhanden, von kugeliger Form und
wenig grösser als die Kerne der wandständigen Zellen. Der Kern ist bis auf ein unregeltnässig
gestaltetes Körnchen, das im Wesentlichen dem Nucleolus entsprechen dürfte, geschwunden. Solche
Spuren des Verfalls sind an den Binnenzellen fast stets bemerkbar, und in der That gehen die letzteren
ihrer völligen Auflösung entgegen. Korotneff (’89, Fig. 9, Erklärung), der diese Zellen auf späteren
Stadien beobachtet hat, spricht von einer „fettigen Degeneration“ derselben.
Ihrem Ursprung nach halte ich die im Lumen des Embryo gelegenen Zellen für identisch
mit jenen, die wir in Fig. 109 und 110 vom vegetativen Pole nach dem Centrum vorgerückt sahen.
Ich fasse diese Einwanderung der Zellen als Folge einer Art E p ib o lie auf, die in engem Zusammenhang
stehen dürfte mit dem durch die fortschreitende Resorption des Mittelstückes bedingten Verschluss
der oberen Öffnung des anfangs napfförmigen Embryo (Fig. 105; vgl. oben S. 43). Ich nehme an,
dass im weiteren Verlauf dieser Epibolie die einwärts gekehrten Zellen der Fig. 109, I und II, mehr
und mehr von den Nachbarzellen umwachsen werden und dann derart ins Innere zu liegen kommen,
wie es bei den beiden mittelsten Zellen der Fig. 110 der Fall ist. Die in Fig. 109 seitlich gelegenen
Zellen a, ß werden alsdann zu Zellen des vegetativen Poles, die von ihnen umschlossenen Zellen aber zu
Binnenzellen, welche sich nun von einander und von den wandständigen Zellen allmählich loslösen
(Fig. 111) und der Rückbildung anheimfallen (Fig. 112).
Die Zahl der B innenz e llen ist nicht constant, sie schwankt in den neun Beispielen dieses
Stadi ums zwischen 1 und 4—5, wobei jedoch die obere Grenze häufiger als die untere erreicht wird.
Fraglich bleibt es, ob auch in den Fällen, wo schon im 24-zelligen Stadium eine vollkommen
geschlossene Blase mit freiem Lumen vorhanden ist, wie in Fig. 107 und 108, doch noch vegetative
Zellen in das Innere verlegt werden. Ich halte dies nicht für wahrscheinlich, glaube wenigstens nicht,
dass es in der beschriebenen, eine Epibolie nachahmenden Weise geschieht. Immerhin ist es möglich,
dass noch auf späteren Stadien einzelne Zellen der Wand in die Furchungshöhle hineinfallen, wofür
Anzeichen vorliegen.
Die Thatsache, dass die Binnenzellen in wechselnder Zahl auftreten und dass sie an dem
organischen Aufbau des Thieres sich nicht betheiligen, ruft den Gedanken wach, dass wir es in ihnen
mit einer rudimentären Bildung zu thun haben könnten. Wie diese Bildung zu deuten sei, das wird
durch die fernere Entwickelung und durch die Vergleichung mit marinen Bryozoenformen, wie mir
scheint, sehr nahe gelegt. Ich sehe in der Anlage der Binnenzellen die primäre G a s tru la tion des
Thieres, in den Zellen selbst das primäre Entoderm. Die Gründe für diese Auffassung werde ich
in den Anmerkungen (V VIII) darlegen.
Ein unserer Fig. 110 vergleichbares Stadium von Cristatella hat Davenport, ’91, Taf. XI,
Fig. 94 abgebildet. Zwei Zellen mit wohl erhaltenen Kernen liegen im Innern des Embryo, dem
vegetati ven Pole dicht angefügt. Zwei andere Zellen mit gleicher Orientirung befinden sich laut
Erklärung der Figur im nächsten Schnitte, eine davon zeigt Spuren von Degeneration. Davenport
glaubt, dass aus diesen vier Zellen das Epithel der Leibeshöhle hervorgehe, sieht also in ihnen die
Urzellen des Mesoderms. Meinen Beobachtungen an Plumatella zufolge muss ich dagegen annehmen,
dass die erwähnten Zellen lediglich das functionslose Entoderm repräsentiren, dessen Rückbildung
bereits durch den Zerfall der einen Zelle angebahnt wird. Das wirkliche Mesoderm wird auch bei
Cristatella vermuthlich bedeutend später zur Anlage gelangen. — Korotneff's (’89) Fig. 5, welche eine
„excentrisch“ gelegene Höhle in der „durch Segmentirung entstandenen Morula“ zeigt, dürfte ebenfalls
diesem Stadium angehören.
9. Die Pseudo-Blastula.
Taf. V, Fig. 1 1 3 -1 1 6 .
Während man sich bisher meist erst durch Schnitte darüber Auskunft verschaffen konnte,
mit welchem Stadium man es zu thun hatte, ist es von jetzt ab leicht, bei Anwendung von Aufhellungsmitteln
schon am unzerschnittenen, bloss durch Nadelpräparation isolirten Oöcium den Charakter
des Stadiums zu erkennen. Es ist daher nicht mehr vom Zufall abhängig, ob und wie viele Belegstücke
man für das eine oder das andere Stadium auftreibt, und so Mit auch von jetzt ab der Grund
weg, über die Zahl derselben besondere Angaben zu machen; denn sobald der Beobachter diese Zahl
ganz nach seinem Bedarf regelt, ist sie nicht mehr im Stande, von der Häufigkeit oder der Dauer
des betreffenden Stadiums einen Begriff zu geben.
Nachdem der Embryo die Form einer hohlen, in der Richtung der Polaxe verlängerten Blase
gewonnen hat (Fig. 107, 112), wird sein Lumen in Folge von weiteren Zelltheilungen immer geräumiger,
er selbst grösser. Er hat das Ansehen eines kurzen, an beiden Enden geschlossenen Schlau ch es
(Fig. 113—115). Sonst besteht im Wesentlichen der früher geschilderte Typus.
Die Wand des Schlauches ist nach wie vor einschichtig. Die Zellen des oberen, vegetativen
Poles sind rundlich-kubisch bis cylindrisch, die des unteren bilden ein Plattenepithel (Fig. 114, II),
daher der Gegensatz zwischen den beiden Zellsorten stets deutlich hervortritt (vgl. die Querschnitte
Fig. 116, I und II). Dieser Gegensatz ist jedoch nicht nur in der Form der Zellen begründet,
sondern die vegetativen Zellen sind an und für sich erheblich grösser und plasmareicher als die übrigen.
Im Lumen des Embryo sind immer einige Binnenzellen oder Spuren von solchen bemerkbar.
Das Oöcium (Fig. 114, I) ist gleich dem Embryo in lebhaftem Wachsthum begriffen. Das
äussere Blatt (»*') zeigt überall den Charakter eines kräftigen Cylinderepithels, während es zu Beginn
der Entwickelung (Taf. III, Fig. 83, 87),■ durchaus plattenförmig erschien. Die Wandlung trat zuerst