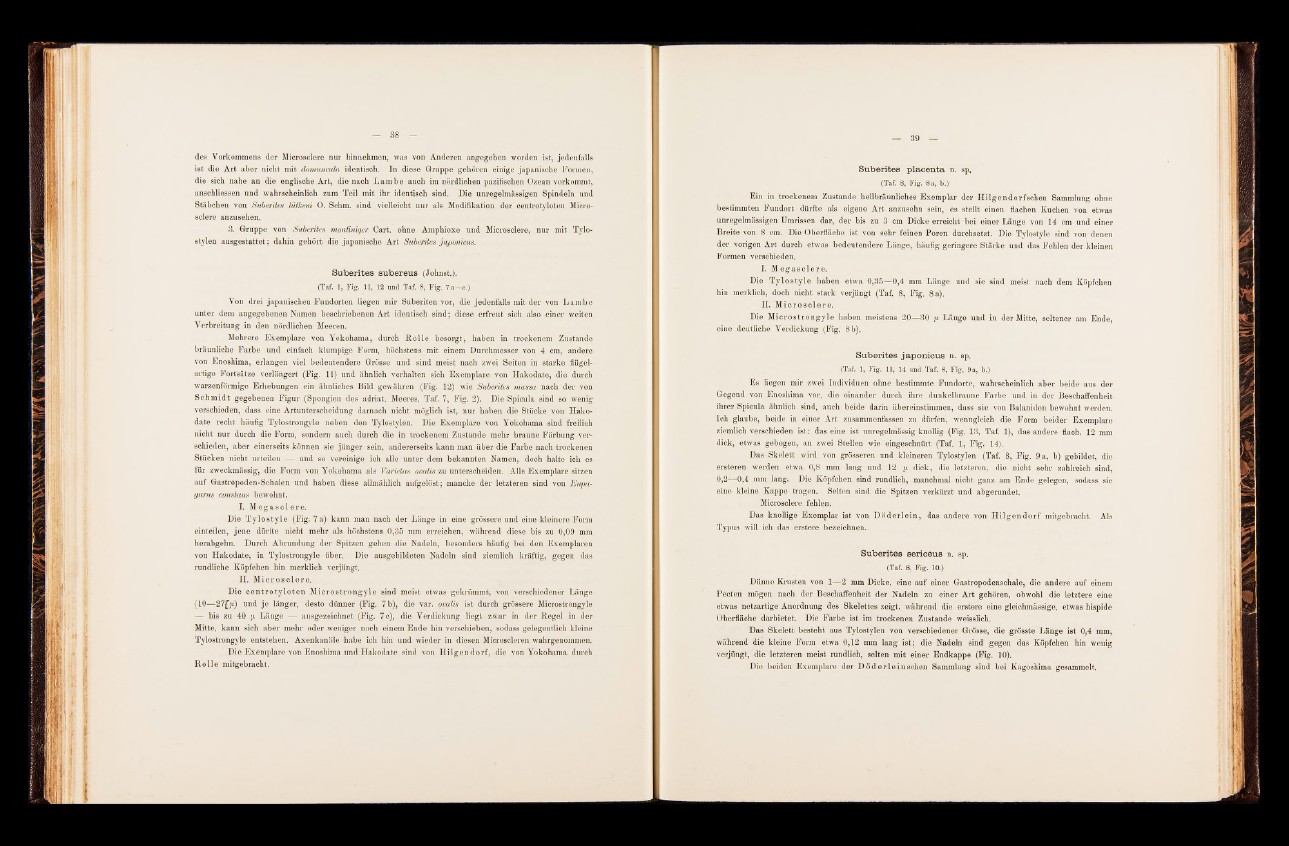
des Vorkommens der Microsclere nur hinnehmen, was von Anderen angegeben worden ist, jedenfalls
ist die Art aber nicht mit domuncula identisch. In diese Gruppe gehören einige japanische Formen,
die sich nahe an die englische Art, die nach Lambe auch im nördlichen pazifischen Ozean vorkommt,
anschliessen und wahrscheinlich zum Teil mit ihr identisch sind. Die unregelmässigen Spindeln und
Stäbchen von Suberites liitheni 0 . Schm, sind vielleicht nur als Modifikation der centrotyloten Microsclere
anzusehen.
3. Gruppe von Suberites montiniger Cart. ohne Amphioxe und Microsclere, nur mit Tylo-
stylen ausgestattet; dahin gehört die japanische Art Suberites jcvponicus.
Suberites subereus (Johnst.).
(Taf. 1, Fig. 11, 12 und Taf. 8, Fig. 7 a—c.)
Von drei japanischen Fundorten liegen mir Suberiten vor, die jedenfalls mit der von Lambe
unter dem angegebenen Namen beschriebenen Art identisch sind; diese erfreut sich also einer weiten
Verbreitung in den nördlichen Meeren.
Mehrere Exemplare von Yokohama, durch Rolle besorgt, haben in trockenem Zustande
bräunliche Farbe und einfach klumpige Form, höchstens mit einem Durchmesser von 4 cm, andere
von Enoshima, erlangen viel bedeutendere Grösse und sind meist nach zwei Seiten in starke flügelartige
Fortsätze verlängert (Fig. 11) und ähnlich verhalten sich Exemplare von Hakodate, die durch
warzenförmige Erhebungen ein ähnliches Bild gewähren (Fig. 12) wie Suberites massa nach der von
Schmidt gegebenen Figur (Spongien des adriat. Meeres, Taf. 7, Fig. 2). Die Spicula sind so wenig
verschieden, dass eine Artunterscheidung darnach nicht möglich ist, nur haben die Stücke von Hakodate
recht häufig Tylostrongyle neben den Tylostylen. Die Exemplare von Yokohama sind freilich
nicht nur durch die Form, sondern auch durch die in trockenem Zustande mehr braune Färbung verschieden,
aber einerseits können sie jünger sein, andererseits kann man über die Farbe nach trockenen
Stücken nicht urteilen — und so vereinige ich alle unter dem bekannten Namen, doch halte ich es
für zweckmässig, die Form -von Yokohama als Varietas ovalis zu unterscheiden. Alle Exemplare sitzen
auf Gastropoden-Schalen und haben diese allmählich aufgelöst; manche der letzteren sind von Etvpa-
gurus constans bewohnt.
I. M eg a sc l ere.
Die Tylostyle (Fig. 7 a) kann man nach der Länge in eine grössere und eine kleinere Form
einteilen, jene dürfte nicht mehr als höchstens 0,35 mm erreichen, während diese bis zu 0,09 mm
herabgehn. Durch Abrundung der Spitzen gehen die Nadeln, besonders häufig bei den Exemplaren
von Hakodate, in Tylostrongyle über. Die ausgebildeten Nadeln sind ziemlich kräftig, gegen das
rundliche Köpfchen hin merklich verjüngt.
II. M ic rosc ler e .
Die centrotyloten Microstrongyle sind meist etwas gekrümmt, von verschiedener Länge
(10—27fp) und je länger, desto dünner (Fig. 7 b), die var. ovalis ist durch grössere Microstrongyle
— bis zu 40 p Länge — ausgezeichnet (Fig. 7 c), die Verdickung liegt zwar in der Regel in der
Mitte, kann sich aber mehr oder weniger nach einem Ende hin verschieben, sodass gelegentlich kleine
Tylostrongyle entstehen. Axenkanäle habe ich hin und wieder in diesen Microscleren wahrgenommen.
Die Exemplare von Enoshima und Hakodate sind von Hilgendorf, die von Yokohama durch
Rolle mitgebracht.
Suberites placenta n. sp.
(Taf. 8, Fig. 8 a, b.)
Ein in trockenem Zustande hellbräunliches Exemplar der Hilgendorfschen Sammlung ohne
bestimmten Fundort dürfte als eigene Art anzusehn sein, es stellt einen flachen Kuchen von etwas
unregelmässigen Umrissen dar, der bis zu 3 cm Dicke erreicht bei einer Länge von 14 cm und einer
Breite von 8 cm. Die Oberfläche ist vpn ' sehr feinen Poren durchsetzt. Die Tylostyle sind von denen
der vorigen Art durch etwas bedeutendere Länge, häufig geringere Stärke und das Fehlen der kleinen
Formen verschieden.
I. M egasclere.
Die Tylostyle haben etwa 0,35—0,4 mm Länge und sie sind meist nach dem Köpfchen
hin merklich, doch nicht stark verjüngt (Taf. 8, Fig. 8 a).
II. M icrosclere.
Die Microstrongyle haben meistens 20—30 p Länge und in der Mitte, seltener am Ende,
eine deutliche Verdickung (Fig. 8 b).
Suberites japonicus n. sp.
(Taf. 1, Fig. 13, 14 und Taf. 8, Fig. 9a, b.)
Es liegen mir zwei Individuen ohne bestimmte Fundorte, wahrscheinlich aber beide aus der
Gegend von Enoshima vor, die einander durch ihre dunkelbraune Farbe und in der Beschaffenheit
ihrer Spicula ähnlich sind, auch beide darin übereinstimmen, dass sie von Balaniden bewohnt werden.
Ich glaube, beide in einer Art zusammenfassen zu dürfen, wenngleich die Form beider Exemplare
ziemlich verschieden ist: das eine ist unregelmässig knollig (Fig. 13, Taf. 1), das andere flach, 12 mm
dick, etwas gebogen, an zwei Stellen wie eingeschnürt (Taf. 1, Fig. 14).
Das Skelett wird von grösseren und kleineren Tylostylen (Taf. 8, Fig. 9 a, b) gebildet, die
ersteren werden etwa 0,8 mm lang nnd 12 p dick, die letzteren, die nicht sehr zahlreich sind,
0,2—0,4 mm lang. Die Köpfchen sind rundlich, manchmal nicht ganz am Ende gelegen, sodass sie
eine kleine Kappe tragen. Selten sind die Spitzen verkürzt und abgerundet.
Microsclere fehlen.
Das knollige Exemplar ist von Döderlein, das andere von Hilgendorf mitgebracht. Als
Typus will ich das erstere bezeichnen.
Suberites sericeus n. sp.
(Taf. 8, Fig. 10.)
Dünne Krusten von 1—2 mm Dicke, eine auf einer Gastropodenschale, die andere auf einem
Pecten mögen nach der Beschaffenheit der Nadeln zu einer Art gehören, obwohl die letztere eine
etwas netzartige Anordnung des Skelettes zeigt, während die erstere eine gleichmässige, etwas hispide
Oberfläche darbietet. Die Farbe ist im trockenen Zustande weisslich.
Das Skelett besteht aus Tylostylen von verschiedener Grösse, die grösste Länge ist 0,4 mm,
während die kleine Form etwa 0,12 mm lang ist; die Nadeln sind gegen das Köpfchen hin wenig
verjüngt, die letzteren meist rundlich, selten mit einer Endkappe (Fig. 10).
Die beiden Exemplare der Döderleinschen Sammlung sind bei Kagoshima gesammelt.