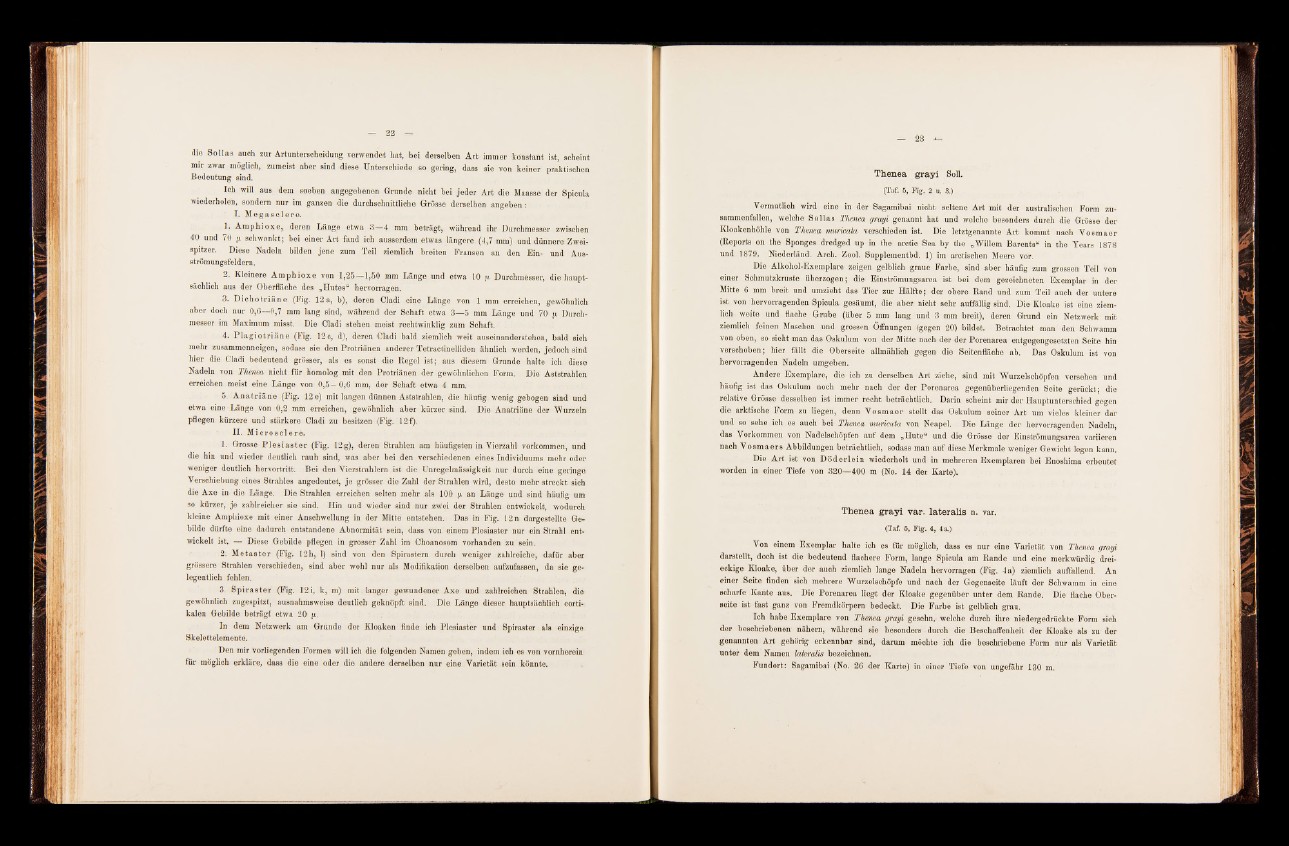
die Sollas auoh zur Artunterecheidung verwendet hat, bei derselben Art immer konstant ist, soheint
mir zwar möglich, zumeist aber sind diese Unterschiede so gering, dass sie von keiner praktischen
Bedeutung sind.
Ich will aus dem soeben angegebenen Grunde nicht bei jeder Art die Maasse der Spicula
wiederholen, sondern nur im ganzen die durchschnittliche Grösse derselben angeben:
I. M eg a sc le re .
1. Amphioxe, deren Länge etwa 3—4 mm beträgt, während ihr Durchmesser zwischen
40 und 70 p schwankt; bei einer Art fand ich ausserdem etwas längere (4,7 mm) und dünnere Zweispitzer.
Diese Nadeln bilden jene zum Teil ziemlich breiten Fransen an den Ein- und Ausströmungsfeldern.
2. Kleinere Amphioxe von 1,25—1,50 mm Länge und etwa 10 p Durchmösser, die hauptsächlich
aus der Oberfläche des „Hutes“ hervorragen.
3. Dichotriäne (Fig. 12 a, b), deren Cladi eine Länge von 1 mm erreichen, gewöhnlich
aber doch nur 0,6—0,7 mm lang sind, während der Schaft etwa 3—5 mm Länge und 70 p Durchmesser
im Maximum misst. Die Cladi stehen meist rechtwinklig zum Schaft.
4. Plagiotriäne (Fig. 12c, d), deren Cladi bald ziemlich weit auseinanderstehen, bald sich
mehr zusammenneigen, sodass sie den Protriänen anderer Tetractinelliden ähnlich werden, jedoch sind
hier die Cladi bedeutend grösser, als es sonst die Regel ist; aus diesem Grunde halte ich. diese
Nadeln von Thenea nicht für homolog mit den Protriänen der gewöhnlichen Form. Die Aststrahlen
erreichen meist eine Länge von 0,5— 0,6 mm, der Schaft etwa 4 mm.
5. Anatriäne (Fig. 12e) mit langen dünnen Aststrahlen, die häufig wenig gebogen sind und
etwa eine Länge von 0,2 mm erreichen, gewöhnlich aber kürzer sind. Die Anatriäne der Wurzeln
pflegen kürzere und stärkere Cladi zu besitzen (Fig. 12 f).
II. M icrosclere.
1. Grosse P lesia ste r (Fig. 12g), deren Strahlen am häufigsten in Vierzahl Vorkommen, und
die hin und wieder deutlich rauh sind, was aber bei den verschiedenen eines Individuums mehr oder
weniger deutlich hervortritt. Bei den Vierstrahlern ist die Unregelmässigkeit nur durch eine geringe
Verschiebung eines Strahles angedeutet, je grösser die Zahl der Strahlen wird, desto mehr streckt sich
die Axe in die Länge. Die Strahlen erreichen selten mehr als 100 p an Länge und sind häufig um
so kürzer, je zahlreicher sie sind. Hin und wieder sind nur zwei der Strahlen entwickelt, wodurch
kleine Amphioxe mit einer Anschwellung in der Mitte entstehen. Das in Fig. 12n dargestellte Gebilde
dürfte eine dadurch entstandene Abnormität sein, dass von einem Plesiaster nur ein Strahl entwickelt
ist. — Diese Gebilde pflegen in grösser Zahl im Choanosom vorhanden zu sein.
2. Metaster (Fig. 12h, 1) sind von den Spirastern durch weniger zahlreiche, dafür aber
grössere Strahlen verschieden, sind aber wohl nur als Modifikation derselben aufzufassen, da sie gelegentlich
fehlen.
3. Spiraster (Fig. 12i, k, m) mit . langer gewundener Axe und zahlreichen Strahlen, die
gewöhnlich zugespitzt, ausnahmsweise deutlich geknöpft sind. Die Länge dieser hauptsächlich corti-
kalen Gebilde beträgt etwa 20 p.
In dem Netzwerk am Grunde der Kloaken finde ich Plesiaster und Spiraster als einzige
Skeletteleraente.
Den mir vorliegenden Formen will ich die folgenden Namen geben, indem ich es von vornherein
für möglich erkläre, dass die eine oder die andere derselben nur eine Varietät sein könnte.
Thenea grayi Soll.
(Taf. 5, Fig. 2 u. 8.)
Vermutlich wird eine in der Sagamibai nicht seltene Art mit der australischen Form zusammenfallen,
welche Sollas Thenea grayi genannt hat und welche besonders durch die Grösse der
Kloakenhöhle von Thenea muricata verschieden ist. Die letztgenannte Art kommt nach Vosmaer
(Reports on the Sponges dredged up in the arctic Sea by the „Willem Barents“ in the Years 1878
und 1879. Niederländ. Arch. Zool. Supplementbd. 1) im arctischen Meere vor.
Die Alkohol-Exemplare zeigen gelblich graue Farbe, sind aber häufig zum grossen Teil von
einer Schmutzkruste überzogen; die Einströmungsarea ist bei dem gezeichneten Exemplar in der
Mitte 6 mm breit und umzieht das Tier zur Hälfte; der obere Rand und zum Teil auch der untere
i®t von hervorragenden Spicula gesäumt, die aber nicht sehr auffällig sind. Die Kloake ist eine ziemlich
weite und flache Grube (über 5 mm lang und 3 mm breit), deren Grund ein Netzwerk mit
ziemlich feinen Maschen und grossen Öffnungen (gegen 20) bildet. Betrachtet man den Schwamm
von oben, so sieht man das Oskulum von der Mitte nach der der Porenarea entgegengesetzten Seite hin
verschoben; hier fällt die Oberseite allmählich gegen die Seitenfläche ab. Das Oskulum ist von
hervorragenden Nadeln umgeben.
Andere Exemplare, die ich zu derselben Art ziehe, sind mit Wurzelschöpfen versehen und
häufig ist das Oskulum noch mehr nach der der Porenarea gegenüberliegenden Seite gerückt; die
relative Grösse desselben ist immer recht beträchtlich. Darin scheint mir der Hauptunterschied gegen
die arktische Form zu liegen, denn Vosmaer stellt das Oskulum seiner Art um vieles kleiner dar
und so sehe ich es auch bei Thenea muricata von Neapel. Die Länge der hervorragenden Nadeln,
das Vorkommen von Nadelschöpfen auf dem „Hutea und die Grösse der Einströmungsarea variieren
nach Vosmaers Abbildungen beträchtlich, sodass man auf diese Merkmale weniger Gewicht legen kann.
Die Art ist von Döderlein wiederholt und in mehreren Exemplaren bei Enoshima erbeutet
worden in einer Tiefe von 320—400 m (No. 14 der Karte).
Thenea grayi var. lateralis n. var.
(Taf. 6, Fig. 4, 4 a.)
Von einem Exemplar halte ich es für möglich, dass es nur eine Varietät von Thenea grayi
darstellt, doch ist die bedeutend flachere Form, lange Spicula am Rande und eine merkwürdig dreieckige
Kloake, über der auch ziemlich lange Nadeln hervorragen (Fig. 4 a) ziemlich auffallend. An
einer Seite finden sich mehrere Wurzelschöpfe und nach der Gegenseite läuft der Schwamm in eine
scharfe Kaiite aus. Die Porenarea liegt der Kloake gegenüber unter dem Rande. Die flache Oberseite
ist fast ganz von Fremdkörpern bedeckt. Die Farbe ist gelblich grau.
Ich habe Exemplare von Thenea grayi gesehn,- welche durch ihre niedergedrückte Form sich
der beschriebenen nähern, während sie besonders durch die Beschaffenheit der Kloake als zu der
genannten Art gehörig erkennbar sind, darum möchte ich die beschriebene Form nur als Varietät
unter dem Namen lateralis bezeichnen.
Fundort: Sagamibai (No. 26 der Karte) in einer Tiefe von ungefähr 130 m.