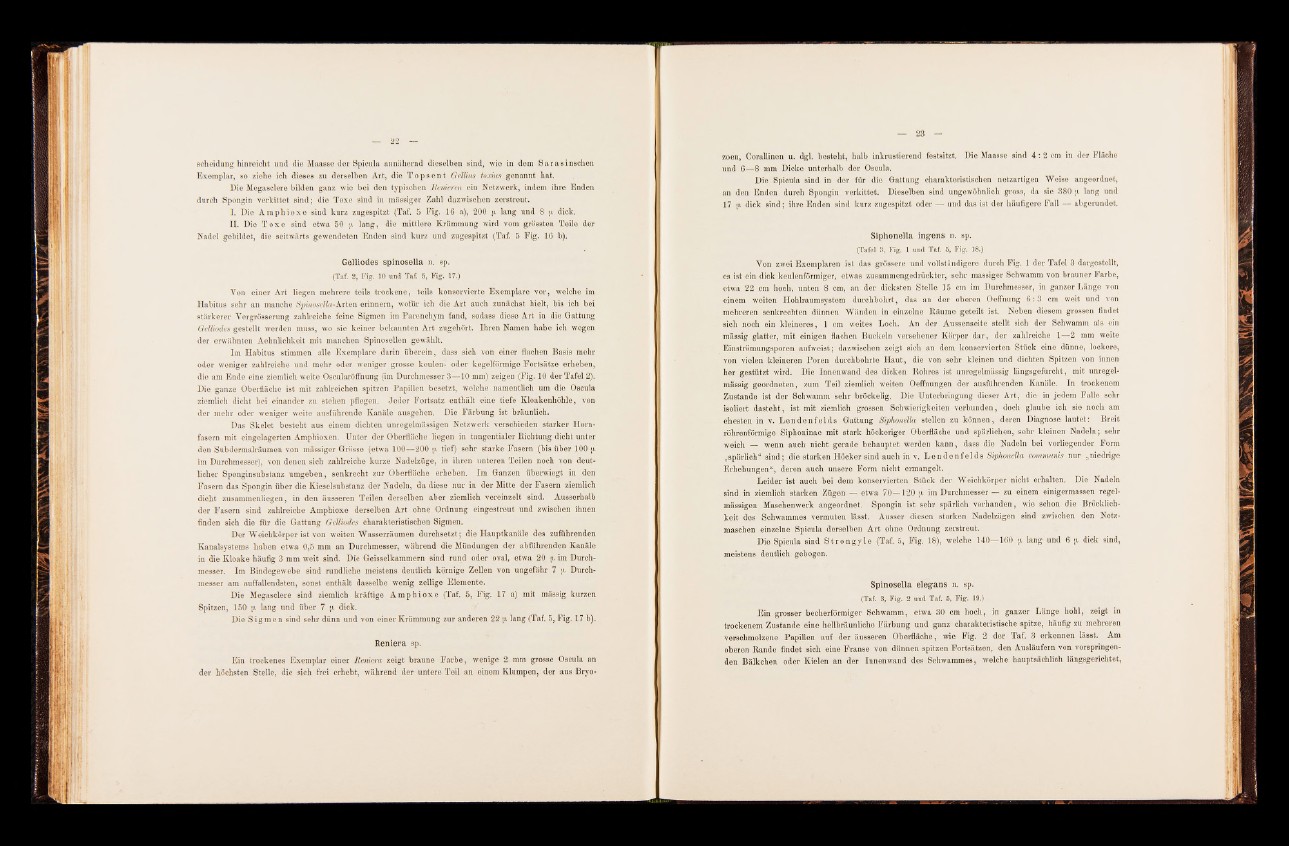
soheidung hinreicht und die Maasse der Spicula annähernd dieselben sind, wie in dem Sarasinschen
Exemplar, so ziehe ich dieses zu derselben Art, die T o p s en t Gellius toxius genannt hat.
Die Megasolere bilden ganz wie bei den typischen liemeren ein Netzwerk, indem ihre Enden
durch Spongin verkittet sind; die Toxe sind in mässiger Zahl dazwischen zerstreut.
I. Die Amph io x e sind kurz zugespitzt (Taf. 5 Fig. 16 a), 200 p lang und 8 p dick.
II. Die T o x e sind etwa 50 p lang, die mittlere Krümmung wird vom grössten Teile der
Nadel gebildet, die seitwärts gewendeten Enden sind kurz und zugespitzt (Taf. 5 Fig. 16 b).
Gelliodes spinosella n. sp.
(Taf. 2, Fig. 10 und Taf. 5, Fig. 17.)
Von einer Art liegen mehrere teils trockene, teils konservierte Exemplare vor, welche im
Habitus sehr an manche Spinosella-Arten erinnern, wofür ich die Art auch zunächst hielt, bis ich bei
stärkerer Vergrösserung zahlreiche feine Sigmen im Parenchym fand, sodass diese Art in die Gattung
Gelliodes gestellt werden muss, wo sie keiner bekannten Art zugehört. Ihren Namen habe ich wegen
der erwähnten Aehnlichkeit mit manchen Spinosellen gewählt.
Im Habitus stimmen alle Exemplare darin überein, dass sich von einer flachen Basis mehr
oder weniger zahlreiche und mehr oder weniger grosse keulen- oder kegelförmige Fortsätze erheben,
die am Ende eine ziemlich weite Oscularöffnung (im Durchmesser 3—10 mm) zeigen (Fig. 10 der Tafel 2).
Die ganze Oberfläche ist mit zahlreichen spitzen Papillen besetzt, welche namentlich um die Oscula
ziemlich dicht bei einander zu stehen pflegen. Jeder Fortsatz enthält eine tiefe Kloakenhöhle, von
der mehr oder weniger weite ausführende Kanäle ausgehen. Die Färbung ist bräunlich.
Das Skelet besteht aus einem dichten unregelmässigen Netzwerk verschieden starker Hornfasern
mit eingelagerten Amphioxen. Unter der Oberfläche liegen in tangentialer Richtung dicht unter
den Subdermalräumen von mässiger Grösse (etwa 100—200 p tief) sehr starke Fasern (bis über 100 p
im Durchmesser), von denen sich zahlreiche kurze Nadelzüge, in ihren unteren Teilen noch von deutlicher
Sponginsubstanz umgeben, senkrecht zur Oberfläche erheben. Im Ganzen überwiegt in den
Fasern das Spongin über die Kieselsubstanz der Nadeln, da diese nur in der Mitte der Fasern ziemlich
dicht zusammenliegen, in den äusseren Teilen derselben aber ziemlich vereinzelt sind. Ausserhalb
der Fasern sind zahlreiche Amphioxe derselben Art ohne Ordnung eingestreut und zwischen ihnen
finden sich die für die Gattung Gelliodes charakteristischen Sigmen.
Der Weichkörper ist von weiten Wasserräumen durchsetzt; die Hauptkanäle des zuführenden
Kanalsystems haben etwa 0,5 mm an Durchmesser, während die Mündungen der abführenden Kanäle
in die Kloake häufig 3 mm weit sind. Die Geisselkammern sind rund oder oval, etwa 20 p im Durchmesser.
Im Bindegewebe sind rundliche meistens deutlich körnige Zellen von ungefähr 7 p Durchmesser
am auffallendsten, sonst enthält dasselbe wenig zellige Elemente.
Die Megasclere sind ziemlich kräftige Am p h io x e (Taf. 5, Fig. 17 a) mit mässig kurzen
Spitzen, 150 p lang und über 7 p dick.
Die S igm en sind sehr dünn und von einer Krümmung zur anderen 22 p lang (Taf. 5, Fig. 17 b).
Reniera sp.
Ein trockenes Exemplar einer JReniera zeigt braune Farbe, wenige 2 mm grosse Oscula an
der höchsten Stelle, die sich frei erhebt, während der untere Teil an einem Klumpen, der aus Bryozoen,
Corallinen u. dgl. besteht, halb inkrustierend festsitzt. Die Maasse sind 4 : 2 cm in der Fläche
und 6—8 mm Dicke unterhalb der Oscula.
Die Spicula sind in der für die Gattung charakteristischen netzartigen Weise angeordnet,
an den Enden durch Spongin verkittet. Dieselben sind ungewöhnlich gross, da sie 380 p lang und
17 p dick sind; ihre Enden sind kurz zugespitzt oder — und das ist der häufigere Fall — abgerundet.
Siphonelia ing’ens n. sp.
(Tafel 3, Fig. 1 und Taf. 5, Fig. 18.)
Von zwei Exemplaren ist das grössere und vollständigere durch Fig. 1 der Tafel 3 dargestellt,
es ist ein dick keulenförmiger, etwas zusammengedrückter, sehr massiger Schwamm von brauner Farbe,
etwa 22 cm hoch, unten 8 cm, an der dicksten Stelle 15 cm im Durchmesser, in ganzer Länge von
einem weiten Hohlraumsystem durchbohrt, das an der oberen Oeffnung 6 :3 cm weit und von
mehreren senkrechten dünnen Wänden in einzelne Räume geteilt ist. Neben diesem grossen findet
sich noch ein kleineres, 1 cm weites Loch. An der Aussenseite stellt sich der Schwamm als ein
mässig glatter, mit einigen flachen Buckeln versehener Körper dar, der zahlreiche 1—2 mm weite
Einströmungsporen aufweist; dazwischen zeigt sich an dem konservierten Stück eine dünne, lockere,
von vielen kleineren Poren durchbohrte Haut, die von sehr kleinen und dichten Spitzen von innen
her gestützt wird. Die Innenwand des dicken Rohres ist unregelmässig längsgefurcht, mit unregeb
mässig geordneten, zum Teil ziemlich weiten Oeffnungen der ausführenden Kanäle. In trockenem
Zustande ist der Schwamm sehr bröckelig. Die Unterbringung dieser Art, die in jedem Falle sehr
isoliert dasteht, ist mit ziemlich grossen Schwierigkeiten verbunden, doch glaube ich sie noch am
ehesten in v. L en d en fe ld s Gattung Siphonelia stellen zu können, deren Diagnose lautet: Breit
röhrenförmige Siphoninae mit stark höckeriger Oberfläche und spärlichen, sehr kleinen Nadeln;, sehr
weich — wenn auch nicht gerade behauptet werden kann, dass die Nadeln bei vorliegender Form
„spärlich“ sind; die starken Höcker sind auch in v. L en d c n fe ld s Siphonelia communis nur „niedrige
Erhebungen“, deren auch unsere Form nicht ermangelt.
Leider ist auch bei dem konservierten Stück der. Weichkörper nicht erhalten. Die Nadeln
sind in ziemlich starken Zügen — etwa 70—120 p im Durchmesser — zu einem einigermassen regelmässigen
Maschenwerk angeordnet. Spongin ist sehr spärlich vorhanden, wie schon die Bröcklich-
keit des Schwammes vermuten lässt. Ausser diesen starken Nadelzügen sind zwischen den Netzmaschen
einzelne Spicula derselben Art ohne Ordnung zerstreut.
Die Spicula sind S t r o n g y le (Taf. 5, Fig. 18), welche 140—160 p lang und 6 p dick sind,
meistens deutlich gebogen.
Spinosella elegans n. sp.
(Taf. 3, Fig. 2 und Taf. 5, Fig. 19.)
Ein grösser becherförmiger Schwamm, etwa 30 cm hoch, in ganzer Länge hohl, zeigt in
trockenem Zustande eine hellbräunliche Färbung und ganz charakteristische spitze, häufig zu mehreren
verschmolzene Papillen auf der äusseren Oberfläche, wie Fig. 2 der Taf. 3 erkennen lässt. Am
oberen Rande findet sich eine Franse von dünnen spitzen Fortsätzen, den Ausläufern von vorspringenden
Bälkchen oder Kielen an der Innenwand des Schwammes, welche hauptsächlich längsgerichtet,