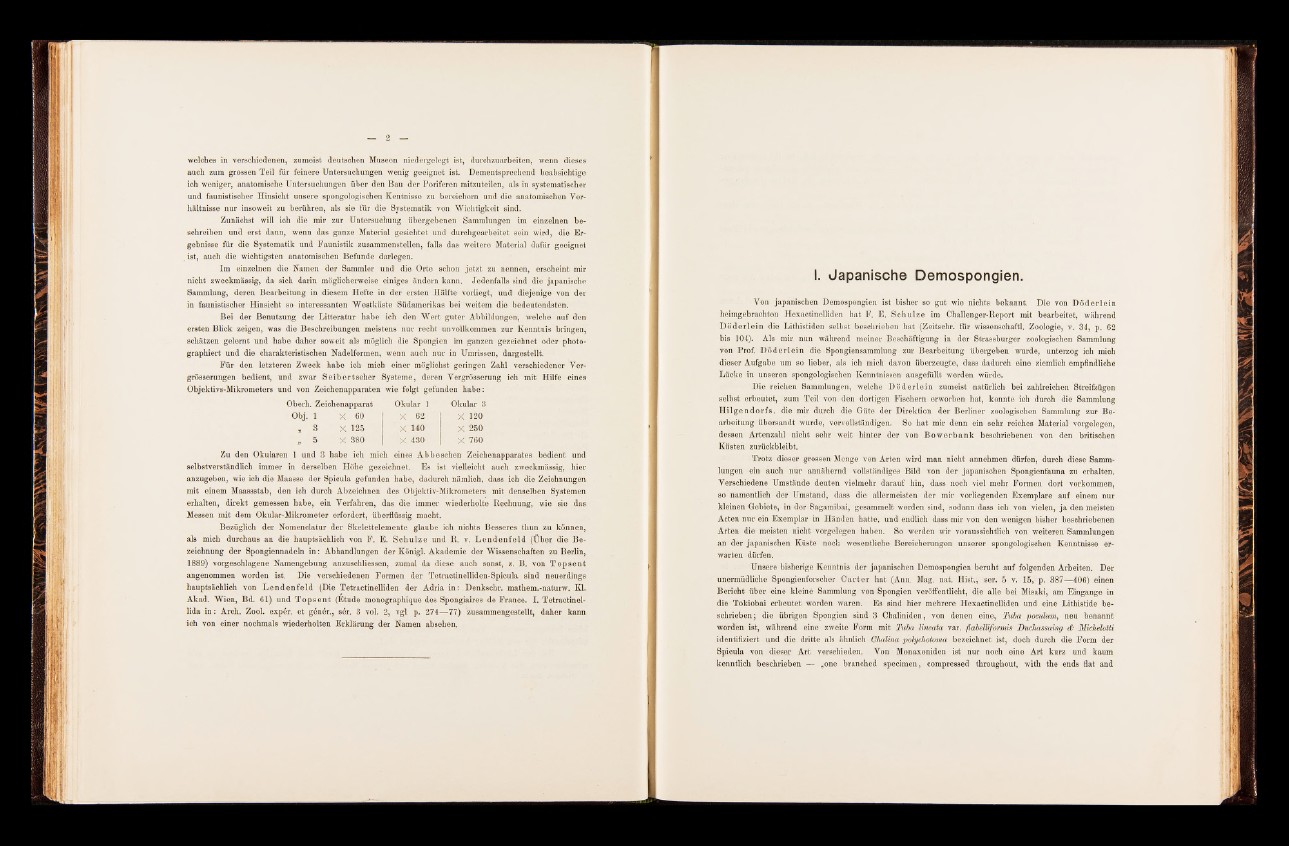
welches in verschiedenen, zumeist deutschen Museen niedergelegt ist, durchzuarbeiten, wenn dieses
auch zum grossen Teil für feinere Untersuchungen wenig geeignet ist. Dementsprechend beabsichtige
ich weniger, anatomische Untersuchungen über den Bau der Poriferen mitzuteilen, als in systematischer
und faunistischer Hinsicht unsere spongologischen Kentnisse zu bereichern und die anatomischen Verhältnisse
nur insoweit zu berühren, als sie für die Systematik von Wichtigkeit sind.
Zunächst will ich die mir zur Untersuchung übergebenen Sammlungen im einzelnen beschreiben
und erst dann, wenn das ganze Material gesichtet und durchgearbeitet sein wird, die Ergebnisse
für die Systematik und Faunistik zusammenstellen, falls das weitere Material dafür geeignet
ist, auch die wichtigsten anatomischen Befunde darlegen.
Im einzelnen die Namen der Sammler und die Orte schon jetzt zu nennen, erscheint mir
nicht zweckmässig, da sich darin möglicherweise einiges ändern kann. Jedenfalls sind die japanische
Sammlung, deren Bearbeitung in diesem Hefte in der ersten Hälfte vorliegt, und diejenige von der
in faunistischer Hinsicht so interessanten Westküste Südamerikas bei weitem die bedeutendsten.
Bei der Benutzung der Litteratur habe ich den Wert guter Abbildungen, welche auf den
ersten Blick zeigen, was die Beschreibungen meistens nur recht unvollkommen zur Kenntnis bringen,
schätzen gelernt und habe daher soweit als möglich die Spongien im ganzen gezeichnet oder photographiert
und die charakteristischen Nadelformen, wenn auch nur in Umrissen, dargestellt.
Für den letzteren Zweck habe ich mich einer möglichst geringen Zahl verschiedener Ver-
grösserungen bedient, und zwar Seibertscher Systeme, deren Vergrösserung ich mit Hilfe eines
Objektivs-Mikrometers und von Zeichenapparaten wie folgt gefunden habe:
Oberh. Zeichenapparat Okular 1 Okular 3
Obj. 1 X 60
j) 3 X 125
„ 5 X 380
X. 62
;X 140
X 430
X 120
X 250
X 760
Zu den Okularen 1 und 3 habe ich mich eines Abbeschen Zeichenapparates bedient und
selbstverständlich immer in derselben Höhe gezeichnet. Es ist vielleicht auch zweckmässig, hier
anzugeben, wie ich die Maasse der Spicula gefunden habe, dadurch nämlich, dass ich die Zeichnungen
mit einem Maassstab, den ich durch Abzeichnen des Objektiv-Mikrometers mit denselben Systemen
erhalten, direkt gemessen habe, ein Verfahren, das die immer wiederholte Rechnung, wie sie das
Messen mit dem Okular-Mikrometer erfordert, überflüssig macht.
Bezüglich der Nomenclatur der Skelettelemente glaube ich nichts Besseres thun zu können,
als mich durchaus an die hauptsächlich von F. E. Schulze und R. v. Lendenfeld (Über die Bezeichnung
der Spongiennadeln in : Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin,
1889) vorgeschlagene Namengebung anzuschliessen, zumal da diese auch sonst, z. B. von Top sent
angenommen worden ist. Die verschiedenen Formen der Tetractinelliden-Spicula sind neuerdings
hauptsächlich von Lendenfeld (Die Tetractinelliden der Adria in: Denkschr. mathem.-naturw. Kl.
Akad. Wien, Bd. 61) und Top sent (Étude monographique des Spongiaires de France. I. Tetractinel-
lida in : Arch. Zool. expér. et génér., sér. 3 vol. 2, vgl. p. 274—77) zusammengestellt, daher kann
ich von einer nochmals wiederholten Erklärung der Namen absehen.
I. Japanische Demospongien.
Von japanischen Demospongien ist bisher so gut wie nichts bekannt. Die von Döderlein
heimgebrachten Hexactinelliden hat F. E. Schulze im Challenger-Report mit bearbeitet, während
Döderlein die Lithistiden selbst beschrieben hat (Zeitschr. für wissenschaftl. Zoologie, v. 34, p. 62
bis 104). Als mir nun während meiner Beschäftigung in der Strassburger zoologischen Sammlung
von Prof. Döderlein die Spongiensammlung zur Bearbeitung übergeben wurde, unterzog ich mich
dieser Aufgabe um so lieber, als ich mich davon überzeugte, dass dadurch eine ziemlich empfindliche
Lücke in unseren spongologischen Kenntnissen ausgefüllt werden würde.
Die reichen Sammlungen, welche Döderlein zumeist natürlich bei zahlreichen Streifzügen
selbst erbeutet, zum Teil von den dortigen Fischern erworben hat, konnte ich durch die Sammlung
Hilgendorfs, die mir durch die Güte der Direktion der Berliner zoologischen Sammlung zur Bearbeitung
übersandt wurde, vervollständigen. So hat mir denn ein sehr reiches Material Vorgelegen,
dessen Artenzahl nicht sehr weit hinter der von Bo wer bank beschriebenen von den britischen
Küsten zurüokbleibt.
Trotz dieser grossen Menge von Arten wird man nicht annehmen dürfen, durch diese Sammlungen
ein auch nur annähernd vollständiges Bild von der japanischen Spongienfauna zu erhalten.
Verschiedene Umstände deuten vielmehr darauf hin, dass noch viel mehr Formen dort Vorkommen,
so namentlich der Umstand, dass die allermeisten der mir vorliegenden Exemplare auf einem nur
kleinen Gebiete, in der Sagamibai, gesammelt worden sind, sodann dass ich von vielen, ja den meisten
Arten nur ein Exemplar in Händen hatte, und endlich dass mir von den wenigen bisher beschriebenen
Arten die meisten nicht Vorgelegen haben. So werden wir voraussichtlich von weiteren Sammlungen
an der japanischen Küste noch wesentliche Bereicherungen unserer spongologischen Kenntnisse erwarten
dürfen.
Unsere bisherige Kenntnis der japanischen Demospongien beruht auf folgenden Arbeiten. Der
unermüdliche Spongienforscher Carter hat (Ann. Mag. nat. Hist., ser. 5 v. 15, p. 387—406) einen
Bericht über eine kleine Sammlung von Spongien veröffentlicht, die alle bei Misaki, am Eingänge in
die Tokiobai erbeutet worden waren. Es sind hier mehrere Hexactinelliden und eine Lithistide beschrieben;
die übrigen Spongien sind 3 Chaliniden, von denen eine, Tuba poculum, neu benannt
worden ist, während eine zweite Form mit Tuba lineata var. flabelliformis Duchassaing & Michelotti
identifiziert und die dritte als ähnlich Chalina polychotoma bezeichnet ist, doch durch die Form der
Spicula von dieser Art verschieden. Von Monaxoniden ist nur noch eine Art kurz und kaum
kenntlich beschrieben —r „one branched specimen, compressed throughout, with the ends flat and