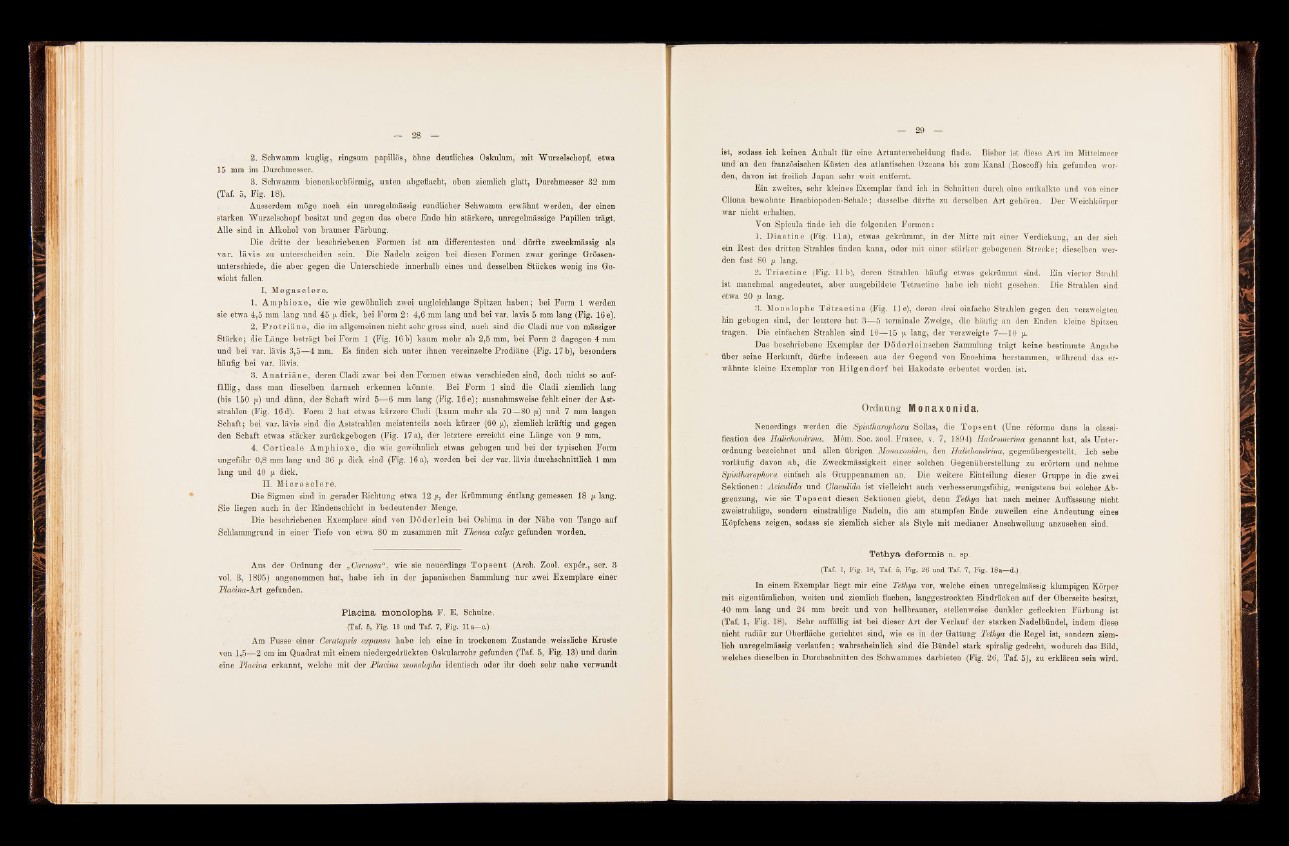
2. Schwamm kuglig, ringsum papillös, bhne deutliches Oskulum, mit Wurzelschopf, etwa
15 mm im Durchmesser.
3. Schwamm bienenkorbförmig, unten abgeflacht, oben ziemlich glatt, Durchmesser 32 mm
(Taf. 5, Fig. 18).
Ausserdem möge noch ein unregelmässig rundlicher Schwamm erwähnt werden, der einen
starken Wurzelschopf besitzt und gegen das obere Ende hin stärkere, unregelmässige Papillen trägt.
Alle sind in Alkohol von brauner Färbung.
Die dritte der beschriebenen Formen ist am differentesten und dürfte zweckmässig als
var. lävis zu unterscheiden sein. 'Die Nadeln zeigen bei diesen Formen zwar geringe Grössenunterschiede,
die aber gegen die Unterschiede innerhalb eines und desselben Stückes wenig ins Gewicht
fallen.
I. M eg a sc le re .
1. Amphioxe, die wie gewöhnlich zwei ungleichlange Spitzen haben; bei Form 1 werden
sie etwa 4,5 mm lang und 45 p dick, bei Form 2: 4,6 mm lang und bei var. lavis 5 mm lang (Fig. 16 e).
2. Protriäne, die im allgemeinen nicht sehr gross sind, auch sind die Cladi nur von mässiger
Stärke; die Länge beträgt bei Form 1 (Fig. 16b) kaum mehr als 2,5 mm, bei Form 2 dagegen 4 mm
und bei var. lävis 3,5—4 mm. Es finden sich unter ihnen vereinzelte Prodiäne (Fig. 17 b), besonders
häufig bei var. lävis.
3. Anatriäne, deren Cladi zwar bei den Formen etwas verschieden sind, doch nicht so auffällig,
dass man dieselben darnach erkennen könnte. Bei Form 1 sind die Cladi ziemlich lang
(bis 150 p) und dünn, der Schaft wird 5—6 mm lang (Fig. 16 c); ausnahmsweise fehlt einer der Aststrahlen
(Fig. 16 d). Form 2 hat etwas kürzere Cladi (kaum mehr als 70—80 p) und 7 mm langen
Schaft; bei var. lävis sind die Aststrahlen meistenteils noch kürzer (60 p), ziemlich kräftig und gegen
den Schaft etwas stärker zurückgebogen (Fig. 17 a), der letztere erreicht eine Länge von 9 mm.
4. Corticale Amphioxe, die wie gewöhnlich etwas gebogen und bei der typischen Form
ungefähr 0,8 mm lang und 36 p dick sind (Fig. 16 a), werden bei der var. lävis durchschnittlich 1 mm
läng und 40 p dick.
H. M ic ro sc le r e .
Die Sigmen sind in gerader Richtung etwa 12 p, der Krümmung entlang gemessen 18 p lang.
Sie liegen auch in der Rindenschicht in bedeutender Menge.
Die beschriebenen Exemplare sind von Döderlein bei Oshima in der Nähe von Tango auf
Schlammgrund in einer Tiefe von etwa 80 m zusammen mit Thenea calyx gefunden worden.
Aus der Ordnung der „Gamosa“, wie sie neuerdings Topsent (Arch. Zool. expör., ser. 3
vol. 3, 1895) angenommen hat, habe ich in der japanischen Sammlung nur zwei Exemplare einer
Plaoina-Ait gefunden.
Placina monolopha F. E. Schulze.
(Taf. 5, Fig. 13 und Taf. 7, Fig. 11a—c.)
Am Fusse einer Geratopsis expahsa habe ich eine in trockenem Zustande weissliche Kruste
vonj.,5—2 cm im Quadrat mit einem niedergedrückten Oskularrohr gefunden (Taf. 5, Fig. 13) und darin
eine Placina erkannt, welche mit der Placina monolopha identisch oder ihr doch sehr nahe verwandt
ist, sodass ich keinen Anhalt für eine Artunterscheidung finde. Bisher ist diese Art im Mittelmeer
und an den französischen Küsten des atlantischen Ozeans bis zum Kanal (Roscoff) hin gefunden worden,
davon ist freilich Japan sehr weit entfernt.
Ein zweites, sehr kleines Exemplar fand ich in Schnitten durch eine entkalkte und von einer
Cliona bewohnte Brachiopoden-Schale; dasselbe dürfte zu derselben Art gehören. Der Weichkörper
war nicht erhalten.
Von Spicula finde ich die folgenden Formen:
1. Diactine (Fig. lla ), etwas gekrümmt, in der Mitte mit einer Verdickung, an der sich
ein Rest des dritten Strahles finden kann, oder mit einer stärker gebogenen Strecke; dieselben werden
fast 80 p lang.
2. Triactine (Fig. 11b), deren Strahlen häufig etwas gekrümmt sind. Ein vierter Strahl
ist manchmal angedeutet, aber ausgebildete Tetractine habe ich nicht gesehen. Die Strahlen sind
etwa 20 p lang.
3. Monolophe Tdtractine (Fig. 11 o), deren drei einfache Strahlen gegen den verzweigten
hin gebogen sind, der letztere hat 3—5 terminale Zweige, die häufig an den Enden kleine Spitzen
tragen. Die einfachen Strahlen sind 10—15 p lang, der verzweigte 7g=!l0 p.
Das beschriebene Exemplar der Döderleinschen Sammlung trägt keine bestimmte Angabe
über seine Herkunft, dürfte indessen aus der Gegend von Enoshima herstammen, während das erwähnte
kleine Exemplar von Hilgendorf bei Hakodate erbeutet worden ist.
Ordnung Monaxoni d a .
Neuerdings werden die Spintharophora Sollas, die Topsent (Une réforme dans la classification
des Halichondrina. Mém. Soc. zool. France, v. 7, 1894) Hadromerina genannt hat, als Unterordnung
bezeichnet und allen übrigen Monaxoniden, den Halichondrina, gegenübergestellt. Ich sehe
vorläufig davon ab, die Zweckmässigkeit einer solchen Gegenüberstellung zu erörtern und nehme
Spintharophora einfach als Gruppennamen an. Die weitere Einteilung dieser Gruppe in die zwei
Sektionen : Aciculida und Glavulida ist vielleicht auch verbesserungsfähig, wenigstens bei solcher Abgrenzung,
wie sie Topsent diesen Sektionen giebt, denn Tethya hat nach meiner Auffassung nicht
zweistrahlige, sondern einstrahlige Nadeln, die am stumpfen Ende zuweilen eine Andeutung eines
Köpfchens zeigen, sodass sie ziemlich sicher als Style mit medianer Anschwellung anzusehen sind.
Tethya deformis n. sp.
(Taf. 1, Fig. 18, Taf. 5, Fig. 26 und Taf. 7, Fig. 18 a—d.).
In einem Exemplar liegt mir eine Tethya vor, welche einen unregelmässig klumpigen Körper
mit eigentümlichen, weiten und ziemlich flachen, langgestreckten Eindrücken auf der Oberseite besitzt,
40 mm lang und 24 mm breit und von hellbrauner, stellenweise dunkler gefleckten Färbung ist
(Taf. 1, Fig. 18). Sehr auffällig ist bei dieser Art der Verlauf der starken Nadelbündel, indem diese
nicht radiär zur Oberfläche gerichtet sind, wie es in der Gattung Tethya die Regel ist, sondern ziemlich
unregelmässig verlaufen ; wahrscheinlich sind die Bündel stark spiralig gedreht, wodurch das Bild,
welches dieselben in Durchschnitten des Schwammes darbieten (Fig. 26, Taf. 5), zu erklären sein wird.