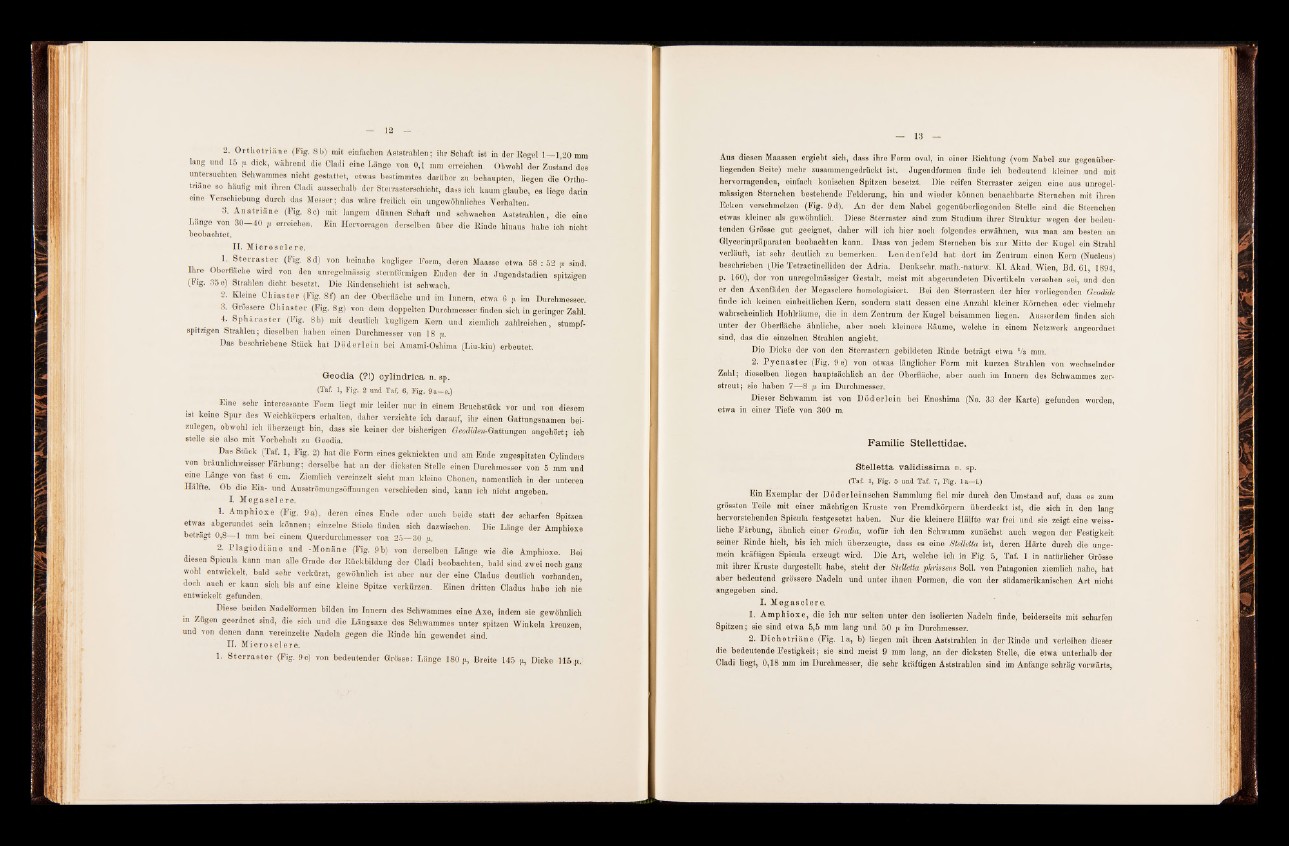
2. Orthotnäne (Fig. 8b) mit einfaohen Aststrahlen; ihr Sohaft ist in der Regel 1—1,20 mm
lang und 15 p dick, während die Cladi eine Länge Ton 0,1 mm erreiohen. Obwohl der Zustand des
untersuohten Sohwarames nicht gestattet, etwas bestimmtes darüber zu behaupten, liegen die Ortho-
triäne so häufig mit ihren Cladi ausserhalb der Sterrasterschioht, dass ich kaum glaube, es liege darin
eine Verschiebung durch das Messer; das wäre freilich ein ungewöhnliches Verhalten.
3. Anatriäne (Fig. 8c) mit langem dünnen Sohaft und sohwaohen Aststrahlen, die eine
Lange von 30—40 p erreichen. Ein Hervorragen derselben über die Rinde hinaus habe ich nioht
beobachtet.
II. M iorosclere.
1. Sterraster (Fig. 8d) von beinahe kugliger Form, deren Maasse etwa 58 : 52 ja sind.
Ihre Oberfläche wird von den unregelmässig sternförmigen Enden der in Jugendstadien spitzigen
(Fig. 35 e) Strahlen dicht besetzt. Die Rindenschicht ist schwach.
2. Kleine Chiaster (Fig. 8f) an der Oberfläche und im Innern, etwa 6 ja im Durchmesser.
3. Grössere Chiaster (Fig. 8g) von dem doppelten Durchmesser finden sich in geringer Zahl.
4. Sphäraster (Fig. 8h) mit deutlich kugligem Kern und ziemlich zahlreichen, stumpf-
spitzigen Strahlen; dieselben haben einen Durchmesser von 18 ja.
Das beschriebene Stück hat Döderlein bei Amami-Oshima (Liu-kiu) erbeutet.
Geodia (?!) cylindrica n. sp.
(Taf. 1, Fig. 2 und Taf. 6, Fig. 9 a—e.)
Eine sehr interessante Form liegt mir leider nur in einem Bruohstüok vor und von diesem
ist keine Spur des Weichkörpers erhalten, daher verzichte ich darauf, ihr einen Gattungsnamen beizulegen,
obwohl ich überzeugt bin, dass sie keiner der bisherigen Geodidm-Gattungen angehört; ich
stelle sie also mit Vorbehalt zu Geodia.
Das Stuck (Taf. 1, Fig. 2) hat die Form eines geknickten und am Ende zugespitzten Cylinders
von bräunlichweisser Färbung; derselbe hat an der dicksten Stelle einen Durohmesser von 5 mm und
eine Länge von fast 6 cm. Ziemlich vereinzelt sieht man kleine Chonen, namentlich in der unteren
Hälfte. Ob die Ein- und Ausströmungsöffnungen verschieden sind, kann ich nicht angeben.
I. Megascl ere.
1. Amphioxe (Fig. 9a), deren eines Ende oder auch beide statt der scharfen Spitzen
etwas abgerundet sein können; einzelne Stiele finden sich dazwischen. Die Länge der Amphioxe
beträgt 0,8—1 mm bei einem Querdurchmesser von 25-—30 p.
2. Plagiodiäne und -Monäne (Fig. 9b) von derselben Länge wie die Amphioxe. Bei
diesen Spicula kann man alle Grade der Rückbildung der Cladi beobachten, bald sind zwei nooh ganz
wohl entwickelt, bald sehr verkürzt, gewöhnlich ist aber nur der eine Cladus deutlich vorhanden,
doch auch er kann sich bis auf eine kleine Spitze verkürzen. Einen dritten Cladus habe ich nié
entwickelt gefunden.
Diese beiden Nadelformen bilden im Innern des Schwammes eine Axe, indem sie gewöhnlich
in Zugen geordnet sind, die sich und die Längsaxe des Schwammes unter spitzen Winkeln kreuzen,
und von denen dann vereinzelte Nadeln gegen die Rinde hin gewendet sind.
II. M ic rosc ler e .
1. Sterraster (Fig. 9 o) von bedeutender Grösse: Länge 180 p, Breite 145 p, Dicke 115 p,
Aus diesen Maassen ergiebt sich, dass ihre Form oval, in einer Richtung (vom Nabel zur gegenüber-
liegenden Seite) mehr zusammengedrückt ist. Jugendformen finde ich bedeutend kleiner und mit
hervorragenden, einfach konischen Spitzen besetzt. Die reifen Sterraster zeigen eine aus unregelmässigen
Sternchen bestehende Felderung, hin und wieder können benachbarte Sternchen mit ihren
Ecken verschmelzen (Fig. 9d). An der dem Nabel gegenüberliegenden Stelle sind die Sternchen
etwas kleiner als gewöhnlich. Diese Sterraster sind zum Studium ihrer Struktur wegen der bedeutenden
Grösse gut geeignet, daher will ich hier noch folgendes erwähnen, was man am besten an
Glycerinpräparaten beobachten kann. Dass von jedem Sternchen bis zur Mitte der Kugel ein Strahl
verläuft, ist sehr deutlich zu bemerken. Lendenfeld hat dort im Zentrum. einen Kern (Nudeus)
beschrieben (Die Tetractinelliden der Adria. Denkschr. math.-naturw. Kl. Akad. "Wien, Bd. 61 1894
p. 160), der von unregelmässiger Gestalt, meist mit abgerundeten Divertikeln versehen sei, und den
er den Axenfäden der Megasclere homologisiert. Bei den Sterrastern der hier vorliegenden Geodidc
finde ich keinen einheitlichen Kern, sondern statt dessen eine Anzahl kleiner Körnchen oder vielmehr
wahrscheinlich Hohlräume, die in dem Zentrum der Kugel beisammen liegen. Ausserdem finden sich
unter der Oberfläche ähnliche, aber noch kleinere Räume, welche in einem Netzwerk angeordnet
sind, das die einzelnen Strahlen angiebt.
Die Dicke der von den Sterrastern gebildeten Rinde beträgt etwa Vs mm.
2. Pycnaster (Fig. 9e) von etwas länglicher Form mit kurzen Strahlen von wechselnder
Zahl; dieselben liegen hauptsächlich an der Oberfläche, aber auch im Innern des Schwammes zerstreut;
sie haben 7—8 ja im Durchmesser.
Dieser Schwamm ist von Döderlein bei Enoshima (No. 33 der Karte) gefunden worden,
etwa in einer Tiefe von 300 m.
Familie Stellettidae.
Stelletta validissima n. sp.
(Taf. 1, Fig. 5 und Taf. 7, Fig. l a—i.)
Ein Exemplar der Döderleinschen Sammlung fiel mir durch den Umstand auf, dass es zum
grössten Teile mit einer mächtigen Kruste von Fremdkörpern überdeckt ist, die sich in den lang
hervorstehenden Spicula festgesetzt haben. Nur die kleinere Hälfte war frei und sie zeigt eine weiss-
liche Färbung, ähnlich einer Geodia, wofür ich den Schwamm zunächst auch wegen der Festigkeit
seiner Rinde hielt, bis ich mich überzeugte, dass es eine Stelletta ist, deren Härte durch die ungemein
kräftigen Spicula erzeugt wird. Die Art, welche ich in Fig. 5, Taf. 1 in natürlicher Grösse
mit ihrer Kruste dargestellt habe, steht der Stelletta phrissens Soll, von Patagonien ziemlich nahe, hat
aber bedeutend grössere Nadeln und unter ihnen Formen, die von der südamerikanischen Art nicht
angegeben sind.
I. Megasclere.
1. Amphioxe, die ich nur selten unter den isolierten Nadeln finde, beiderseits mit scharfen
Spitzen; sie sind etwa 5,5 mm lang und 50 ja im Durchmesser.
2. Diohotriäne (Fig. la , b) liegen mit ihren Aststrahlen in der Rinde und verleihen dieser
die bedeutende Festigkeit; sie sind meist 9 mm lang, an der dicksten Stelle, die etwa unterhalb der
Cladi liegt, 0,18 mm im Durchmesser, die sehr kräftigen Aststrahlen sind im Anfänge schräg vorwärts,