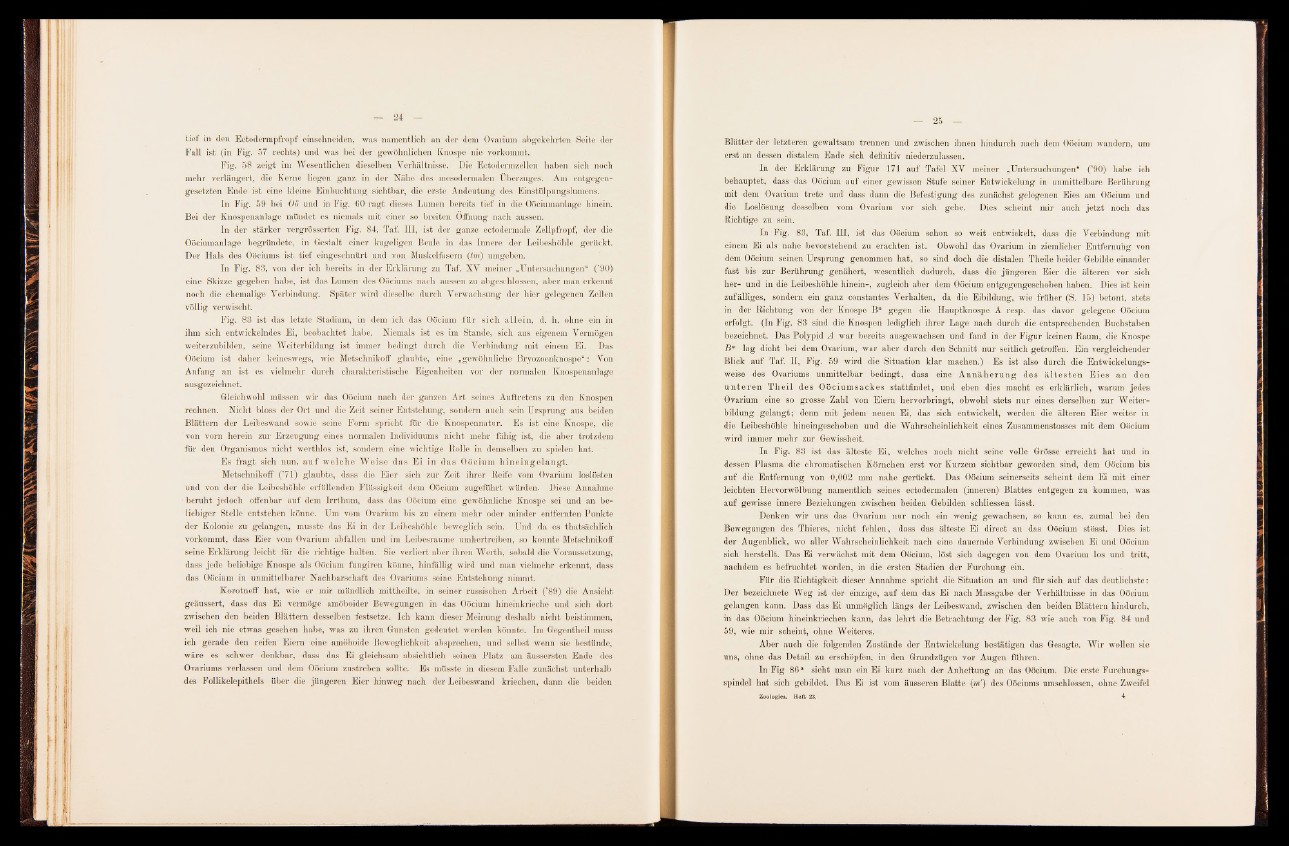
tief in den Ectodermpfropf einschneiden, was namentlich an der dem Ovarium abgekehrten Seite der
Fall ist (in Fig. 57 rechts) und was bei der gewöhnlichen Knospe nie vorkommt.
Fig. 58 zeigt im Wesentlichen dieselben Verhältnisse. Die Ectodermzellen haben sich noch
mehr verlängert, die Kerne liegen ganz in der Nähe des mesodermalen Überzuges. Am entgegengesetzten
Ende ist eine kleine Einbuchtung sichtbar, die erste Andeutung des Einstülpungslumens.
In Fig. 59 bei Oö und in Fig. 60 ragt dieses Lumen bereits tief in die Oöciumanlage hinein.
Bei der Knospenanlage mündet es niemals mit einer so breiten Öffnung nach aussen.
In der stärker vergrösserten Fig. 84, Taf. III, ist der ganze ectodermale Zellpfropf, der die
Oöciumanlage begründete, in Gestalt einer kugeligen Beule in das Innere der Leibeshöhle gerückt.
Der Hals des Oöciums ist tief eingeschnürt und von Muskelfasern (tm) umgeben.
In Fig. 83, von der ich bereits in der Erklärung zu Taf. XV meiner „Untersuchungen“ (r90)
eine Skizze gegeben habe, ist das Lumen des Oöciums nach aussen zu abgeschlossen, aber man erkennt
noch die ehemalige Verbindung. Später wird dieselbe durch Verwachsung der hier gelegenen Zellen
völlig verwischt.
Fig. 83 ist das letzte Stadium, in dem ich das Oöcium für sich a lle in , d. h. ohne ein in
ihm sich entwickelndes Ei, beobachtet habe. Niemals ist es im Stande, sich aus eigenem Vermögen
weiterzubilden, seine Weiterbildung ist immer bedingt durch die Verbindung mit einem Ei. Das
Oöcium ist daher keineswegs, wie Metschnikoff glaubte, eine »gewöhnliche Bryozoenknospe“: Von
Anfang an ist es vielmehr durch charakteristische Eigenheiten vor der normalen Knospenanlage
ausgezeichnet.
Gleichwohl müssen wir das Oöcium nach der ganzen Art seines Auftretens zu den Knospen
rechnen. Nicht bloss der Ort und die Zeit seiner Entstehung, sondern auch sein Ursprung aus beiden
Blättern der Leibeswand sowie seine Form spricht für die Knospennatur. Es ist eine Knospe, die
von vorn herein zur Erzeugung eines normalen Individuums nicht mehr fähig ist, die aber trotzdem
für den Organismus nicht werthlos ist, sondern eine wichtige Rolle in demselben zu spielen hat.
Es fragt sich nun, a u f w e lch e W e ise das Ei in das Oöcium h in e in g e lan g t.
Metschnikoff (’71) glaubte, dass die Eier sich zur Zeit ihrer Reife vom Ovarium loslösten
und von der die Leibeshöhle erfüllenden Flüssigkeit dem Oöcium zugeführt würden. Diese Annahme
beruht jedoch offenbar auf dem Irrthum, dass das Oöcium eine gewöhnliche Knospe sei und an beliebiger
Stelle entstehen könne. Um vom Ovarium bis zu einem mehr oder minder entfernten Punkte
der Kolonie zu gelangen, musste das Ei in der Leibeshöhle beweglich sein. Und da es thatsächlich
vorkommt, dass Eier vom Ovarium abfallen und im Leibesraume umhertreiben, so konnte Metschnikoff
seine Erklärung leicht für die richtige halten. Sie verliert aber ihren Werth, sobald die Voraussetzung,
dass jede beliebige Knospe als Oöcium fungiren könne, hinfällig wird und man vielmehr erkennt, dass
das Oöcium in unmittelbarer Nachbarschaft des Ovariums seine Entstehung nimmt.
Korotneff hat, wie er mir mündlich mittheilte, in seiner russischen Arbeit (’89) die Ansicht
geäussert, dass das Ei vermöge amöboider Bewegungen in das Oöcium hineinkrieche und sich dort
zwischen den beiden Blättern desselben festsetze. Ich kann dieser Meinung deshalb nicht beistimmen,
weil ich nie etwas gesehen habe, was zu ihren Gunsten gedeutet werden könnte. Im Gegentheil muss
ich gerade den reifen Eiern eine amöboide Beweglichkeit absprechen, und selbst wenn sie bestünde,
wäre es schwer denkbar, dass das Ei gleichsam absichtlich seinen Platz am äussersten Ende des
Ovariums verlassen und dem Oöcium zustreben sollte. Es müsste in diesem Falle zunächst unterhalb
des Follikelepithels über die jüngeren Eier hinweg nach der Leibeswand kriechen, dann die beiden
Blätter der letzteren gewaltsam trennen ünd zwischen ihnen hindurch nach dem Oöcium wandern, um
erst an dessen distalem Ende sich definitiv niederzulassen.
In der Erklärung zu- Figur 171 auf Tafel XV meiner „Untersuchungen“ (’90) habe ich
behauptet, dass das Oöcium auf einer gewissen Stufe seiner Entwickelung in unmittelbare Berührung
mit dem Ovarium trete und dass dann die Befestigung des zunächst gelegenen Eies am Oöcium und
die Loslösung desselben vom Ovarium vor sich gehe. Dies scheint mir auch jetzt noch das
Richtige zu sein.
In Fig. 83, Taf. HI, ist das Oöcium schon so weit entwickelt, dass die Verbindung mit
einem Ei als nahe bevorstehend zu erachten ist. Obwohl das Ovarium in ziemlicher Entfernung von
dem Oöcium seinen Ursprung genommen hat, so sind doch die distalen Theile beider Gebilde einander
fast bis zur Berührung genähert, wesentlich dadurch, dass die jüngeren Eier die älteren vor sich
her- und in die Leibeshöhle hinein-, zugleich aber dem Oöcium entgegengeschoben haben. Dies ist kein
zufälliges, sondern ein ganz constaiites Verhalten, da die Eibildung, wie früher (S. 15) betont, stets
in der Richtung von der Knospe Bn gegen die Hauptknospe A resp. das davor gelegene Oöcium
erfolgt. (In Fig. 83 sind die Knospen lediglich ihrer Lage nach durch die entsprechenden Buchstaben
bezeichnet. Das Polypid A war bereits ausgewachsen und fand in der Figur keinen Raum, die Knospe
Bn lag dicht bei dem Ovarium, war aber durch den Schnitt nur seitlich getroffen. Ein vergleichender
Blick auf Taf. II, Fig. 59 wird die Situation klar machen.) Es ist also durch die Entwickelungsweise
des Ovariums unmittelbar bedingt, dass eine Annäherung des ä lte s te n E ie s an den
u n te r en T h e il des Oöciumsackes stattfindet, und eben dies macht es erklärlich, warum jedes
Ovarium eine so grosse Zahl von Eiem hervorbringt, obwohl stets nur eines derselben zur Weiterbildung
gelangt; denn mit jedem neuen Ei, das sich entwickelt, werden die älteren Eier weiter in
die Leibeshöhle hineingeschoben und die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstosses mit dem Oöcium
wird immer mehr zur Gewissheit.
In Fig. 83 ist das älteste Ei, welches noch nicht seine volle Grösse erreicht hat und in
dessen Plasma die chromatischen Körnchen erst vor Kurzem sichtbar geworden sind, dem Oöcium bis
auf die Entfernung von 0,002 mm nahe gerückt. Das Oöcium seinerseits scheint dem Ei mit einer
leichten Hervorwölbung namentlich seines ectodermalen (inneren) Blattes entgegen zu kommen, was
auf gewisse innere Beziehungen zwischen beiden Gebilden schliessen lässt.
Denken wir uns das Ovarium nur noch ein wenig gewachsen, so kann es, zumal bei den
Bewegungen des Thieres, nicht fehlen, dass das älteste Ei direct an das Oöcium stösst. Dies ist
der Augenblick, wo aller Wahrscheinlichkeit nach eine dauernde Verbindung zwischen Ei und Oöcium
sich herstellt. Das Ei verwächst mit dem Oöcium, löst sich dagegen von dem Ovarium los und tritt,
nachdem es befruchtet worden, in die ersten Stadien der Furchung ein.
Für die Richtigkeit dieser Annahme spricht die Situation an und für sich auf das deutlichste:
Der bezeichnete Weg ist der einzige, auf dem das Ei nach Massgabe der Verhältnisse in das Oöcium
gelangen kann. Dass das Ei unmöglich längs der Leibeswand, zwischen den beiden Blättern hindurch,
in das Oöcium hineinkriechen kann, das lehrt die Betrachtung der Fig. 83 wie auch von Fig. 84 und
59, wie mir scheint, ohne Weiteres.
Aber auch die folgenden- Zustände der Entwickelung bestätigen das Gesagte. Wir wollen sie
uns, ohne das Detail zu erschöpfen, in den Grundzügen vor Augen führen.
In Fig 86a sieht man ein Ei kurz nach der Anheftung an das Oöcium. Die erste Furchungsspindel
hat sich gebildet. Das Ei ist vom äusseren Blatte (m') des Oöciums umschlossen, ohne Zweifel
Zoologie». Heft 23. 4