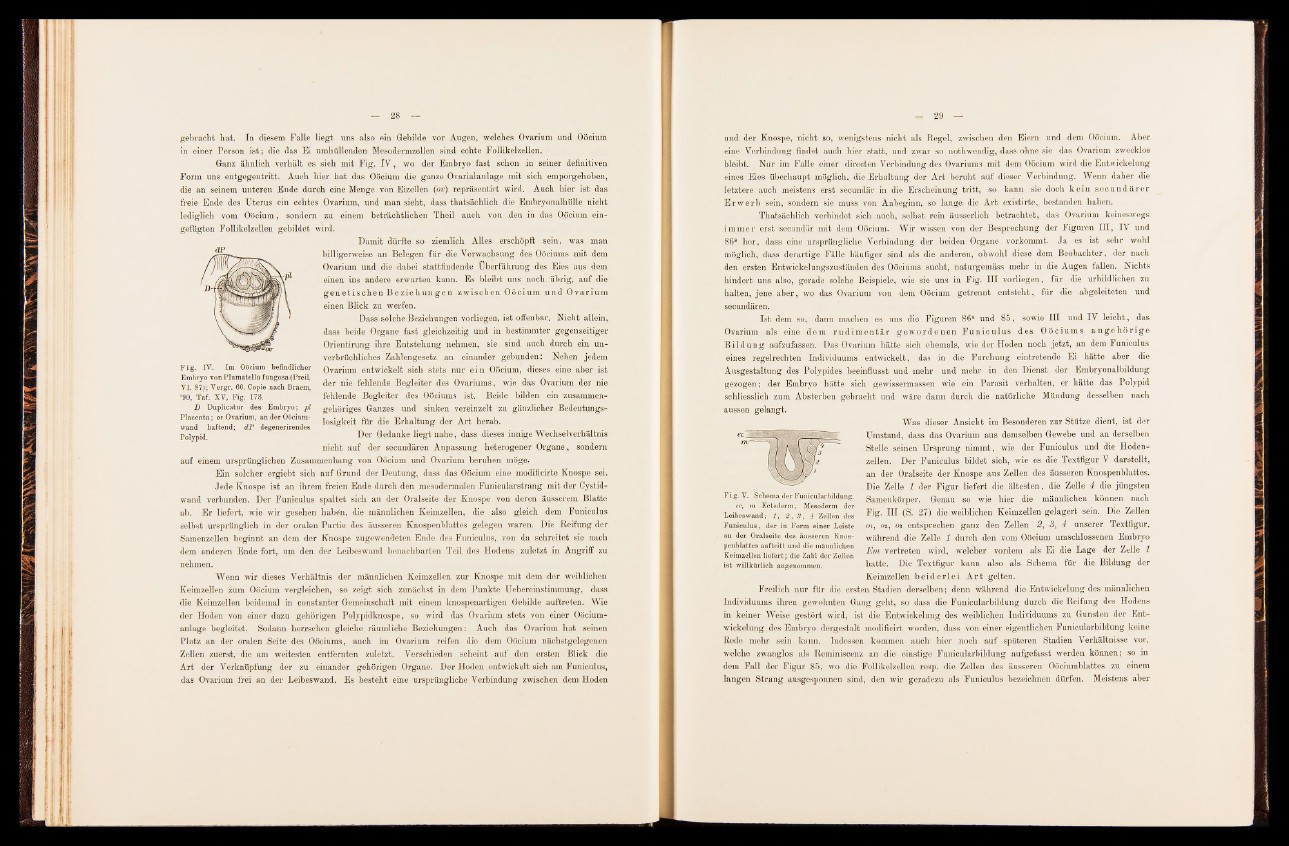
gebracht bat. In diesem Falle liegt uns also ein Gebilde vor Augen, welches Ovarium und Oöcium
in einer Person ist; die das Ei umhüllenden Mesodermzellen sind echte Follikelzellen.
Ganz ähnlich verhält es sich mit Fig. IV , wo der Embryo fast schon in seiner definitiven
Form uns entgegentritt. Auch hier hat das Oöcium die ganze Ovarialanlage mit sich emporgehoben,
die an seinem unteren Ende durch eine Menge von Eizellen (ov) repräsentirt wird. Auch hier ist das
freie Ende des Uterus ein echtes Ovarium, und man sieht, dass thatsächlich die Embryonalhülle nicht
lediglich vom Oöcium, sondern zu einem beträchtlichen Theil auch von den in das Oöcium eingefügten
Follikelzellen gebildet wird.
Damit dürfte so ziemlich Alles erschöpft sein, was man
billigerweise an Belegen für die Verwachsung des Oöciums mit dem
Ovarium und die dabei stattfindende Überführung des Eies aus dem
einen ins andere erwarten kann. Es bleibt uns noch, übrig, auf die
g e n e t is c h e n B e z ie h u n g e n zw isch en Oöcium und Ovarium
einen Blick zu werfen.
Dass solche Beziehungen vorliegen, ist offenbar. Nicht allein,
dass beide Organe fast gleichzeitig und in bestimmter gegenseitiger
Orientirung ihre Entstehung nehmen, sie sind auch durch ein unverbrüchliches
Zahlengesetz an einander gebunden: Neben jedem
Ovarium entwickelt sich stets nur e in Oöcium, dieses eine aber ist
der nie fehlende Begleiter des Ovariums, wie das Ovarium der nie
fehlende Begleiter des Oöciums ist. Beide bilden ein zusammengehöriges
Ganzes und sinken vereinzelt zu gänzlicher Bedeutungslosigkeit
für die Erhaltung der Art herab.
Der Gedanke liegt nahe, dass dieses innige Wechselverhältnis
nicht auf der secundären Anpassung heterogener Organe, sondern
F i g. IV. Im Oöcium befindlicher
Embryo von Plumatella fungosa (Preil,
VJ. 87); Vergr. 60. Copie nach Braem,
’90, Taf. XV, Fig. 173.
D Duplicatur des Embryo; p l
Pla centa ; ov Ovarium, an der Oöcium-
wand haftend; dP degenerirendes
Polypid.
auf einem ursprünglichen Zusammenhang von Oöcium und Ovarium beruhen möge.
Ein solcher ergiebt sich auf Grund der Deutung, dass das Oöcium eine modificirte Knospe sei.
Jede Knospe ist an ihrem freien Ende durch den mesodermalen Funicularstrang mit der Cystid-
wand verbunden. Der Funiculus spaltet sich an der Oralseite der Knospe von deren äusserem Blatte
ab. Er liefert, wie wir gesehen haben, die männlichen Keimzellen, die also gleich dem Funiculus
selbst ursprünglich in der oralen Partie des äusseren Knospenblattes gelegen waren. Die Reifung der
Samenzellen beginnt an dem der Knospe zugewendeten Ende des Funiculus, von da schreitet sie nach
dem anderen Ende fort, um den der Leibeswand benachbarten Teil des Hodens zuletzt in Angriff zu
nehmen.
Wenn wir dieses Verhältnis der männlichen Keimzellen zur Knospe mit dem der weiblichen
Keimzellen zum Oöcium vergleichen, so zeigt sich zunächst in dem Punkte Uebereinstimmung, dass
die Keimzellen beidemal in constanter Gemeinschaft mit einem knospenartigen Gebilde auftreten. Wie
der Hoden von einer dazu gehörigen Polypidknospe, so wird das Ovarium stets von einer Oöciumanlage
begleitet. Sodann herrschen gleiche räumliche Beziehungen: Auch das Ovarium hat seinen
Platz an der oralen Seite des Oöciums, auch im Ovarium reifen die dem Oöcium nächstgelegenen
Zellen zuerst, die am weitesten entfernten zuletzt. Verschieden scheint auf den ersten Blick die
Art der Verknüpfung der zu einander gehörigen Organe. Der Hoden entwickelt sich am Funiculus,
das Ovarium frei an der Leibeswand. Es besteht eine ursprüngliche Verbindung zwischen dem Hoden
und der Knospe, nicht so, wenigstens nicht als Regel, zwischen den Eiern und dem Oöcium. Aber
eine Verbindung findet auch hier statt, und zwar so nothwendig, dass ohne sie das Ovarium zwecklos
bleibt. Nur im Falle einer directen Verbindung des Ovariums mit dem Oöcium wird die Entwickelung
eines Eies überhaupt möglich, die Erhaltung der Art beruht auf dieser Verbindung. Wenn daher die
letztere auch meistens erst secundär in die Erscheinung tritt, so kann sie doch k e in se cu n d ä r e r
E rw e rb sein, sondern sie muss von Anbeginn, so lange die Art existirte, bestanden haben.
Thatsächlich verbindet sich auch, selbst rein äusserlich betrachtet, das Ovarium keineswegs
imm er erst secundär mit dem Oöcium. Wir wissen von der Besprechung der Figuren HI, IV und
86a her, dass eine ursprüngliche Verbindung der beiden Organe vorkommt. Ja es ist sehr wohl
möglich, dass derartige Fälle häufiger sind als die anderen, obwohl diese dem Beobachter, der nach
den ersten Entwickelungszuständen des Oöciums sucht, naturgemäss mehr in die Augen fallen. Nichts
hindert uns also, gerade solche Beispiele, wie sie uns in Fig. III vorliegen, für die urbildlichen zu
halten, jene aber, wo das Ovarium von dem Oöcium getrennt entsteht, für die abgeleiteten und
secundären.
Ist dem so, dann machen es uns die Figuren 86a und 85, sowie HI und IV leicht, das
Ovarium als eine dem r u d im en tä r g ew o rd en en F u n ic u lu s des O ö c ium s a n g e h ö r ig e
B ild u n g aufzufassen. Das Ovarium hätte sich ehemals, wie der Hoden noch jetzt, an dem Funiculus
eines regelrechten Individuums entwickelt, das in die Furchung eintretende Ei hätte aber die
Ausgestaltung des Polypides beeinflusst und mehr und mehr in den Dienst der Embryonalbildung
gezogen; der Embryo hätte sich gewissermassen wie ein Parasit verhalten, er hätte das Polypid
schliesslich zum Absterben gebracht und wäre dann durch die natürliche Mündung desselben nach
aussen gelangt.
Was dieser Ansicht im Besonderen zur Stütze dient, ist der
Umstand, dass das Ovarium aus demselben Gewebe und an derselben
Stelle seinen Ursprung nimmt, wie der Funiculus und die Hodenzellen.
Der Funiculus bildet sich, wie es die Textfigur V darstellt,
an der Oralseite der Knospe aus Zellen des äusseren Knospenblattes.
Die Zelle 1 der Figur liefert die ältesten, die Zelle 4 die jüngsten
Samenkörper. Genau so wie hier die männlichen können nach
Fig. III (S. 27) die weiblichen Keimzellen gelagert sein. Die Zellen
oi, 02, 03 entsprechen ganz den Zellen 2, 3, 4 unserer Textfigur,
während die Zelle 1 durch den vom Oöcium umschlossenen Embryo
Em vertreten wird, welcher vordem als Ei die Lage der Zelle 1
hatte. Die Textfigur kann also als Schema für die Bildung der
Keimzellen b e id e r le i A r t gelten.
F i g. Y. Schema der Funicularbildung.
ec, m Ectoderm, Mesoderm der
Leibeswand; 1, 2 , 3 , 4 Zellen des
Funiculus, der in Form einer Leiste
an der Oralseite des äusseren Knospenblattes
auftritt und die männlichen
Keimzellen lie fert; die Zahl der Zellen
ist willkürlich angenommen.
Freilich nur für die ersten Stadien derselben; denn während die Entwickelung des männlichen
Individuums ihren gewohnten Gang geht, so dass die Funicularbildung durch die Reifung des Hodens
in keiner Weise gestört wird, ist die Entwickelung des weiblichen Individuums zu Gunsten der Entwickelung
des Embryo dergestalt modificirt worden, dass von einer eigentlichen Funicularbildung keine
Rede mehr sein kann. Indessen kommen auch hier noch auf späteren Stadien Verhältnisse vor,
welche zwanglos als Reminiscenz an die einstige Funicularbildung aufgefasst werden können; so in
dem Fall der Figur 85, wo die Follikelzellen resp. die Zellen des äusseren Oöciumblattes zu einem
langen Strang ausgesponnen sind, den wir geradezu als Funiculus bezeichnen dürfen. Meistens aber