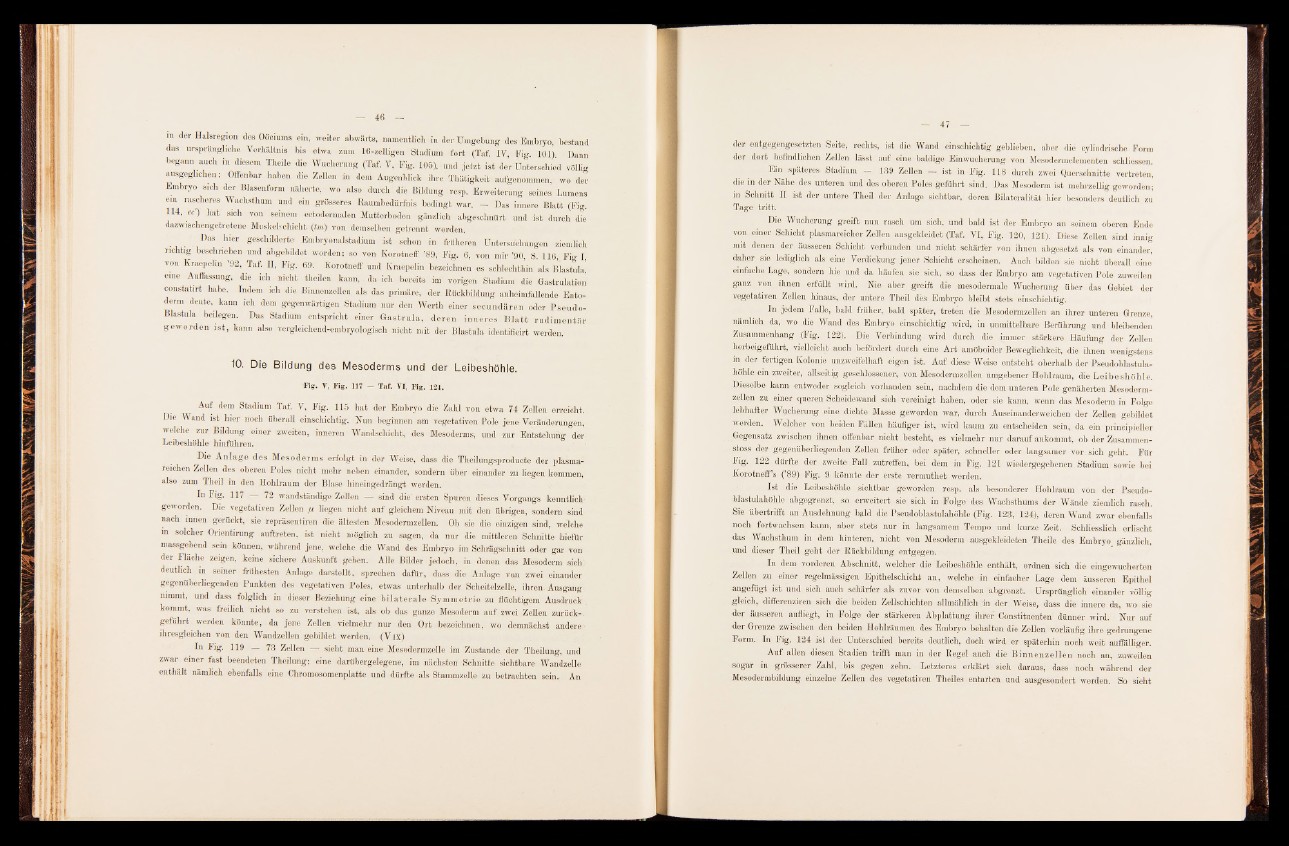
m der Halsregion des Oöciums ein, weiter abwärts, namentlich in der Umgebung des Embryo, bestand
das ursprüngliche Verhältnis bis etwa zum 16-zelligen Stadium fort (Taf. IV, Fig. 101). Dann
begann auch in diesem Theile die Wucherung (Taf. V,' Fig. 105), und jetzt ist der Unterschied völlig
ausgeglichen: Offenbar haben die Zehen in dem Augenblick ihre Thäligkoit aufgenommen,- wo der
Embryo sich der Blasenform näherte, wo also durch die Bildung resp. Erweiterung seines Lumens
ein rascheres Wachsthum und ein grösseres Raumbedürfnis bedingt war. - Das innere Blatt (Fig.
114, ec') hat sich von 'seinem ectodermalen Mutterboden gänzlich abgeschnürt und ist durch die
dazwischengetretene Muskekchicht (tm) von demselben getrennt worden.
Das hier geschilderte Embryonalstadium ist schon in früheren Untersuchungen ziemlich
richtig beschrieben und abgebildet worden; so von Korotneff ’89, Fig. 6, von mir ’90, S. 116, Fig I,
von Kraepelin ’92, Taf. II, Fig. 69. Korotneff und Kraepelin bezeichnen es schlechthin als Blastulai
eine Auffassung, die ich nicht theiien kann, da ich bereits im vorigen Stadium die Gastrulatiön
constatirt habe. Indem ich die Binnenzellen als das primäre, der Rückbildung anheimfallende Entoderm
deute, kann ich dem gegenwärtigen Stadium nur den Werth einer secundären oder P s e u d o i
Blastula beilegen. Das Stadium entspricht einer Gastrula, deren inn eres B la tt rudimentär
g ew ord en is t , kann also vergleichend-embryologisch nicht mit der Blastula identificirt werden.
10. Die Bildung des Mesoderms und der Leibeshöhle.
Fig. V, Fig. 1171 Taf. TI, Fig. 124.
Auf dem Stadium Taf. V, Fig. 115 hat der Embryo die Zahl von etwa 74 Zellen erreicht.
Die Wand ist hier noch überall einschichtig. Nun beginnen am vegetativen Pole jene Veränderungen,
welche zur Bildung einer zweiten, inneren Wandschicht, des Mesoderms, und zur Entstehung der
Leibeshöhle hinführen.
Die A n la g e des Mesoderms erfolgt in der Weise, dass die Theilungsproduiü der plasmä-
reichen Zellen des oberen Poles nicht mehr neben einander, sondern über einander zu liegen kommen,
also zum Theil in den Hohlraum der Blase hineingedrängt werden.
In Fig. 117 4 !, 72 wandständige Zellen sind die ersten Spuren dieses Vorgangs kenntlich'
geworden. Die vegetativen Zellen ft hegen nicht auf gleichem Niveau mit den übrigen, sondern sind
nach innen gerückt, sie repräsentiren die ältesten Mesodermzellen. Ob sie die einzigen sind, welche
m solcher Onentirung auftreten, ist nicht möglich zu sagen, da nur die mittleren Schnitte hiefür
massgebend sein können, während jene, welche die Wand des Embryo im Schrägschnitt oder gar-von
der Fläche zeigen, keine sichere Auskunft geben. Alle Bilder jedoch, in denen das Mesoderm sich:
deutlich in seiner frühesten Anlage darstellt, sprechen dafür, dass die Anlage von zwei einander
gegenüberhegenden Punkten des vegetativen Poles, etwas unterhalb der Seheitelzehe, ihren. Ausgang
nimmt, und dass folghch in dieser Beziehung eine b ila te ra le Symmetrie zu flüchtigem Ausdruck
kommt, was freilich nicht so zu verstehen ist, als ob das ganze Mesoderm auf zwei Zehen zurück-,
geführt werden könnte, da jene Zehen vielmehr nur den Ort -bezeichnen, wo demnächst andere:-
ihresgleichen von den Wandzellen gebildet werden. (V ix)
In Fig. 119 «f- 73 Zehen — sieht man eine Mesodermzehe im Zustande der Theilung, und
zwar einer fast beendeten Theilung; eine darubergelegene, im nächsten Schnitte sichtbare Wandzehe
enthalt nämlich ebenfalls eine Chromosomenplatte und dürfte als Stammzehe zu betrachten sein. An
der entgegengesetzten Seite, rechts, ist die Wand einschichtig geblieben, aber die cylindrische Form
der dort befindlichen Zehen lässt auf eine baldige Einwucherung von Mesodermelementen schliessen.
Em späteres Stadium — 139, Zehen — ist in Fig. 118 durch zwei Querschnitte vertreten,
die in der Nähe des. unteren Und des oberen Poles geführiftsind. Das Mesoderm ist mehrzellig geworden;
m Schnitt H ist der untere Theil der Anlage sichtbar, deren Bilateralität hier besonders deutlich zu
Tage tritt.
Die Wucherung greift nun rasch um sich, und bald ist der Embryo an seinem oberen Ende
Von einer Schicht plasmareicher Zellen ausgekleidet (Taf. VI, Fig. 120, 121). Diese Zehen sind innig
mit denen der äusseren Schicht verbunden und nicht schärfer von ihnen abgesetzt als von einander,
daher sie lediglich als eine Verdickung jener Schicht erscheinen. Auch bilden sie nicht überall eine
einfache Lage, sondern hie und da häufen sie sich, so dass der Embryo am vegetativen Pole zuweilen
ganz von ihnen erfüllt wird. Nie aber greift die mesodermale Wucherung über das Gebiet der
vegetativen Zehen hinaus, der untere Theil des. Embryo bleiht stets einschichtig.
In jedem FaUe, bald früher, bald später, treten die Mesodermzehen an, ihrer unteren Grenze,
nämlich da, wo die Wand des Embryo einschichtig wird, in unmittelbare Berührung und bleibenden
Zusammenhang (Fig. 122). Die Verbindung wird durch die „immer stärkere Häufung der Zehen
herbeigeführt, vielleicht auch befördert durch eine Art amöboider Beweglichkeit, die ihnen wenigstens
m der fertigen Kolonie unzweifelhaft eigen ist. Auf diese Weise entsteht oberhalb der Pseudoblastula-
Mhlprein zweiter, abseitig geschlossener, von Mesodermzelten umgebener Hbhlraum, die L eib e sh öh le .
Dieselbe kann entweder sogleich vorhanden sein, nachdem die dem unteren Pole genäherten Mesoderm-
zellen zu_einer queren Scheidewand sich:vereinigt haben, sader, sie kann, wenn das Mesoderm in Folge
lebhafter Wucherung eine dichte Masse geworden war, durch Auseinanderweichen der Zehen gebildet
werden. Welcher von beiden Fähen häufiger ist, wird kaum entscheiden sein, da ein principieher
Gegensatz zwischen ihnen offenbar nicht besteht, es vielmehr nur darauf ankommt, ob der Zusammen-
jf eÄ 4er gegenüberliegenden Zehen früher oder, später, schneher oder langsamer vor. sich geht. Für
Ä h 122 dürfte der zweite Fah zutreffen; hei dem in Fig. 121 wiedergegebenen Stadium sowie bei
Korotneff ^ ( ’89) Fig. ft-,könnte .der erste, vermuthet werden.
Ist die Leibeshöhle sichtbar geworden, resp, als besonderer Hohlraum von der Pseudo-
blastulahöWe abgegrenzt, so erweitert sie sich in Folge des Wachsthums der Wände ziemlich rasch.
Sie übertrifft an Ausdehnung bald die Pseudoblastulahöhle (Fig. 123,124), deren Wand zwar ebenfalls
noch fortwachsen kann, aber stets nur in langsamem Tempo und kurze Zeit. Schliesslich erlischt
das Wachsthum in dem hinteren, nicht von Mesoderm ausgekleideten Theile des Embryo gänzlich,
.und dieser Theü geht der Rückbildung entgegen.
In dem vorderen Abschnitt, welcher die Leibeshöhle. enthält, ordnen sich die eingewucherten
Zellen, zu einer regelmässigen Epithelschiehi an, welche du einfacher Lage dem äusseren Epithel
angefügt ist und sich auch schärfer als. zuvor von demselben abgrenzt. Ursprünglich einander völlig
gleich, differenziren sich-die beiden Zellschichten allmählich-in der "Weise, dass die innere da, wo.sie
der äusseren aufliegt, in Folge, der stärkeren Abplattung ihrer . Constituenten dünner wird. Nur auf
der Grenze zwischen den beiden Hohlräumen des Embryo behalten die Zellen- vorläufig ihre gedrungene
Form. In Fig. 124 ist der Unterschied bereits deutlich, doch wird er späterhin noch weit auffällio-er.
Auf allen diesen Stadien trifft man in der. Regel auch die B in n en z e llen noch an, zuweilen
sogar in grösserer Zahl, bis gegen zehn. Letzteres, erklärt sich daraus, dass noch während der
Mesodermbildung einzelne Zellen des vegetativen Theiles entarten und ausgesondert werden. So sieht