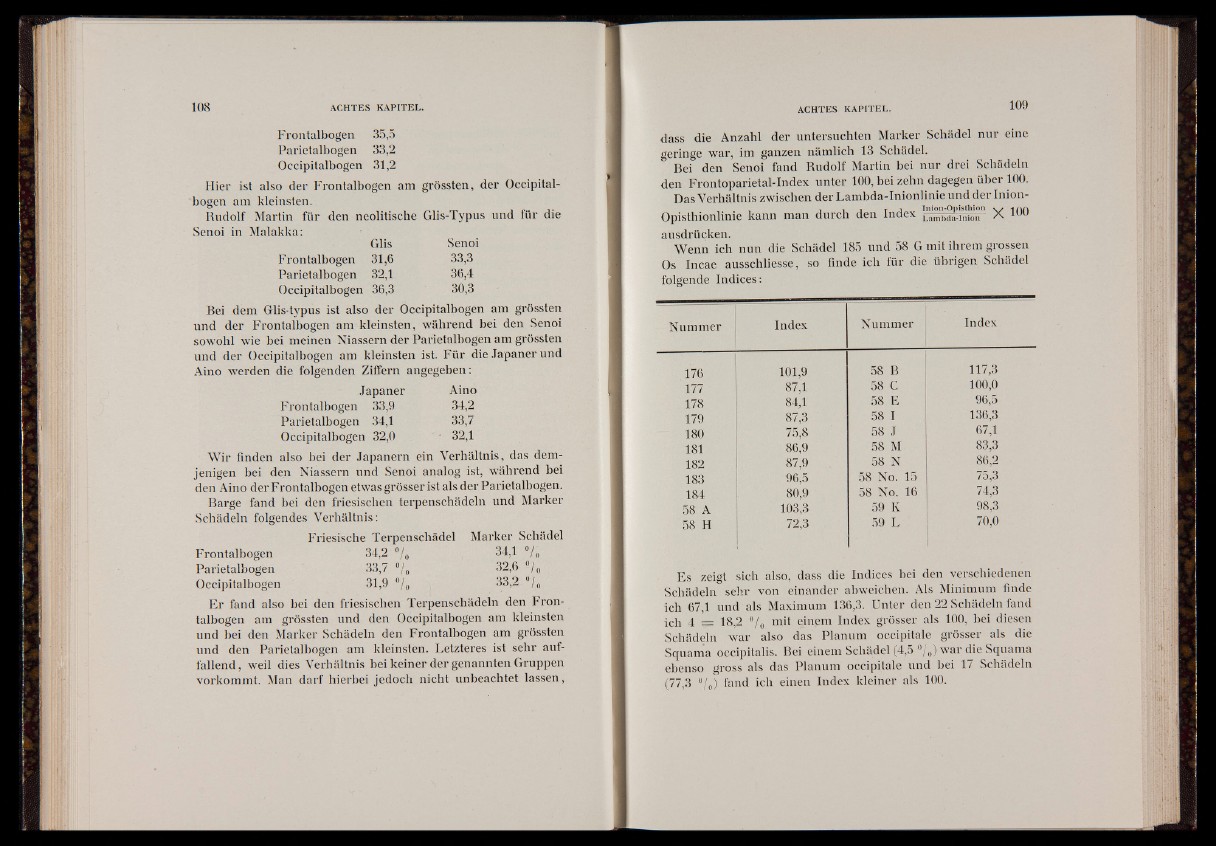
Frontalbogen 35,5
Parietalbogen 33,2
Occipitalbogen 31,2
Hier ist also der Frontalbogen am grössten, der Occipitalbogen
am kleinsten.
Rudolf Martin für den neolitische Glis-Typus und für die
Senoi in Malakka:
Glis Senoi
Frontalbogen 31,6 33,3
Parietalbogen 32,1 36,4
Occipitalbogen 36,3 30,3
Bei dem Glis-typus ist also der Occipitalbogen am grössten
und der Frontalbogen am kleinsten, während bei den Senoi
sowohl wie bei meinen Niassern der Parietalbogen am grössten
und der Occipitalbogen am kleinsten ist. F ü r die Japaner und
Aino werden die folgenden Ziffern angegeben:
Japaner Aino
Frontalbogen 33,9 34,2
Parietalbogen 34,1 33,7
Occipitalbogen 32,0 • 32,1
W ir finden also bei der Japanern ein Verhältnis, das demjenigen
bei den Niassern und Senoi analog ist, während bei
den Aino der Frontalbogen etwas grösser ist als der Parietalbogen.
Barge fand bei den friesischen terpenschädeln u nd Marker
Schädeln folgendes Verhältnis:
Friesische Terpenschädel Marker Schädel
Frontalbogen 34,2 °/0 34,1 °/o
Parietalbogen 33,7 ö/ 0 32,6 -/„
Occipitalbogen 31,9 °/0 33,2 ° /0
E r fand also bei den friesischen Terpenschädeln den F ro n talbogen
am grössten und den Occipitalbogen am kleinsten
und bei den Marker Schädeln den Frontalbogen am grössten
und den Parietalbogen am kleinsten. Letzteres ist sehr auffallend
, weil dies Verhältnis bei keiner d er genannten Gruppen
vorkommt. Man d arf hierbei jedoch nicht unbeachtet lassen,
dass die Anzahl der untersuchten Marker Schädel n u r eine
geringe war, im ganzen nämlich 13 Schädel.
Bei den Senoi fand Rudolf Martin bei n u r drei Schädeln
den Frontoparietal-Index u n te r 100, bei zehn dagegen über 100.
Das Verhältnis zwischen der Lambda-Inionlinie und der Inion-
Opisthionlinie kann man durch den Index ^ t1°nb'^ .’Is1^ ° " X 100
ausdrücken.
Wenn ich n un die Schädel 185 und 58 G mit ihrem grossen
Os Incae ausschliesse, so finde ich für die übrigen Schädel
folgende Indices:
Nummer Index Nummer Index
176 101,9 58 B 117,3
177 87,1 58 C 100,0
178 84,1 58 E 96,5
179 87,3 58 I 136,3
180 75,8 58 J 67,1
181 86,9 58 M 83,3
182 87,9 58 N 86,2
183 96,5 58 No. 15 75,3
184 80,9 58 No. 16 74,3
58 A 103,3 59 K 98,3
58 H 72,3 59 L 70,0
Es zeigt sich also, dass die Indices bei den verschiedenen
Schädeln sehr von einander abweichen. Als Minimum finde
ich 67,1 und als Maximum 136,3. Unter den 22 Schädeln fand
ich 4 = 4 18,2 °/o mit einem Index grösser als 100, bei diesen
Schädeln war also das Planum occipitale grösser als die
Squama occipitalis. Bei einem Schädel (4,5 °/0) war die Squama
ebenso gross als das Planum occipitale und bei 17 Schädeln
(77,3 °/0) fand ich einen Index kleiner als 100.