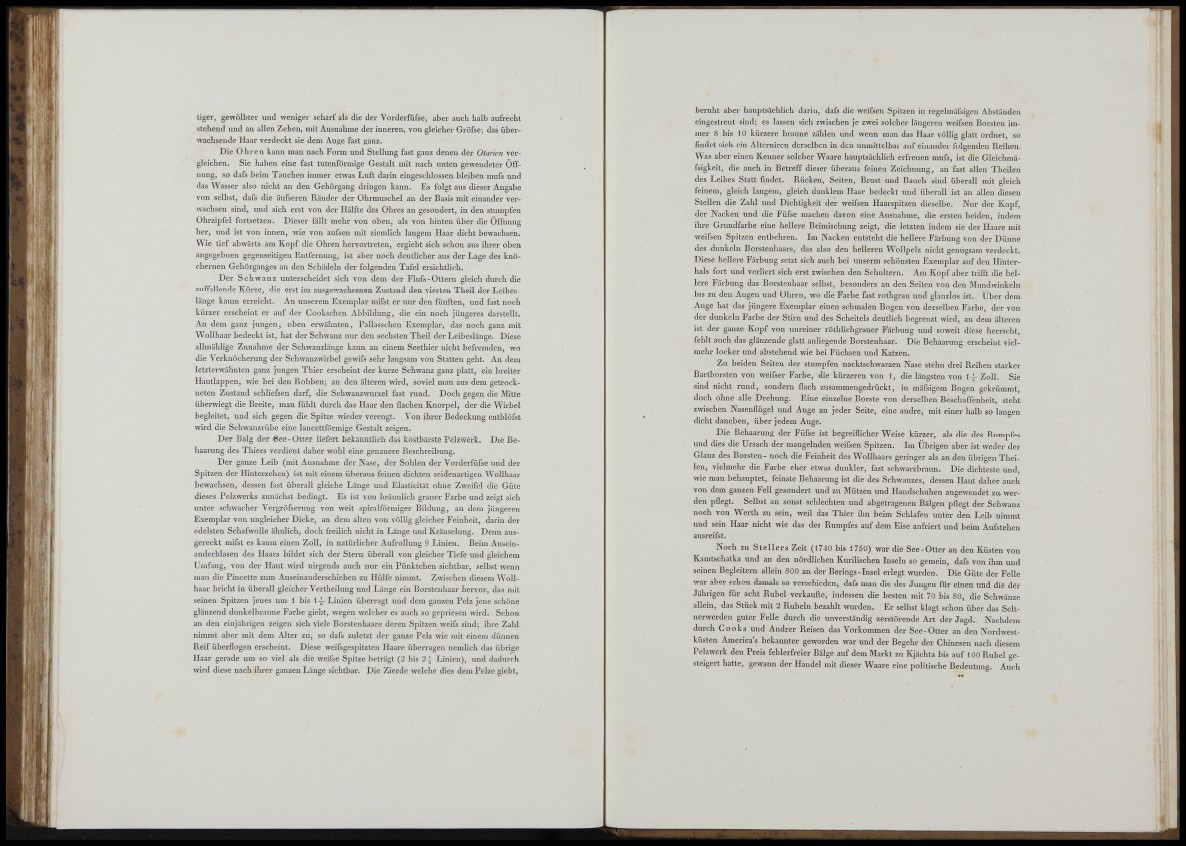
I' m
i i
liger, gewölbter und weniger schari als die der Vorderfüfse, aber auch halb aufrecht
stehend und an allen Zehen, mit Ausnahme der inneren, von gleicher Gröfse; das überwachsende
Haar verdecit sie dem Auge fast ganz.
Die Ohren kann man nach Form und Stellung fast ganz denen der Olarien vergleichen.
Sie haben eine fast tutenförmige Gestalt mit nach unten gewendeter Öffnung,
so dafs beim Tauchen immer etwas Luft darin eingeschlossen bleiben mufs und
das Wasser also nicht an den Gehörgang dringen kann. Es folgt aus dieser Angabe
von selbst, dafs die äufseren Ränder der Ohrmuschel an der Basis mit einander verwachsen
sind, und sich erst von der Hälfte des Ohres an gesondert, in den stumpfen
Ohrzipfel fortsetzen. Dieser fällt mehr von oben, als von hinten über die Öffnung
her, und ist von innen, wie von aufsen mit ziemlich langem Haar dicht bewachsen.
Wie tief abwärts am Kopf die Ohren hervortreten, ergiebt sich schon aus ihrer oben
angegebnen gegenseitigen Entfernung, ist aber noch deutlicher aus der Lage des knöchernen
Gehörganges an den Schädeln der folgenden Tafel ersichtlich.
Der Schwanz unterscheidet sich von dem der Flufs-Ottern gleich durch die
auffallende Kürze, die erst im ausgewachsenen Zustand den vierten Theil der Leibeslänge
kaum erreicht. An unserem Exemplar mifst er nur den fünften, und fast noch
kürzer erscheint er auf der Cooksehen Abbildung, die ein noch jüngeres darstellt.
An dem ganz jungen, oben erwähnten, Pallasschen Exemplar, das noch ganz mit
Wollhaar bedeckt ist, hat der Schwanz mu' den sechsten Theil der Leibeslänge. Diese
allmählige Zunahme der Schwanzlänge kann an einem Seethier nicht befremden, wo
die Verknöcherung der Schwanzwirbel gewifs sehr langsam von Statten geht. An dem
letzterwähnten ganz jungen Thier erscheint der kurze Schwanz ganz platt, ein breiter
Hautlappen, wie bei den Robben; an den älteren wird, soviel man aus dem getrockneten
Zustand schliefsen darf, die Schwanzvnirzel fast rund. Doch gegen die Mitte
überwiegt die Breite, man fühlt durch das Haar den flachen Knorpel, der die Wirbel
begleitet, und sich gegen die Spitze wieder verengt. Von ihrer Bedeckung entblöfst
wird die Schwanzrübe eine lancettförmige Gestalt zeigen.
Der Balg der ßee-Otter liefert bekanntlich das kostbarste Pelzwerk. Die Behaarung
des Thiers verdient daher wohl eine genauere Beschreibung.
Der ganze Leib (mit Ausnahme der Nase, der Sohlen der Vorderfüfse und der
Spitzen der Hinterzehen) ist mit einem überaus feinen dichten seidenartigen Wollhaar
bewachsen, dessen fast überall gleiche Länge und Elasticität ohne Zweifel die Güte
dieses Pelzwerks zunächst bedingt. Es ist von bräunlich grauer Farbe und zeigt sich
unter schwacher Vergröfserung von weit spiralförmiger Bildung, an dem jüngeren
Exemplar von ungleicher Dicke, an dem alten von völlig gleicher Feinheit, darin der
edelsten Schafwolle ähnlich, doch freilich nicht in Länge und Kräuselung. Denn ausgereckt
mifst es kaum einen Zoll, in natürlicher Aufrollung 9 Linien. Beim Auseinanderblasen
des Haars bildet sich der Stern überall von gleicher Tiefe und gleichem
Umfang, von der Haut wird nirgends auch nur ein Pünktchen sichtbar, selbst wenn
man die Pincette zum Auseinanderschieben zu Hülfe nimmt. Zwischen diesem Wollhaar
bricht in überall gleicher Vertheilung und Länge ein Borstenhaar hervor, das mit
seinen Spitzen jenes um 1 bis l-i- Linien überragt und dem ganzen Pelz jene schöne
glänzend dunkelbraune Farbe giebt, wegen welcher es auch so gepriesen wird. Schon
an den einjährigen zeigen sich viele Borstenhaare deren Spitzen weifs sind; ihre Zahl
nimmt aber mit dem Alter zu, so dafs zuletzt der ganze Pelz wie mit einem dünnen
Reif überflogen erscheint. Diese weifsgespitzten Haare überragen nemlich das übrige
Haar gerade um so viel als die weifse Spitze beträgt (2 bis Linien), und dadurch
wird diese nach ihrer ganzen Länge sichtbar. Die Zierde welche dies dem Pelze giebt,
beruht aber hauptsächlich darin, dafs die weifsen Spitzen in regelmäfsigen Abständen
eingestreut sind; es lassen sich zwischen je zwei solcher längeren weifsen Borsten immer
8 bis 10 kürzere braune zählen und wenn man das Haar völlig glatt ordnet, so
findet sich ein Aiterniren derselben in den unmittelbar auf einander folgenden Reihen.
Was aber einen Kenner solcher Waare hauptsächlich erfreuen mufs, ist die Gleichmäfsigkeit,
die auch in Betreff dieser überaus feineu Zeichnung, an fast allen Theilen
des Leibes Statt findet. Rücken, Seiten, Brust und Bauch sind überall mit gleich
feinem, gleich langem, gleich dunklem Haar bedeckt und überall ist an allen diesen
Stellen die Zahl und Dichtigkeit der weifsen Haarspitzen dieselbe. Nur der Kopf,
der Nacken und die Füfse machen davon eine Ausnahme, die ersten beiden, indem
ihre Grundfarbe eine hellere Beimischung zeigt, die letzten indem sie der Haare mit
weifsen Spitzen entbehren. Im Nacken entsteht die hellere Färbung von der Dünne
des dunkeln Borstenhaars, das also den helleren Wollpelz nicht genugsam verdeckt.
Diese hellere Färbung setzt sich auch bei unserm schönsten Exemplar auf den Hinterhals
fort und verliert sich erst zwischen den Schultern. Am Kopf aber trifft die hellere
Färbung das Borstenhaar selbst, besonders an den Seiten von den Mundwinkeln
bis zu den Augen und Ohren, wo die Farbe fast rothgrau und glanzlos ist. Über dem
Auge hat das jüngere Exemplar einen schmalen Bogen von derselben Farbe, der von
der dunkeln Farbe der Stirn und des Scheitels deutlich begrenzt wird, an dem älteren
ist der ganze Kopf von unreiner röthlichgrauer Färbung und soweit diese herrscht,
fehlt auch das glänzende glatt anliegende Borstenhaar. Die Behaarung erscheint vielmehr
locker und abstehend wie bei Füchsen und Katzen.
Zu beiden Seiten der stumpfen nacktschwarzen Nase stehn drei Reihen starker
Bartborsten von weifser Farbe, die kürzeren von i, die längsten von Zoll. Sie
sind nicht rund, sondern flach zusammengedrückt, in mäfsigem Bogen gekrümmt,
doch ohne alle Drehung. Eine einzelne Borste von derselben Beschaffenheit, steht
zwischen Nasenflügel und Auge an jeder Seite, eine andre, mit einer halb so langen
dicht daneben, über jedem Auge.
Die Behaarung der Füfse ist begreiflicher Weise kürzer, als die des Rumpfes
und dies die Ursach der mangelnden weifsen Spitzen. Im Übrigen aber ist weder der
Glanz des Borsten - noch die Feinheit des Wollhaars geringer als an den übrigen Theilen,
vielmehr die Farbe eher etwas dunkler, fast schwarzbraun. Die dichteste und,
wie man behauptet, feinste Behaarung ist die des Schwanzes, dessen Haut daher auch
von dem ganzen Fell gesondert und zu Mützen und Handschuhen angewendet zu. werden
pflegt. Selbst an sonst schlechten und abgetrageneu Bälgen pflegt der Schwanz
noch von Werth zu sein, weil das Thier ihn beim Schlafen unter den Leib nimmt
und sein Haar nicht wie das des Rumpfes auf dem Eise anfriert und beim Aufstehen
ausreifst.
Noch zu Stellers Zeit (1740 bis 1760) war die See-Otter an den Küsten von
Kamtschatka und an den nördlichen Kurilischen Inseln so gemein, dafs von ihm und
seinen Begleitern allein 800 an der Berings-Insel erlegt wurden. Die Güte der Felle
war aber schon damals SO verscliieden, dafs man die der Juugen für einen und die der
Jährigen für acht Rubel verkaufte, indessen die besten mit 70 bis SO, die Schwänze
allein, das Stück mit 2 Rubeln bezahlt wurden. Er selbst klagt schon über das Seltnerwerden
guter Felle durch die unverständig zerstörende Art der Jagd., Nachdem
durch Cooks und Andrer Reisen das Vorkommen der See-Otter an den Nordwestküsten
America's bekannter geworden war und der Begehr der Chinesen nach diesem
Pelzwerk den Preis fehlerfreier Bälge auf dem Markt zu Kjächta bis auf 100 Rubel gesteigert
hatte, gewann der Handel mit dieser Waare eine politische Bedeutung. Auch