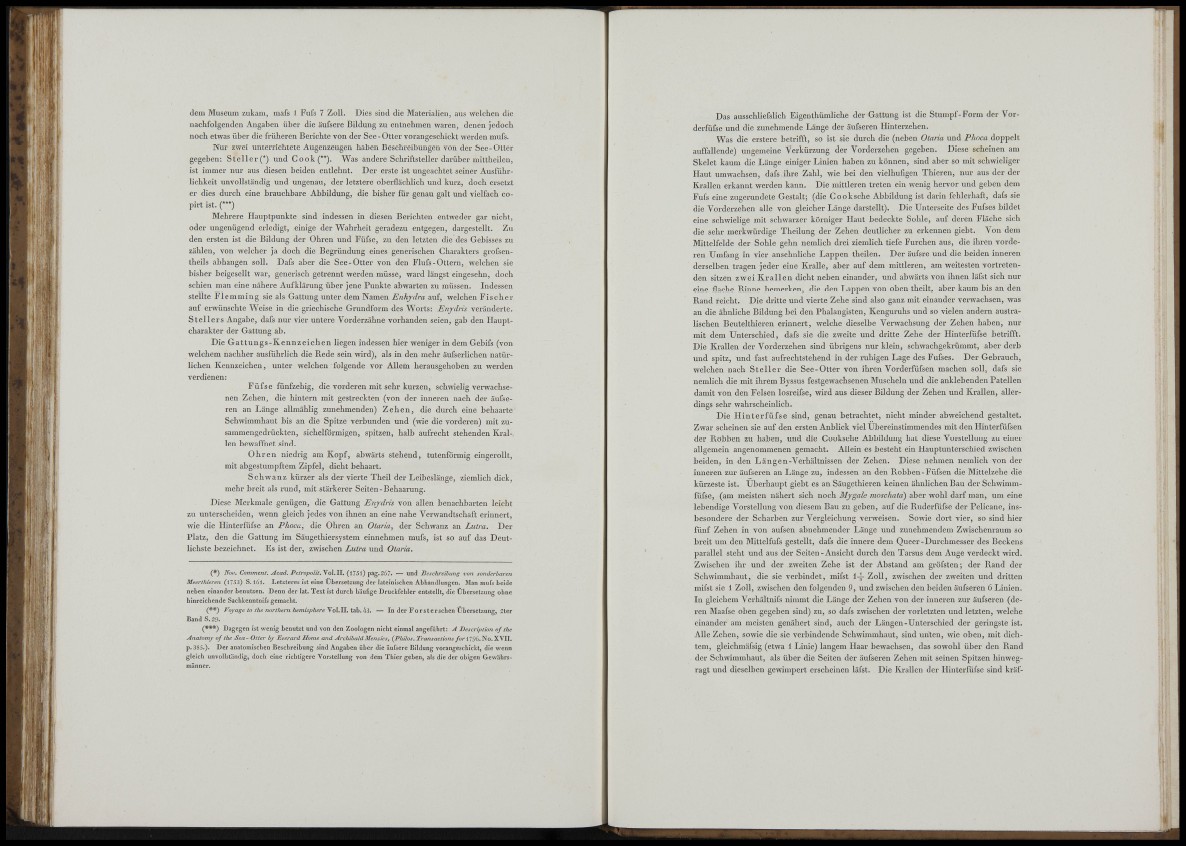
dem Museum zukam, mals l Fufs 7 Zoll. Dies sind die Materialien, aus welchen die
nachColgcnden Angaben über die äufsere Bildung zu entnehmen waren, denen jedoch
noch etwas über die früheren Bei-ichte von der See-Otter vorangeschickt werden mufs.
Nur zwei unterrichtete Augenzeugen haben Beschreibungen von der See-Otter
gegeben: S t e l l e r ( * ) und Co o k ( * * ) . Was andere Schriftsteller darüber mittheilen,
ist immer nur aus diesen beiden entlehnt. Der erste ist ungeachtet seiner Ausführlichkeit
unvollständig und ungenau, der letztere oberflächlich und kurz, doch ersetzt
er dies durch eine brauchbare Abbildung, die bisher für genau galt und vielfach copirt
ist. f " )
Mehrere Hauptpunkte sind indessen in diesen Berichten entweder gar nicht,
oder ungenügend erledigt, einige der Wahrheit geradezu entgegen, dargestellt. Zu
den ersten ist die Bildung der Ohren und Füfse, zu den letzten die des Gebisses zu
zählen, von welcher ja doch die Begründung eines generischen Charakters grofsentheils
abhangen soll. Dafs aber die See-Otter von den Flufs-Ottern, welchen sie
bisher beigesellt war, generisch getrennt werden müsse, ward längst eingesehn, doch
schien man eine nähere Aufklärung über jene Punkte abwarten zu müssen. Indessen
stellte F l emmi n g sie als Galtung unter dem Namen Enhydra auf, welchen F i s c h e r
auf erwünschte Weise in die griechische Grundform des Worts: Enjdris veränderte.
S t e l l e r s Angabe, dafs nur vier untere Vorderzähne vorhanden seien, gab den Hauptcharakter
der Gattung ab.
Die G a t t u n g s - K e n n z e i c h e n liegen indessen hier weniger in dem Gebifs (von
welchem nachher ausführlich die Rede sein wird), als in den mehr äufserlichen natürlichen
Kennzeichen, unter welchen folgende vor Allein herausgehoben zu werden
verdienen:
F ü f s e fünfzehig, die vorderen mit sehr kurzen, schwielig verwachsenen
Zehen, die hintern mit gestreckten (von der inneren nach der äufseren
an Länge allmählig zunehmenden) Z e h e n , die durch eine behaarte
Schwimmhaut bis an die Spitze verbunden und (wie die vorderen) mit zusammengedrückten,
sichelförmigen, spitzen, halb aufrecht stehenden Krallen
bewaffnet sind.
Oh r e n niedrig am Ko p f , abwärts stehend, tutenförmig eingerollt,
mit abgestumpftem Zipfel, dicht behaart.
S c hwa n z kürzer als der vierte Theil der Leibeslänge, ziemlich dick,
mehr breit als rimd, mit stärkerer Seiten-Behaarung.
Diese Merkmale genügen, die Gattung Enjdris von allen benachbarten leicht
zu unterscheiden, wenn gleich Jedes von ihnen an eine nahe Verwandtschaft erinnert,
wie die Hinterfüfse an Phoca, die Ohren an Otaria, der Schwanz an Lulra. Der
Platz, den die Gattung im Säugethiersystem einnehmen mufs, ist so auf das Deutlichste
bezeichnet. Es ist der, zvrischen Lulra und Otaria.
(*) JVof. Comment. Acad. PetropolU.^oX.M. (I75l) pag.267. — und Beschreibung von sonderbaren
Meerlhieren (1753) S. I6i. Letzteres ist eine Ül)erselzung der lateinischen Abhandlungen. Man mufs beide
neben einander benutzen. Denn der lat. Text ist durch häufige Druckfehler entstellt, die Übersetzung ohne
hinreichende Sachkenntnifs gemacht.
(**) P^ofage io ike northern hemisphere Yol.lL tah.As. — In der Forsterscben Übersetzung, 2ter
Band S .29.
( * * * ) Dagegen ist wenig benutzt und von den Zoologen nicht einmal angeführ t : A Description of the
Anatomy of the Sea-Otter by Everard Home and Archibald Menzies, (Phiios. Transactions /o/-1796. No. XVII.
p. 385.). De r anatomischen Beschreibung sind Angaben über die äufsere Bildung vorangeschickt, die wenn
gleich unvollständig, doch eine richtigere Vorstellung von dem Thier geben, als die der obigen Gewähr s -
männer.
Das ausschliefslich Eigenthümliche der Gattung ist die Stumpf -Form der Vorderfüfse
und die zunehmende Länge der äufseren Hinterzehen.
Was die erstere betrifft, so ist sie durch die (neben Olaria und Phoca doppelt
auffallende) ungemeine Verkürzung der Vorderzehen gegeben. Diese scheinen am
Skelet kaum die Länge einiger Linien haben zu können, sind aber so mit schwieliger
Haut umwachsen, dafs. ihre Zahl, wie bei den vielhufigen Thieren, nur aus der der
Krallen erkannt werden kann. Die mittleren treten ein wenig hervor und geben dem
Fufs eine zugerundete Gestalt; (die Co o k s che Abbildung ist darin fehlerhaft, dafs sie
die Vorderzehen alle von gleicher Länge darstellt). Die Unterseite des Fufses bildet
eine schwielige mit schwarzer körniger Haut bedeckte Sohle, auf deren Fläche sich
die sehr merkwürdige Theilung der Zehen deutlicher zu erkennen giebt. Von dem
Mittelfelde der Sohle gehn uemlich drei ziemlich tiefe Furchen aus, die ihren vorderen
Umfang in vier ansehnliche Lappen theilen. Der äufsre und die beiden inneren
derselben tragen jeder eine Kralle, aber auf dem mittleren, am weitesten vortretenden
sitzen zwe i K r a l l e n dicht neben einander, und abwärts von ihnen läfst sich nur
eine flache Rinne bemerken, die den Lappen von oben theilt, aber kaum bis an den
Rand reicht. Die dritte und vierte Zehe sind also ganz mit einander verwachsen, was
an die ähnliche Bildung bei den Phalangisten, Kenguruhs und so vielen andern australischen
Beutelthieren erinnert, welche dieselbe Verwachsung der Zehen haben, nur
mit dem Unterschied, dafs sie die zweite und dritte Zehe der Hinterfüfse betrifft.
Die Krallen der Vorderzehen sind übrigens nur klein, schwachgekrümmt, aber derb
und spitz, und fast aufreehtstehend in der ruhigen Lage des Fufses. Der Gebrauch,
welchen nach S t e l l e r die See-Ot ter von ihren Vorderfüfsen machen soll, dafs sie
nemlich die mit ihrem Byssus festgewachsenen Muscheln und die anklebenden Patellen
damit von den Felsen losreifse, wird aus dieser Bildung der Zehen und Krallen, allerdings
sehr wahrscheinlich.
Die Hi n t e r f ü f s e sind, genau betrachtet, nicht minder abweichend gestaltet.
Zwar scheinen sie auf den ersten Anblick viel Ubereinstimmendes mit den Hinterfüfsen
der Robben zu haben, und die Cooksche Abbildung hat diese Vorstellung zu einer
allgemein angenommenen gemacht. Allein es besteht ein Hauptunterschied zwischen
beiden, in den Längen-Verhältnissen der Zehen. Diese nehmen nemlich von der
inneren zur äufseren an Länge zu, indessen an den Robben-Füf sen die Mittelzehe die
kürzeste ist. Überhaupt giebt es an Säugethieren keinen ähnlichen Bau der Schwimmfüfse,
(am meisten nähert sich noch Mygale moschalci) aber wohl darf man, um eine
lebendige Vorstellung von diesem Bau zu geben, auf die Ruderfüfse der Pelicane, insbesondere
der Scharben zur Vergleichung verweisen. Sowie dort vier, so sind hier
fünf Zehen in von aufsen abnehmender Länge und zunehmendem Zwischenraum so
breit um den Mittelfufs gestellt, dafs die innere dem Queer-Durchmesser des Beckens
parallel steht und aus der Seiten - Ansicht durch den Tarsus dem Auge verdeckt wird.
Zwischen ihr und der zweiten Zehe ist der Abstand am gröfsten; der Rand der
Schwimmhaut, die sie verbindet, mifst Zol l , zwischen der zweiten und dritten
inifst sie 1 Zoll, zwischen den folgenden 9, und zwischen den beiden äufseren 6 Linien.
In gleichem Verhältnifs nimmt die Länge der Zehen von der inneren zur äufseren (deren
Maafsc oben gegeben sind) zu, so dafs zwischen der vorletzten und letzten, welche
einander am meisten genähert sind, auch der Längen-Unterschied der geringste ist.
Alle Zehen, sowie die sie verbindende Schwimmhaut, sind unten, wie oben, mit diclitem,
gleichmäfsig (etwa 1 Linie) langem Haar bewachsen, das sowohl über den Rand
der Schwimmhaut, als über die Seiten der äufseren Zehen mit seinen Spitzen hinwegragt
und dieselben gewimpert erscheinen läfst. Die Krallen der Hinterfüfse sind kräf