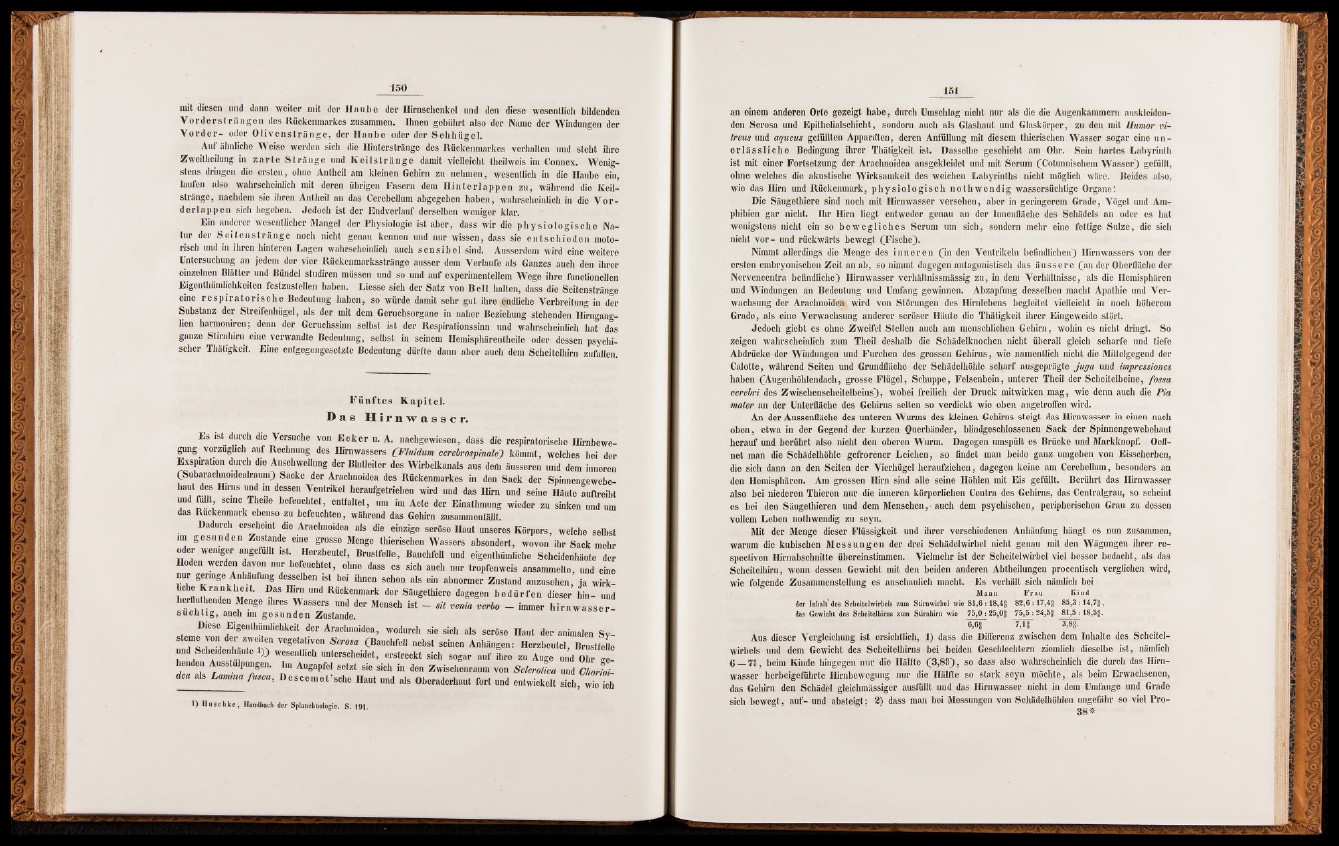
mit diesen und dann weiter mit der Haube der Hirnschenkel und den diese wesentlich bildenden
Vor der st rängen des Rückenmarkes zusammen. Ihnen gebührt also der Name der Windungen der
V order- oder O livenstränge, der Haube oder der Sehhügel.
Auf ähnliche Weise werden sich die Hinterstränge des Rückenmarkes verhalten und steht ihre
Zweitheilung in zarte Stränge und K eilstränge damit vielleicht theilweis im Connex. Wenigstens
dringen die ersten, ohne Anlheil am kleinen Gehirn zu nehmen, wesentlich in die Haube ein,
laufen also wahrscheinlich mit deren übrigen Fasern dem H interlappen zu, Während die Keilstränge,
nachdem sie ihren Antheil an das Cerebellum abgegeben haben, wahrscheinlich in die V orderlappen
sich begeben. Jedoch ist der Endverlauf derselben weniger klar.
Ein anderer wesentlicher Mangel der Physiologie ist aber, dass wir die physiologische Natur
der Seiten stränge noch nicht genau kennen und nur wissen, dass sie entschieden motorisch
und in ihren hinteren Lagen wahrscheinlich auch sensibel sind. Ausserdem wird eine weitere
Untersuchung an jedem der vier Rückenmarksstränge ausser dem Verlaufe als Ganzes auch den ihrer
einzelnen Blätter und Bündel studiren müssen und so und auf experimentellem Wege ihre functionellen
Eigenthümlichkeiten festzusleUen haben. Liesse sich der Satz von Bell halten, dass die Seitenstränge
eine respiratorische Bedeutung haben, so würde damit sehr gut ihre endliche Verbreitung in der
Substanz der Streifenhügel, als der mit dem Geruchsorgane in naher Beziehung stehenden Hirnganglien
harmoniren; denn der Geruchssinn selbst ist der Respirationssinn und wahrscheinlich hat das
ganze Stirnhirn eine verwandte Bedeutung, selbst in seinem Hemisphärentheile oder dessen psychischer
Thätigkeif. Eine entgegengesetzte Bedeutung dürfte dann aber auch dem Scheitelhirn zufallen.
Fünftes Kapitel.
D as Hi r nw a s s e r .
Es ist durch die Versuche von E cker u. A. nachgewiesen, dass die respiratorische Hirnbewegung
vorzüglich auf Rechnung des Hirnwassers Ct'luidum cerebrospinalej kömmt, welches bei der
Exspiration durch die Anschwellung der Blutleiter des Wirbelkanals aus dem äusseren und dem inneren
(Subaracknoidealraum) Sacke der Arachnoidea des Rückenmarkes in den Sack der Spinnengewebehaut
des Hirns und in dessen Ventrikel heraufgetrieben wird und das Hirn und seine Häute auftreibt
und füllt, seine Thede befeuchtet, entfaltet, um im Acte der Einathmung wieder zu sinken und um
das Rückenmark ebenso zu befeuchten, während das Gehirn zusammenfällt.
Dadurch erschemt die Arachnoidea als die einzige seröse Haut unseres Körpers, welche selbst
im gesunden Zustande eme grosse Menge Ihierischen Wassers absondert, wovon ihr Sack mehr
oder weniger angefüllt ist. Herzbeutel, Brustfelle, Bauchfell und eigenthümliche Scheidenhäute der
Hoden werden davon nur befeuchtet, ohne dass es sich auch nur tropfenweis ansammelte, und eine
nur geringe Anhäufung desselben ist bei ihnen schon als ein abnormer Zustand anzusehen, ja wirk-
' ' " ‘ f Das Rückenmark der Säugethiere dagegen bedürfen dieser hin- „nd
herfluthenden Menge ihres Wassers und der Mensch ist - sit venia verbo süchtig, auch im gesunden Zustande. - immer hirnw asser-
Diese Eigenlhümlichkeit der Arachnoidea, wodurch sie sich als seröse Haut der animalen Sv-
sleme von der zweiten vegetativen Serom CBauchfeJI nebst seinen Anhängen: Herzbeutel, Brustfelle
und Scheidenhaute )) wesentlich unterscheidet, erstreckt sich sogar auf ihre zu Auge und Ohr ge-
en en uss pungen. Im Augapfel setzt sie sich in den Zwischenraum von Sclerolica und Chorioi-
ea s atmna fusca, Descemet’sche Haut und als Oberaderhaut fort und entwickelt sich, wie ich
1) H u sc lik e , Handbuch der Splancbnologie. S. 191.
an einem anderen Orte gezeigt habe, durch Umschlag nicht nur als die die Augenkammern auskleidenden
Serosa und Epithelialschicht, sondern auch als Glashaut und Glaskörper, zu den mit Humor vi-
treus und aqueus gefüllten Apparäten, deren Abfüllung mit diesem thierischen Wasser sogar eine unerlässlich
e Bedingung ihrer Thätigkeit ist. Dasselbe geschieht am Ohr. Sein hartes Labyrinth
ist mit einer Fortsetzung der Arachnoidea ausgekleidet und mit Serum (Colunnischem Wasser) gefüllt,
ohne welches die akustische Wirksamkeit des weichen Labyrinths nicht möglich wäre. Beides also,
wie das Hirn und Rückenmark, physiologisch nothwendig wassersüchtige Organe!
Die Säugethiere sind noch mit Hirnwasser versehen, aber in geringerem Grade, Vögel und Amphibien
gar nicht. Ihr Hirn liegt entweder genau an der Innenfläche des Schädels an oder es hat
wenigstens nicht ein so bew egliches Serum um sich, sondern mehr eine fettige Sülze, die sich
nicht vor- und rückwärts bewegt (Fische).
Nimmt allerdings die Menge des inneren (in den Ventrikeln befindlichen) Hirnwassers von der
ersten embryonischen Zeit an ab, so nimmt dagegen antagonistisch das äussere (an der Oberfläche der
Nervencentra befindliche) Hirnwasser verhältnissmässig zu, in dem Verhältnisse, als die Hemisphären
und Windungen an Bedeutung und Umfang gewinnen. Abzapfung desselben macht Apathie und Verwachsung
der Arachnoidt®. wird von Störungen des Hirnlebens begleitet vielleicht in noch höherem
Grade, als eine Verwachsung anderer seröser Häute die Thätigkeit ihrer Eingeweide stört.
Jedoch giebt es ohne Zweifel Stellen auch am menschlichen Gehirn, wohin es nicht dringt. So
zeigen wahrscheinlich zum Theil deshalb die Schädelknochen nicht überall gleich scharfe und tiefe
Abdrücke der Windungen und Furchen des grossen Gehirns, wie namentlich nicht die Mittelgegend der
Calotte, während Seiten und Grundfläche der Schädelhöhle scharf ausgeprägte juga und impressiones
haben (Augenhöhlendach, grosse Flügel, Schuppe, Felsenbein, unterer Theil der Scheitelbeine, fossa
cerebri des Zwischenscheitelbeins), wobei freilich der Druck mitwirken mag, wie denn auch die Pia
mater an der Unterfläche des Gehirns selten so verdickt wie oben angetroffen wird.
An der Aussenfläche des unteren Wurms des kleinen Gehirns steigt das Hirnwasser in einen nach
oben, etwa in der Gegend der kurzen Querbänder, blindgeschlossenen Sack der Spinnengewebehaut
herauf und berührt also nicht den oberen Wurm. Dagegen umspült es Brücke und Markknopf. Oeff-
net man die Schädelhöhle gefrorener Leichen, so findet man beide ganz umgeben von Eisscherben,
die sich dann an den Seiten der Vierhügel heraufziehen, dagegen keine am Cerebellum, besonders an
den Hemisphären. Am grossen Ilirn sind alle seine Höhlen mit Eis gefüllt. Berührt das Hirnwasser
also bei niederen Thieren nur die inneren körperlichen Centra des Gehirns, das Centralgrau, so scheint
es bei den Säugelhieren und dem Menschen,-auch dem psychischen, peripherischen Grau zu dessen
vollem Leben nothwendig zu seyn.
Mit der Menge dieser Flüssigkeit und ihrer verschiedenen Anhäufung hängt es nun zusammen,
warum die kubischen Messungen der drei Schädelwirbel nicht genau mit den Wägungen ihrer re-
spectiven Hirnabschnitte übereinstimmen. Vielmehr ist der Scheitelwirbel viel besser bedacht, als das
Scheitelhirn, wenn dessen Gewicht mit den beiden anderen Abtheilungen procenlisch verglichen wird,
wie folgende Zusammenstellung es anschaulich macht. Es verhält sich nämlich bei
M an n F ra u K in d
der Inhalt* des Scheitelwirbels zum Stirnwiriiel wie 81,6:18,4$ 82,6:17,4$ 85,3:14,7$,
das Gewicht des Scheitelhirns zum Slirnbirn wie 75,0 : 25,0$ 75,5 : 24,5$ 81,5 : 18,5$. 6^ $ " "7^$" 3,8$.
Aus dieser Vergleichung ist ersichtlich, 1) dass die Differenz zwischen dem Inhalte des Scheitelwirbels
und dem Gewicht des Scheitelhirns bei beiden Geschlechtern ziemlich dieselbe ist, nämlich
G — 78, beim Kinde hingegen nur die Hälfte (3,8*), so dass also wahrscheinlich die durch das Hirnwasser
herbeigeführte Hirnbewegung nur die Hälfte so stark seyn möchte, als beim Erwachsenen,
sich bewegt, auf- und absteigt; 2) dass man bei Messungen von Schädelhöhlen ungefähr so viel Pro-
38«