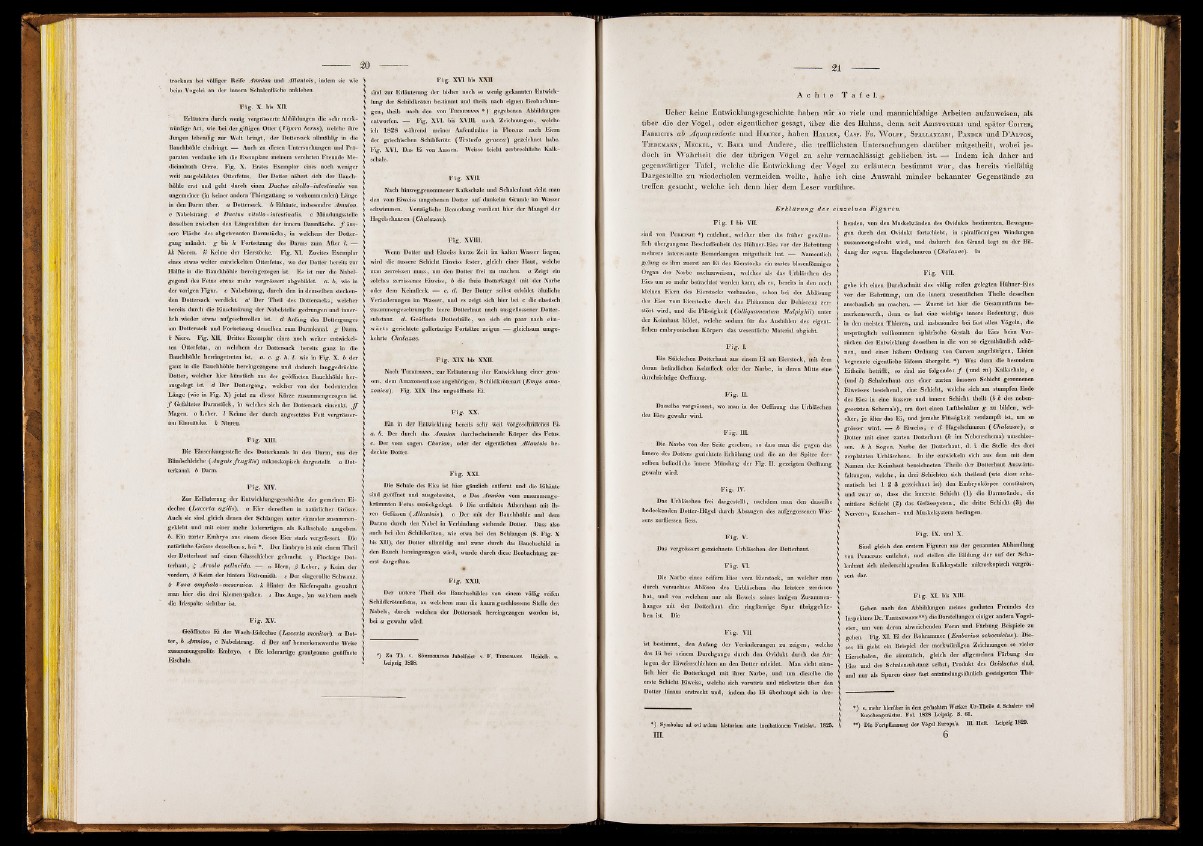
trocknen bei völliger Reife Amnion und Allantois, indem sie wie
beim Vogelei an der innern Schalenfläche ankleben.
Fig. X. bis XD.
Erläutern durch wenig vergrösserte Abbildungen die sehr merkwürdige
Art, wie bei der giftigen Otter (Vipera berus), welche ihre
Jungen lebendig zur Welt bringt, der Dottersack allmählig in die
Bauchhöhle eindringt. — Auch zu diesen Untersuchungen und Präparaten
verdanke ich die Exemplare meinem verehrten Freunde Me-
dicinalrath Otto. Fig. X. Erstes Exemplar eines noch weniger
weit ausgebildeten Olterfetus. Der Dotter nähert sich der Bauchhöhle
erst und geht durch einen Ductus vitello-intestinalis von
ungemeiner (in keiner ändern Thiergattung so vorkommenden) Länge
in den Darm über, a Dottersack, b Eihäute, insbesondre Amnion,
c Nabclslrang. d Ductus vitello - intestinalis, e Mündungsstelle
desselben zwischen den Längenfalten der innem Darmfläche, f äussere
Fläche des abgetrennten Darmstücks, in welchem der Dottergang
mündet, g bis h Fortsetzung des Darms zum After l. —
bk Nieren, ii Keime der Eierstöcke. Fig. XI. Zweites Exemplar
eines etwas weiter entwickelten Otterfetus, wo der Dotter bereits zur
Hälfte in die Bauchhöhle hereingezogen ist. Es ist nur die Nabelgegend
des Fetus etwas mehr vergTössert abgebildet, a. b. wie in
der vorigen Figur, c Nabelstrang, durch den in demselben steckenden
Dottersack verdickt, a' Der Theil des Dottersacks, welcher
bereits durch die Einschnürung der Nabelstelle gedrungen und innerlich
wieder etwas aufgeschwollcn ist. d Anfang des Dotterganges
am Dottersack und Fortsetzung desselben zum Darmkanal, g Darm.
k Niere. Fig. XII. Drittes Exemplar eines noch weiter entwickelten
Otterfetus, an welchem der Dottersack bereits ganz in die
Bauchhöhle hereingetreten ist. a. c. g. h. I. wie in Fig. X. b der
ganz in die Bauchhöhle hereingezogene und dadurch langgedrückte
Dotter, welcher hier künstlich aus der geöffneten Bauchhöhle herausgelegt
ist. d Der Dottergang, welcher von der bedeutenden
Länge (wie in Rg. X) jetzt zu dieser Kürze zusammengezogen ist.
/ Gefaltetes Darmstück, in welches sich der Dottersack einsenkt, f f
Magen, o Leber. I Keime der durch angesetztes Fett vergrösser-
ten Eierstöcke, k Nieren.
Fig. XIII.
Die Einscnkungsstelle des Dotterkanals in den Darm, aus der
Blindschleiche (Anguis fragilis) mikroskopisch dargestellt, a Dotterkanal.
b Darm.
Fig. XIV.
Zur Erläuterung der Entwicklungsgeschichte der gemeinen Eidechse
(Lacerta agilis). a Eier derselben in natürlicher Grösse.
-Auch sie sind gleich denen der Schlangen unter einander zusammengeklebt
und mit einer mehr lederartigen als Kalkschale umgeben.
6. Ein zarter Embryo aus einem dieser Eier stark vergrössert. Die
natürliche Grösse desselben s. bei *. Der Embryo ist mit einem Thcil
der Dotterhaut auf einen Glasschieber gebracht, tj Rockige Dotterhaut,
f Areola pellucida^0^i-ja Herz, ß Leber, y Keim der
vordem, d Keim der hintern Extremität, e Der eingerollte Schwanz.
& Vasa omphalo - meseraica. A Hinter der Kieferspalte gewahrt
man hier die drei Kiemenspalten, i Das Auge, [an welchem noch
die Irisspalte sichtbar ist
Fig. XV.
Geöffnetes Ei der Wach-Eidechse (Lacerta monitor). a Dotter,
b Amman, c Nabelstrang, d Der auf bemerkenswerthe Weise
zusammengerollte Embryo, e Die lederartige graubraune geöffnete
Eischale.
S Fig. XVI bis XXII
> sind zur Erläuterung der bisher noch so wenig gekannten Entwick-
S lung der Schildkröten bestimmt und theils nach eignen Beobnchtun-
i gen, theils nach den von T iedemann *) gegebenen Abbildungen
i entworfen. —■ Rg. XVI. bis XVIII. nach Zeichnungen, welche
’ ich 1828 während meines Aufenthaltes in Florenz nach Eiern
) der griechischen Schildkröte (Testudo gracca) gezeichnet habe.
V Rg. XVI. Das Ei von Aussen. Weisse leicht zerbrechliche Kalk-
i schale.
j Fig. XVII.
) Nach hinweggenommener Kalkschale und Schulenhaut sieht man
) den vom Eiweiss umgebenen Dotter auf dunkelm Grunde im Wasser
S schwimmen. Vorzügliche Bemerkung verdient hier der Mangel der
^ Hagels cluiuren ( Chalazae).
SS
! > Fig. XVIII.
> Wenn Dotter und Eiweiss kurze Zeit im kalten Wasser liegen,
\ wird die äussere Schicht Eiweiss fester, gleich einer Haut, welche
J man zerreissen muss, um den Dotter hei zu machen, a Zeigt ein
/ solches zerrissenes Eiweiss, b die freie Dotterkugel mit der Narbe
i oder dem Keimfleck. — c. d. Der Dotter selbst erleidet ähnliche
S Veränderungen im Wasser, und es zeigt sich hier bei c die elastisch
\ zusammengeschrumpfte leere Dotterhaut nach ausgeflossener Dotter-
? Substanz, d. Geöffnete Dotterhülle, wo sich ein paar nach ein-
) wärts gerichtete gallertarige Fortsätze zeigen — gleichsam umge-
> kehrte Chalazae.
)
S
S Fig. xix bis xxn.
) Nach T ied emann, zur Erläuterung der Entwicklung einer gros-
S sen, dem Amazonenflusse angehörigen, Schildkrötenart (Emys ama-
\ zonica). Rg. XIX Das ungeöffnete Ei.
s
\ Fig. XX.
> Ein in der Entwicklung bereits sehr weit vorgeschrittenes Ei.
S a. b. Der durch das Amnion durchscheinende Körper des Fetus.
( Ci Der vom sogen. Chorion, oder der eigentlichen Allantois be7
i deckte Dotter.
I . I ■ Fig. XXL
j Die Schale des Eies ist hier gänzlich entfernt und die Eihäute
( sind geöffnet und ausgebreitet, a Das Amnion vom zusammenge-
^ krümmten Fetus zurückgelegt, b Die entfaltete Athemhaut mit ih-
> ren Gelassen ( Allantois). c Der mit der Bauclihöhle und dem
I Darme durch den Nabel in Verbindung stehende Dotter. Dass also
\ auch bei den Schildkröten, wie etwa bei den Schlangen (S. Rg. X
v bis XII), der Dotter allmählig und zwar durch das Bauchschild in
( den Bauch hereingezogen wird, wurde durch diese Beobachtung zu-
■ 1 i Fig. XXU .
| Der untere Theil des Bauchschildes von einem völlig reifen
( Schildkrötenfetus, an welchem man die kaum geschlossene Stelle des
? Nabels, durch welchen der Dottersack hereingezogen worden ist,
bei a gewahr wird.
7 *) Zu Th. v. Sömmebrings Jubelfeier v. F. Tibdbmann. Ileidclb. u.
I Leipzig. 1828.
A c h t e ' T a f e 1. •
Ueber keine Entwicklungsgeschichte haben wir so viele und mannichfaltige Arbeiten aufzuweisen, als
über die der Vögel,, oder eigentlicher gesagt, über die des Huhns, denn seit A r is to t e l e s und später C o it e r ,
F a b riciu s ab Aquapehdente und H a r v e t , haben H a l l e r , C a s p . F r. W o l f f , S pa l l a n z a n i, P a n der und D’A l to n,
T ied em a n n , M e c k e l , v. B ae r und Andere, die trefflichsten Untersuchungen darüber mitgetheilt, wobei jedoch
in Wahrheit die der übrigen Vögel zu sehr vernachlässigt geblieben ist. — Indem ich daher aui
gegenwärtiger Tafel, welche die Entwicklung der Vögel zu erläutern bestimmt war, das bereits vielfältig
Dargestellte zu wiederholen vermeiden wollte, habe ich eine Auswahl minder bekannter Gegenstände zu
treffen gesucht, welche ich denn hier dem Leser vorführe.
E r k lä r u n g d e r e in z e ln en F ig u ren .
Fig. I bis Vn.
sind von P urkin je *) entlehnt, welcher über die früher gewöhnlich
übergangene Beschaffenheit des Hühner-Eies vor der Bebrütung
mehrere interessante Bemerkungen mitgetheilt hat. — Namentlich
gelang es ihm zuerst am Ei des Eierstocks ein zartes blasenförmiges
Organ der Narbe nachzuweisen, welches als das Urbläschen des
Eies um so mehr betrachtet werden kann, als es, bereits in den noch
kleinen Eiern des Eierstocks vorhanden, schon bei der Ablösung
des Eies vom Eierstocke durch das Phänomen der Dehiscenz zerstört
wird, und die Flüssigkeit ( Colliquamentum Malpighii) unter
der Keimhaut bildet, welche sodann für das Ausbilden des eigentlichen
embryonischen Körpers das wesentliche Material abgiebt.
Fig. L
Ein Stückchen Dotterhaut aus einem Ei am Eierstock, mit dem
daran befindlichen Keimfleck oder der Narbe, in deren Mitte eine '
durchsichtige Oefihnng.
Fig. IL
Dasselbe vergrössert, wo man in der Oefinung das Urbläschen
des Eies gewahr wird.
Fig. m.
Die Narbe von der Seite gesehen, so'dass man die gegen das
Innere des Dotters gerichtete Erhöhung und die an der Spitze derselben
befindliche innere Mündung der Rg. II. gezeigten Oefinung
gewahr wird.
Fig. IV.
Das Urbläschen frei dargestellt, nachdem man den dasselbe
bedeckenden Dotter-Hügel durch Absaugen des aufgegossenen Wassers
zerfliessen liess.
Fig. V.
Das vergrössert gezeichnete Urbläschen der Dotterhaut.
Fig. VI.
Die Narbe eines reifem Eies vom Eierstock, an welcher man
durch versuchtes Ablösen des Urbläschens das letztere zerrissen
hat, und von welchem nur als Beweis seines innigen Zusammenhanges
mit der Dotterhaut eine ringförmige Spur übriggeblieben
ist. Die
Fig. VII
ist bestimmt, den Anfang der Veränderungen zu zeigen, welche
das Ei bei seinem Durchgänge durch den Ovidukt durch das Anlegen
der Eiweissschichten an den Dotter erleidet. Man sieht nämlich
liier die Dptterkugel mit ihrer Narbe, und um.dieselbe die
erste Schicht Eiweiss, welche sich vorwärts und rückwärts über den
Dotter hinaus erstreckt und, indem das Ei überhaupt sich in dreS
henden, von den Muskelwänden des Ovidukts bestimmten, Bewegungen
durch den Ovidukt fortschiebt, in spiralförmigen Windungen
zusammengedreht wird, und dadurch den Grund legt zu der Bildung
der sogen. Hagelschnuren ( Chalazae). In
Fig. VI1L
gebe ich einen Durchschnitt des völlig reifen gelegten Hühner-Eies
vor der Bebrütung, um die innem wesentlichen Theile desselben
anschaulich zu machen. — Zuerst ist hier die Gesammtform be-
merkenswerth, denn es hat eine wichtige innere Bedeutung, dass
in den meisten Thieren, und insbesondre bei fast allen Vögeln, die
ursprünglich vollkommen sphärische Gestalt des Eies beim Verrücken
der Entwicklung desselben in die von so eigentliümlich schönen,
und einer hohem Ordnung von Curven angehörigen, Linien
begrenzte eigentliche Eiform übergeht. *) Was dann die besondern
Eitheile betrifft, so sind sie folgende: f (und m) Kalkschale, e
(und i) Schalenhaut aus einer zarten äussem Schicht geronnenen
Eiweisses bestehend, eine Schicht, welche sich am stumpfen Ende
des Eies in eine äussere und innere Schicht theilt: (b k des nebengesetzten
Schema’s), um dort einen Luftbehälter g zu bilden, welcher,
je älter das Ei, und jemehr Flüssigkeit verdampft ist, um so
grösser wird. __ b Eiweiss , vc d Hagelschnuren ( Chalazae) , a
Dotter mit einer zarten Dotterhaut (7t im Nebenschema) umschlossen.
h h Sogem Narbe der Dotterhaut, d. i. die Stelle des dort
zerplatzten Urbläschens. In ihr entwickeln sich aus dem mit dem
Namen der Keimhaut bezeichneten Theile der Dotterhaut Auswärtsfaltungen,
w,elche, in drei Schichten sich theilend (wie diess schematisch
bei 1 2 3 gezeichnet ist) den Embryokörper constituiren,
und zwar so, dass die innerste Schicht. (1) die Darmwände, die
mittlere Schicht (2) das Gefässsystem, die dritte Schicht (3). das
Nerven-, Knochen- und Muskelsystem bedingen.
Fig. IX. und X.
Sind gleich den erstem Figuren aus der genannten Abhandlung
von P u rkin je entlehnt, und stellen die Bildung der auf der Schalenhaut
sich niederschlagenden Kalkkrystalle mikroskopisch vergrössert
dar.
Fig. XI. bis XIII.
Geben nach den Abbildungen meines geehrten Freundes des
Inspektors Dr. T hienemann* * ) die Darstellungen einiger ändern Vogeleier
um von deren abweichenden Form und Färbung Beispiele zu
geben. Rg. XI. Ei der Rohrammer (Emberiza schoeniclus). Dieses
Ei giebt ein Beispiel der merkwürdigen Zeichnungen so vieler
Eierschalen, die sämmtlich, gleich der allgemeinen Färbung des
Eies und der Schalensubstanz selbst, Produkt des Oviductus sind,
und nur als Spuren einer fast entzündungsähnlich gesteigerten Thä-
*) Symbolae ad ovi avium historiam ante incubationem Vratislav. 1825.
m .
*) s. mehr hierüber in dem gedachten Werke: Ur-Theile d. Schalen- nnd
Knochengerüstes. Fol. 1828 Leipzig. S. 61.
**) Die Fortpflanzung der Vögel Europa’s. DL Heft. Leipzig 1829.