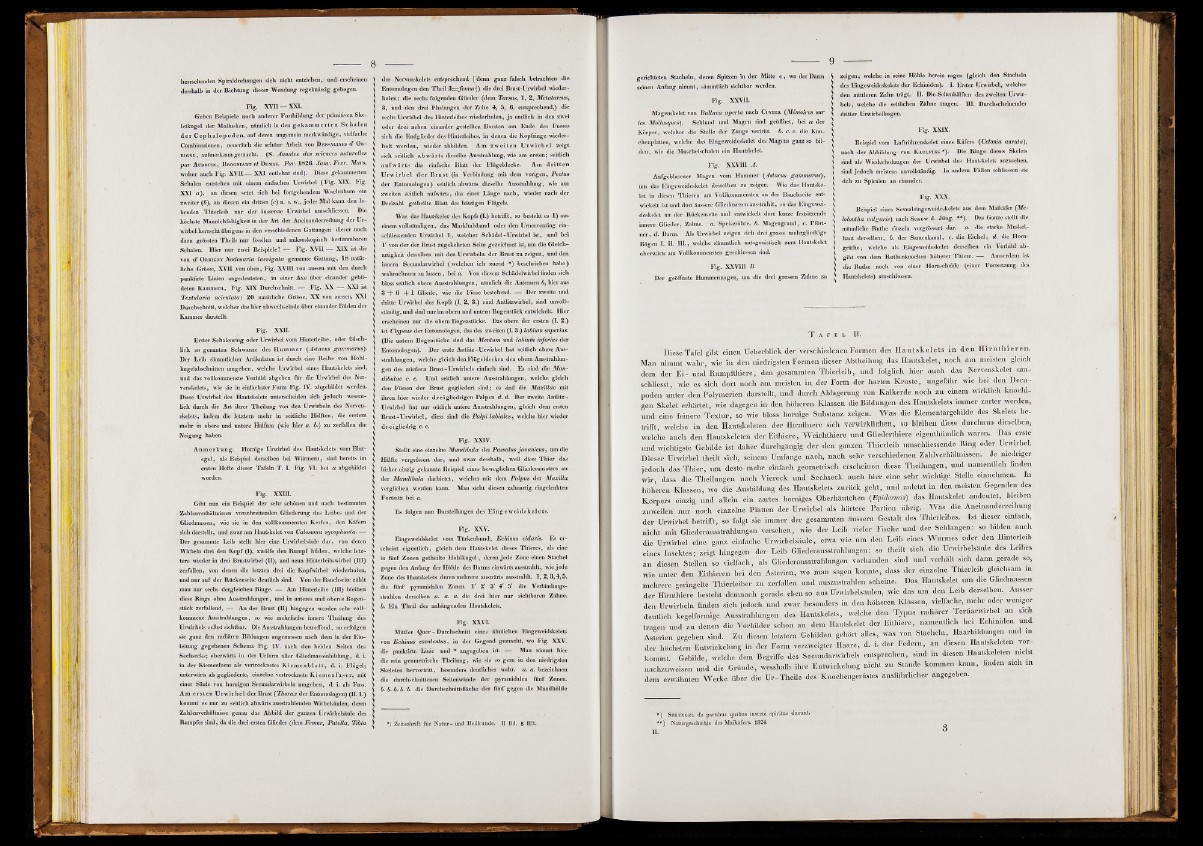
herrschenden Spiraldrehungen sich nicht entziehen, und erscheinen
desshalb in der Richtung dieser Wendung regelmässig gebogen.
Fig. XVU — XXI.
Geben Beispiele noch anderer Fortbildung der primitiven Ske-
letkugel der Mollusken, nämlich in den gekammerten Schalen
de r Cephalopoden, auf deren ungemein merkwürdige, vielfache
Combinationen, neuerlich die schöne Arbeit von D essa l ise s cf Or-
BiGNX, aufmerksam gemacht. (S. Annales des sciences naturelles
par A udouin, B iiogkiart et D umas. Par. 1826. Janv. Fevr. Mars,
woher auch Fig. XVII — XXI entlehnt sind). Diese gekammerten
Schalen entstehen mit einem einfachen Urwirbel (Fig. XIX. Fig.
XXI a), an diesen setzt sich bei fortgèhendem Waclisthum ein
zweiter (6), an diesen ein dritter, (c) u. s. w.,jedes Mal kann den lebenden
Thierleib nur der äusserste Urwirbel umschliessen. Die
höchste Mannichfaltigkeit in der Art der Aneinanderreihung der Urwirbel
herrscht übrigens in den verschiedenen Gattungen dieser noch
dazu grössten Theils nur fossilen und mikroskopisch bestimmbaren
Schalen. Hier nur zwei Beispiele! — Fig. XVII — XIX ist die
von d’ O rbigny Nodosaria laevigata genannte Gattung, 18 natürliche
Grösse, XVII von oben, Fig. XVIII von aussen mit den durch
punktirte Linien angedeuteten,- in einer Axe über einander gebildeten
Kammern, Flg. XIX Durchschnitt. — :Fig. XX — XXI ist
Textularia aciculata; 20 natürliche Grösse, XX von aussen, XXI
Durchschnitt, welcher das hier abwechselnde über einander Bilden der
Kammer darstellt.
Fig. XXII.
Erster Schalenring oder Urwirbel vom Hinterleibe, oder fälschlich
so genanten Schwänze des Hummer (Astacus gammarus).
Der Leib sämmtiicher Artikulaten ist durch eine Reihe von Hohl-
kngelabschnitten umgeben, Welche Urwirbel eines Hautskelets sind,
und das vollkommenste Vorbild abgeben für die Urwirbel des Ner-
venskelets, wie sie in einfachster Form Fig. IV. abgebildet werden.
Diese Urwirbel des Hautskelets unterscheiden rieh jedoch wesentlich
durch die Art ihrer Theilung von den Urwirbeln des Nérven-
skelets, indem die letztem mehr in seitliche Hälften, die erstem
mehr in obere und untere Hälften (wie -hier a. b.) zu zerfallen die
Neigung haben.
Anmerkung. Hornige Urwirbel des Hautskelets vom Blutegel,
als Beispiel derselben bei Würmern, sind bereits im
ersten Hefte dieser Tafeln T. L Fig. VI. bei a abgebildet
Fig. XXUL
Gibt nun ein Beispiel der sehr schönen und nach bestimmten
Zahlenverhältnissen vorschreitenden Gliederung des Leibes und der
Gliedmassen, wie sie in den vollkommensten Kerfen, den Käfern
sich darstellt, und zwar am Hautskelet von Calosoma sycophanta. —
Der gesammte Leib stellt hier eine Urwirbelsäule dar, von deren
Wirbeln drei den Kopf (1), zwölfe den Rumpf bilden, welche letztere
wieder in drei Brustwirbel (II), und neun Hinterleibswirbel (BI)
zerfallen, von denen die letzten drei die Kopfwirbel wiederholen,
und nur auf der Rückenseite deutlich sind. Von der Bauchseite zählt
man nur sechs dergleichen Ringe. — Am Hinterleibe (III) bleiben
diese Ringe ohne Ausstrahlungen, und in unteres und oberes Bogenstück
zerfallend An der Brust (II) hingegen werden sehr vollkommene
Ausstrahlungen, so wie mehrfache innere Theilung dès
Urwirbels selbst sichtbar. Die Ausstrahlungen betreffend, so erfolgen
.rie ganz den radiären Bildungen angemessen nach dem in der Einleitung
gegebenen Schema Fig. IV. nach den beiden Seiten des
Sechsecks; oberwärts in der Urform aller Gliedmassenbildung, d. i.
in der Kiemenform als vertrocknetes Kiemenblatt, d. i. Flügel;
unterwärts als gegliederte, einzelne vertrocknete Kiemen fas er, mit
einer Säule von hornigen Secundarwirbeln umgeben, d. i. als Fuss.
Am ersten Urwirbel der Brust (Thorax der Entomologen) (D. 1.)
kommt es nur zu seitlich abwärts ausstrahlenden Wirbelsäulen, deren
Zahlenverhältnisse genau das Abbild der ganzen Urwirbelsäule des
Rumpfes sind, da die drei ersten Glieder (dem Femur, Patella, Tibia
des Nervenskelets entsprechend [ denn ganz falsch betrachten die
Entomologen den Theil 3—fetnurj) die drei Brust-Urwirbel wiederholen;
die sechs folgenden Glieder (dem Tarsus, 1, 2, Metatarsus,
3, und den drei Phalangen der Zehe 4, 5, 6, entsprechend,) die
sechs Urwirbel des Hinterleibes wiederholen, ja endlich in den zwei
oder drei neben einander gestellten Borsten am Ende des Fusses
sich die Endglieder des Hinterleibes, in denen die Kopfringe wiederholt
werden, wieder abbilden. Am zweiten Urwirbe l zeigt
sich seitlich abwärts dieselbe Ausstrahlung, wie am ersten; seitlich
aufwärts das einfache Blatt der Flügeldecke. Am d ritten
U rw irb el der Brust (in Verbindung mit dem vorigen, Pectus
der Entomologen) seitlich abwärts dieselbe Ausstrahlung, wie am
zweiten Seitlich aufwärts, das einer Länge nach, wieder nach der
Dreizahl getheilte Blatt des häutigen Flügels.
Was das Hautskelet des Kopfs (I.) betrifft, so besteht es. 1) aus
einem vollständigen, das Markhalsband oder den Umeiwenring ein-
schliessenden Urwirbel 1, welcher Schädel-Urwirbel ist, und bei
1' von der der Brust zugekehrten Seite gezeichnet ist, um die Gleichartigkeit
desselben mit den Urwirbeln der Brust zu zeigen, und den
innern Secundarwirbel (welchen ich zuerst *) beschrieben habe)
waliraehmen zu lassen, bei a. Von diesem Scliädelwirbel finden sich
bloss seitlich obere Ausstrahlungen, nämlich die Antennen b, hier aus
3 + 6 + 1 Gliede, wie die Füsse bestehend. — Der zweite und
dritte Urwirbel des Kopfs (I. 2, 3.) sind Antlitzwirbel, sind unvollständig,
und sind nur im obern und untern Bogenstück entwickelt. Hier
. erscheinen nur die obern Bogenstücke. Das obere der ersten (I. 2.)
ist Clypeus der Entomologen, das des zweiten (I. 3.) labium superius.
(Die untern Bogenstücke sind das Mentum und labium irtferius der
Entomologen). Der erste Antiitz-Urwirbel hat seitlich obere Ausstrahlungen,
welche gleich den Flügeldecken den obern Ausstrahlungen
des mittlern Brust-Urwirbels einfach sind. Es sind die Mandibulae
c. C. Und seitlich untere Ausstellungen, welche gleich
den Füssen der Brust gegliedert sind; es sind die MaxiUae mit
ihren hier wieder dreigliedrigen Palpen d. d. Der zweite Antlitz-.
Urwirbel hat nur seitlich untere Ausstrahlungen, gleich dem ersten
Brust-Urwirbel, diess sind die Palpi labiales, welche hier wieder
dreigliedrig e. e.
Fig. XXIV.
, Stellt eine einzelne Mandibula des Passdlus javanicus, um die
Hälfte vergrössert dar, und zwar desshalb, weil diess Thier das
bisher einzig gekannte Beispiel eines beweglichen Gliederansatzes an
der Mandibula darbietet, welcher mit dem Palpus der Maxilla
verglichen werden kann. Man sieht diesen zahnartig eingelenkten
Fortsatz bei a.
Es folgen nun Darstellungen des Eingeweidskelets.
Fig. XXV.
Eingeweidskelet vom Türkenbund, Echinus cidai'is. Es erscheint
eigentlich, gleich dem Hautskelet dieses Thieres, als eine
in fünf Zonen getheilte Hohlkugel, deren jede Zone einen Stachel
gegen den Anfang der Höhle des Darms einwärts ausstrahlt, wie jede
Zone des Hautskelets deren mehrere auswärts ausstrahlt. 1,2,3,4,5.
die fünf pyramidalen Zonen. 1’ 2' 3' 4' 5' die Verbindungsstrahlen
derselben a. a. a. die drei hier nur sichtbaren Zähne.
5. Ein Theil des anhängenden Hautskelets.
Fig. XXVI.
Mittler Quer - Durchschnitt eines ähnlichen Eingeweidskelets
von Echinus esculenlus, in der Gegend gemacht, wo Fig. XXV.
die punktirte Linie und * angegeben ist. — Man nimmt liier
die rein geometrische Theilung, wie sie so gern in den niedrigsten
Skeleten hervortritt, besonders deutlicher wahr. a. a. bezeichnen
die dutchsclmittenen Seitenwände der pyramidalen fünf Zonen.
6. 6. b. b. b. die Durchschnittsfläche der fünf gegen die Mundhöhle
*) Zeitschrift für Natur - und Heilkunde. II Bd. 8 Hft.
gerichteten Stacheln, deren Spitzen in der Mitte c , wo der Darm
seinen Anfang nimmt, sämmtlich sichtbar werden.
Fig. XXVll.
Magenskelet von Bullaea aperta nach C cvieh (Mémoires sur
les Mollusques). Schlund und Magen sind geöffnet, bei a der
Körper, welcher die Stelle der Zunge vertritt, b. c. c. die Knochenplatten,
welche das Eingeweideskelet des Magens ganz so bilden,
wie die Muschelschalen ein Hautskelet.
Fig. XXVIII A.
Aufgeblasener Magen vom Hummer (Astacus gammarus),
um das Eingeweideskelet desselben zu zeigen. Wie das Hautskelet
in diesen Thieren am Vollkommensten an der Bauchseite entwickelt
ist und dort äussere Gliedmassen ausstrahlt, so das Eingeweideskelet
an der Rückenseite und entwickelt dort kurze festsitzende
innere Glieder, Zähne, a. Speiseröhre, b. Magengrund, c. Pförtner,
d. Darm. Als Urwirbel zeigen sich drei grosse mehrgliedrige
Bögen I. II. III., welche sämmtlich antagonistisch zum Hautskelet
oberwärts am Vollkommensten gesclüossen sind.
Fig. XXVIII B.
Der geöffnete Hummermagen, um die drei grossen Zähne zu
zeigen, welche in seine Höhle herein ragen (gleich den Stacheln
des Eingeweideskelets der Echiniden)> I. Erster Urwirbel, welcher
den mittleren Zahn trägt. II. Die Seitenhälften des zweiten Urwirbels,
welche die seitlichen Zähne tragen. UI. Durchscheinender
dritter Urwirbelbogen.
Fig. XXIX.
Beispiel vom Luftröhrenskelet eines Käfers (Cetoma aurata),
nach der Abbildung von K aulfuss *). Die Ringe dieses Skclets
sind als Wiederholungen der Urwirbel des Hautskelets anzusehen,
sind jedoch meistens unvollständig. In ändern Fällen schliessen sie
sich zu Spiralen an einander.
Fig. XXX.
Beispiel eines Scxualcingeweideskelets aus dem Maikäfer (Me-
lolontha vulgaris) nach S ukow d. Jüng. **). Das Ganze stellt die
männliche Ruthe einzeln vergrössert dar. a. die starke Muskel-
haut derselben, b, der Samenkanal, c. die Eichel, d. die Hom-
grätlie, welche als Eingeweideskelet derselben ein Vorbild ab-
gibt von dem Ruthenknochen höherer Tliiere. — Ausscrdem ist
die Rutlie noch von einer Hornscheide (einer Fortsetzung des
Hautskelets) umschlossen.
T a f e l II.
Diese Tafel gibt eincn üeberblick cler verschiedenen Formen des H a u tsk e le ts in d en H irn lh ie r en .
Man nimmt wahr, wie in den niedrigsten Formen dieser Abtheilung das Hautskelet, pocham meisten gleich
dem der E i- und Rumpf liiere, den gesammten Thierleib, und folglich hier auch da» N.crvcnskciet um
schliesst, wie es sich dort noch am meisten in der Form der harten Kruste, ^ungefähr wie hei. den l ^ | r
poden unter den Poljmerien darstellt, und durch Ablagerung Ton Kalkerde noch»zu:einem wirklich knoclu-
gen Skelef erhärtet, wie'dagegen in den höheren Klassen die'Bildungen des Hautskelets immer zarter werden,
und eine feinere Textur, so wie bloss hornige Substanz zeigen. Was die Elementargebilde des Skelets be-
triffty welölie in: den Hautskeleten der Hirnthiere sich Terwirklichen, f ii bleiben* diese!'durchaus dieselben,
welche auch den Hautskeleten der Eithiere, Weichthiere und Gliederthiere eigenthümlich waren. Das erste
und wichtigste Gebilde ist daher durchgängig der den ganzen Thierleib um sch |e i|p d e Ring oder Urwirbel.
Dieser Urwirbel theilt sich, seinem Umfange nach, nach sehr yerschiedenen Zählvorhältnissen. Je niedriger
jedoiälfdas Thier, um desto mehr einfach geometrisch erscheinen diese Theilungen, und namentlich & + n
wir dass die Theilungen nach Viereck und Sechseck, auch hier eine sehr wichtige Stelle einnehmen. In
höheren Klassen, wo die Ausbildung des Hautskelets zurück geht, und zuletzt in: dpn meisten G eg enden,^
Körpers einzig und allein ein zartes horniges Oberhäütchen (ßpiiennifi das Hautskelet andeutet, bleiben
zuweilen nur noch, einzelne Platten der Urwirbel als härtere Partien übrig..» VTas die Aneinanderreihung
der-Urwirbd betrifft, so folgt sie immer der gesammten äussem Gestalt des Thierleibeiipt Ist dieser einfach,
nicht mit Giiedcrausstrahlungcn versehen, wie der Leib vieler Fische Und der Schlangen: so bilden auch
die Urwirbel eine ganz einfache Urwirbelsäule; etwa wie um den Leib eines Wurmes-oder den Hinterleib
eines Insektes; zeigt hingegen der Leib Gliederauisteahlungen: so theilt sich die Urwirbelsäule des Leibes
an diesen Stellen so vielfach, als Gliederausstrahlungen vorhanden sind und verhält sich dann gerade sp;
wie unter den Eithieren bei den Asterien, wo man sagen konhte, dass der einzelne Thierleib gleichsam in
mehrere geringelte Thierleiber zu zerfallen und auszusträhteUiSCheine.. Das Hautskelet um die Gkedmassen
der Hirnthiere besteht demnach gerade eben.sq. aus Urwirbelsäulem vtie das um den Leib derselben, Aus|jr
den Urwirbeln finden sich jedoch und zwar besonders in den höheren Klassen, vielfache, mehr oder weniger
deutlich kegelförmige Ausstrahlungen des Hautskelets, welche den Typus radiärer Tertiarwirbel an. sich
tragen und zu denen die Vorbilder schon an dem Hautskelet der Eithiere, namentlich bei Echuuden und
Asterien gegeben sind. Zu diesen letztem Gebilden gehört alles, was woftStacheln, Haarbildungen und in
der höchsten Entwickelung in der Form verzweigter Haare, d. i. der Federn, an diesen Hautskeleten verkommt.
Gebilde, welche dem Begriffe des ffcundarwirbels entsprechen, sind in diesbtt Haulskeleten mcht
nachzuweisen und die Gründe, wesshalb ihre Entnickelung niehf 'zu Stande kommen kann, finden sich in
dem erwähnten Werke über die Ur-Theile dgKnochciigeriisie-s ausführlicher angegeben.
*) S p r e n g e l de partibus quibus insecta spiritus ducunl.
' * * ) Naturgeschichte des Maikäfers. 1824.
II.