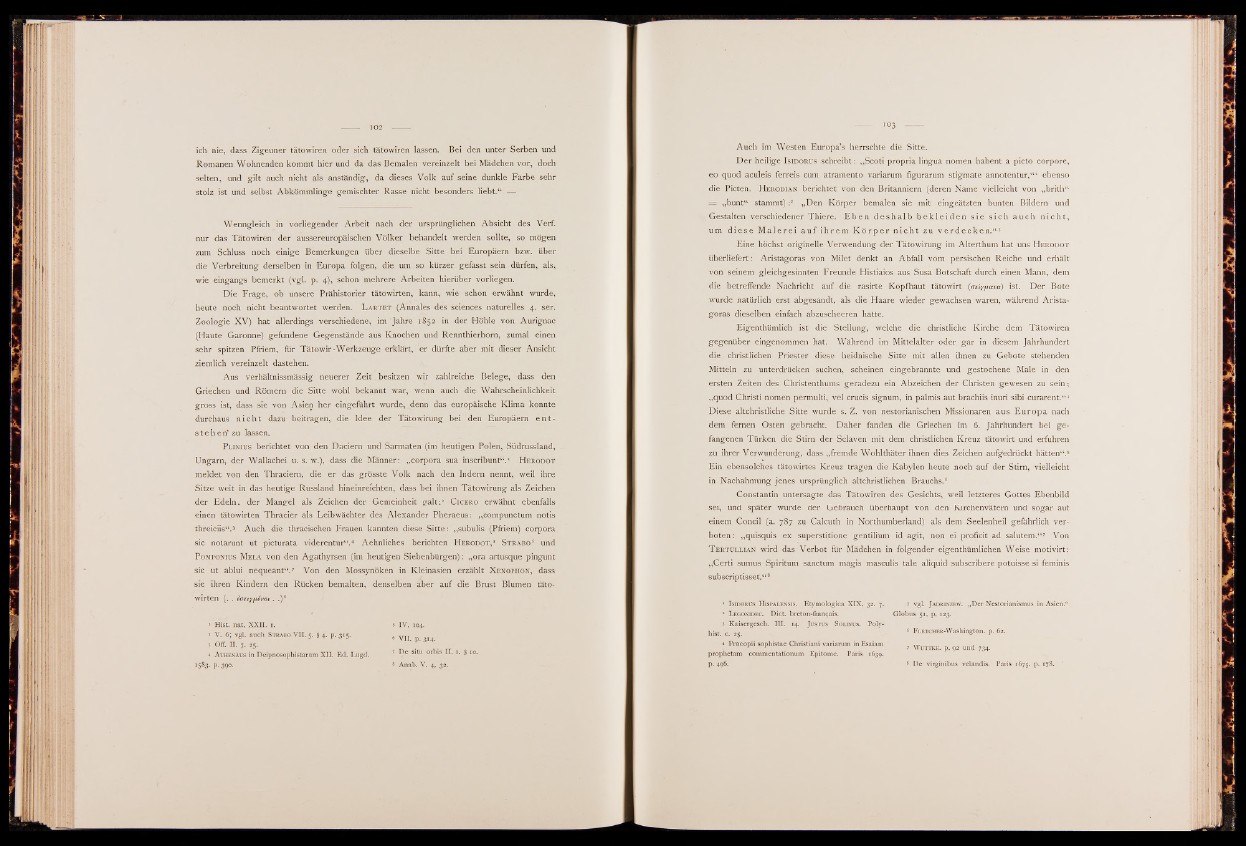
ich nie, dass Zigeuner tätowiren oder sich tätowiren lassen. Bei den unter Serben und
Romanen Wohnenden kommt hier und da das Bemalen vereinzelt bei Mädchen vor, doch
selten, und gilt auch nicht als anständig, da dieses Volk auf seine dunkle Farbe sehr
stolz ist und selbst Abkömmlinge gemischter Rasse nicht besonders liebt.“ —
Wenngleich in vorliegender Arbeit nach der ursprünglichen Absicht des Verf.
nur das Tätowiren der aussereuropäischen Völker behandelt werden sollte, so mögen
zum Schluss noch einige Bemerkungen über dieselbe Sitte bei Europäern bzw.'?.jäber
die Verbreitung derselben in Europa folgen, die um so kürzer gefasst sein dürfen, als*
wie eingangs bemerkt (vgl. p. 4), schon mehrere Arbeiten hierüber vorliegen.
Die Frage, ob unsere Prähistorier tätowirten, kann, wie schon erwähnt wurde,
heute noch nicht beantwortet werden. L a r t e t (Annales des Sciences naturelles 4 . ser.
Zoologie XV) hat allerdings verschiedene, im Jahre 1852 in der Höhle von Aurignac
(Haute Garonne) gefundene Gegenstände. aus Knochen und Rennthierhorn, zumal einen
sehr spitzen Pfriem, für Tätowir-Werkzeuge erklärt, er dürfte aber mit dieser Ansicht
ziemlich vereinzelt dastehen.
Aus verhältnissmässig neuerer Zeit ^besitzen wir zahlreiche Belege, dass den
Griechen und Römern die Sitte wohl bekannt war, wenn auch die Wahrscheinlichkeit
gross ist, dass sie von Asien her eingeführt wurde, denn das europäische Klima konnte
durchaus n ic h t dazu beitragen, die Idee der Tätowirung bei den Europäern e n t stehen*'
zu lassen.
P l in iu s berichtet von den Daciern und Sarmaten (im heutigen Polen, Südrussland,
Ungarn, der Wallachei u. s. w.), dass die Männer: „cörpora sua inscribunt“ . 1 H e ro d o t
meldet von den Thraciern, die er das grösste Volk nach den Indern nennt, weil ihre
Sitze weit in das heutige Russland hineinreichten, dass bei ihnen Tätowirung als Zeichen
der Ed ein, der Mangel als Zeichen der Gemeinheit galt;* C ic e r o erwähnt ebenfalls
einen tätowirten Thracier als Leibwächter des Alexander Pheraeus: „compunctum notis
threiciis“ .1 2 3 Auch die thracischen Frauen kannten diese Sitte: „subulis (Pfriem) corpora
sic notarunt ut picturata viderentur“ .4 Aehnliches berichten H e ro d o t , 5 S t r a b o 6 und
P omponiu s Mela von den Agathyrsen (im heutigen Siebenbürgen): „ora artusque pingunt
sic ut ablui nequeant“ .7 Von den Mossyriöken in Kleinasien erzählt X eno pho n , dass
sie ihren Kindern den Rücken bemalten, denselben aber auf die Brust Blumen tätowirten
(. . tauyfitvoi . .)8
1 Hist. nat. X XII. 1. 1 IV. 104.
2 v - 6; vgl. auch Strabo VII. 5. § 4. p. 315 . 6 v n 3I4
3 Off. II. 7. 25.
4 A u m a « in Deipnosophistarum XII. Ed. Lugd. 1 Slta orbis 1 1 I - 8 I a
*583- P- 39°- | Anäb. V. 4, 32.
Auch im Westen Europa1 s herrschte die Sitte.
Der heilige Isidorus schreibt: „Scoti propria lingua nomen habent a picto corpore,
eo quod aculeis ferreis cum atramento variarum figurarum stigmate annotentur,“ 1 ebenso
die Picten. Herodian berichtet von den Britanniern (deren Name vielleicht von „brith“
= „bunt“ stammt) :* „Den Körper bemalen sie mit eingeätzten bunten Bildern und
Gestalten verschiedener Thiere. E b e n d e s h a lb b e k l e id e n s i e s i c h a u c h n ic h t ,
um d i e s e M a l e r e i a u f ih r em K ö r p e r n ic h t zu v e r d e c k e n . “ 3
Eine höchst originelle Verwendung der Tätowirung im Alterthum hat uns Herodot
überliefert: Aristagoras von Milet denkt an Abfall vom persischen Reiche und erhält
von seinem gleichgesinnten Freunde Histiaios aus Susa Botschaft durch einen Mann, dem
die betreffende Nachricht auf die rasirte Kopfhaut tätowirt (ariyfiara) ist. Der Bote
wurde natürlich erst abgesandt, als die Haare wieder gewachsen waren, während Aristagoras
dieselben einfach abzuscheeren hatte.
Eigenthümlich ist die Stellung, welche die christliche Kirche dem Tätowiren
gegenüber eingenommen hat. Während im Mittelalter oder gar in diesem Jahrhundert
die christlichen Priester diese heidnische Sitte mit allen ihnen zu Gebote stehenden
Mitteln zu unterdrücken suchen, scheinen eingebrannte und gestochene Male in den
ersten Zeiten des Christenthums geradezu ein Abzeichen der Christen gewesen zu sein;
„quod Christi nomen permulti, vel crucis signum, in palmis aut brachiis inuri sibi curarent.“ 4
Diese altchristliche Sitte wurde s. Z. von nestorianischen Missionaren aus E u ro p a nach
dem fernen Osten gebracht. Daher fanden die Griechen im 6. Jahrhundert bei g e fangenen
Türken die Stirn der Sclaven mit dem christlichen Kreuz tätowirt und erfuhren
zu ihrer Verwunderung, dass „fremde Wohlthäter ihnen dies Zeichen aufg'edrückt hätten“ .5
Ein ebensolches tätowirtes Kreuz tragen die Kabylen heute noch auf der Stirn, vielleicht
in Nachahmung jenes ursprünglich altchristlichen Brauchs.6
Constantin untersagte das Tätowiren des Gesichts, weil letzteres Gottes Ebenbild
sei, und später wurde der Gebrauch überhaupt von den Kirchenvätern und sogar auf
einem Concil (a. 787 zu Calcuth in Northumberland) als dem Seelenheil gefährlich verboten:
„quisquis ex superstitione gentilium id agit, non ei proficit ad salutem.“ 7 Von
T ertullian wird das Verbot für Mädchen in folgender eigenthümlichen Weise motivirt:
„Certi sumus Spiritum sanctum magis masculis tale aliquid subscribere potuisse si feminis
subscriptisset.“ 8
1 Isidorus Hispalensis. Etymologica XIX. 32. 7. 2 L êgonidec. Diet, breton-frangais.
3 Kaisergesch. III. 14. J ustus S olinus. Poly-
hist. c. 25.
* Procopii sophistae Christiani variarum in Esaiam
prophetam commentationum Epitome. Paris 1639.
p. 496.
5 vgl. J adrinzew. „Der Nestorianismus in Asien.
Globus 51. p. 123.
6 FLETCHER-Washington. p. 62.
7 Wuttke. p. 92 und 734.
8 De virginibus velandis. Paris 1675. p. 178. ’