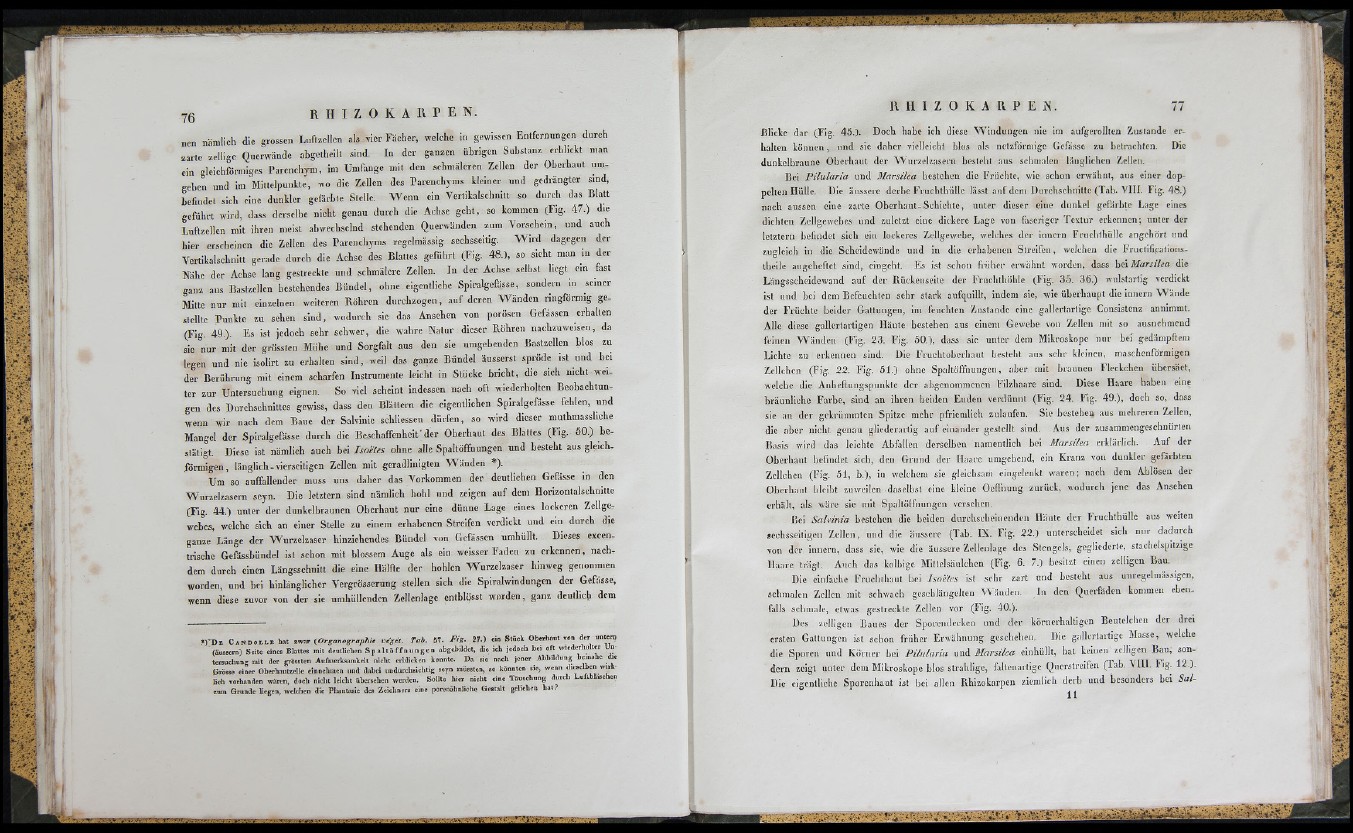
76 R II I Z O K A R P E N.
„cn nämlich die grossen Luftzellcn als vier Fächer, welche in gewissen Entfernungen durch
zarte zellige Querwände abgetheilt sind. In der ganzen übrigen Substanz erblickt man
ein gleichförmiges Parenchym, im Umfange mit den schmäleren Zellen der Oberhaut umgehen
nnd im Mittelpunkte, wo die Zellen des Parenchyms kleiner und gedrängter sind,
befindet sich eine dunkler gelärhte Stelle. Wenn ein Vertikalschnitt so durch das Blatt
geführt wird, dass derselbe nicht genau durch die Achse geht, so kommen (Fig. 47.) die
Luftzellcn mit ihren meist abwechselnd stehenden Querwänden zum Vorschein, und auch
hier erscheinen die Zellen des Parenchyms regelmässig sechsseitig. Wird dagegen der
Vertikalschnilt gerade durch die Achse des Blattes geführt (Fig. 48.), so sieht man in der
Nähe der Achse lang gestreckte und schmälere Zellen. In der Achse selbst hegt cm fast
ganz aus Bastzcilcn bestehendes Bündel, ohne eigentliche Spiralgefässe, sondern in seiner
Mitte nur mit einzelnen weiteren Röhren durchzogen, auf deren Wänden ringförmig gestellte
Punkte zu sehen sind, wodurch sie das Ansehen von porösen Gefässen erhalten
(Fig 49.). Es ist jedoch sehr schwer, die wahre Natur dieser Röhren nachzuweisen, da
sie nur mit der grössten Mühe und Sorgfalt aus den sie umgebenden Bartzellen hlos zu
legen und nie isolirt zu erhalten sind, weil das ganze Bündel äusserst spröde ist und ha
der Berührung mit einem scharfen Instrnmenle leicht in Stücke bricht, die sich nicht weiter
zur Untersuchung eignen. So viel scheint Indessen nach oft wiederholten Beobachtungen
des Durchschnittes gewiss, dass den Blättern die eigentlichen Spiralgefässe fehlen, und
wenn wir nach dem Baue der Salvinie schlicssen dürfen, so wird dieser muthmassllche
Mangel der Spiralgefässe durch die Beschaffenheit'der Oberhaut des Blattes (Fig. 50.) bestätigt.
Diese ist nämlich auch bei IsoSles ohne alle Spaltöffnungen und besteht aus gleich,
förmigen, länglich-vierseitigen Zellen mit geradllnigten Wänden *).
Um so auffallender muss uns daher das Vorkommen der deutlichen Gefässe in den
Wurzelzasern seyn. Die letztem sind nämlich hohl und zeigen auf dem Honzontalsehnitte
(Fig. 44.) unter der dunkelbraunen Oberhaut nur eine dünne Lage eines lockeren Zellgewebes,
welche sich an einer Stelle zu einem erhabenen Streifen verdickt und ein durch die
ganze Länge der Wurzcizascr hinziehendes Bündel von Gefässen umhullt. Dieses exccn-
trische Gefässbündel ist schon mit blossem Auge als ein wcisscr Faden zn erkennen, nachdem
durch einen Längsschnitt die eine Hälfte der hohlen Wurzelzaser hinweg genommen
worden, nnd bei hinlänglicher Vergrössernng stellen sich die Spiralwindungcn der Gefässe,
wenn diese zuvor von der sie umhüllenden Zelienlagc entblösst worden, ganz deutlicli dem
• ) - D . C a u u o c l e hat zwar tO r g e n o s r a p h i e v d g e t . T a h . 67 . F i g . 2 7 .) eia StOek Obarhaot « n der »nlam
(äm itrn ) Se ite e in e . B la tte , mit dentliehen S p a l t ö f f n u n g e n abgehildet, die ich jedoch bei o ft w .ed etho ltc t Un.
ten uchu ng mit der g eös.ten Aufmctl.amke it nicht erblicken konnte. D a .ie nach jener Abb .lilon g bemahc dr.
ß r b ..e einer Oberbaut.elle einnehmen und dabei nn du reh.ieh lig .e y n mräiten, «o könnten .ic , wen n die.clhen wuk-
lieb vorhanden wären, doch nicht leich t ilbcr.eheo werden. So llte hier nicht eine T ä o .eh n n g durch L u ftb te eh en
.um Grunde liegen, welchen die PhanK.ie de . Z e ich n et, eine porenähnliche Ge .ta lt geliehen hat?
R H l Z O K A R P E iN.
ßlicke dar (Fig. 45.). Doch habe ich diese Windungen nie im aufgerollten Zustande erhalten
können, und sie daher vielleicht blos als netzförmige Gefässe zu betrachten. Die
dunkelbraune Oberhaut der Wurzelzasern besieht aus schmalen länglichen Zellen.
Bei Pilularia und Marsilea bestehen die Früchte, wie schon erwähnt, aus einer doppelten
Hülle. Die äussere derbe Fruchthülle lässt auf dem Durchschnitte (Tab. VIH. Fig. 48.)
nach aussen eine zarte Oberhaut-Schichte, unter dieser eine dunkel gefärbte Lage eines
dichten Zellgewebes und zuletzt eine dickere Lage von läseriger Textur erkennen; unter der
letztem befindet sich ein lockeres Zellgewebe, welches der innern Fruchthülle angehört und
zugleich in die Scheidewände und in die erhabenen Streifen, welchen die Fruclifi.catioiis-
theile angeheftet sind, cingeht. Es ist schon früher erwähnt worden, dass \><i\Marsilea die
Längsscheidewand auf der Piückeiiscite der Fruchthöhlc (Fig. 35. 36.) wulstartig verdickt
ist und bei dem Befeucblcn sehr stark aufquillt, indem sie, wie überhaupt die innern Wände
der Früchte beider Gattungen, im feuchten Zustande eine gallertartige Consistenz annimmt.
Alle diese gallertartigen Häute bestehen aus einem Gewebe von Zellen mit so ausnehmend
feinen Wänden (Fig. 23. Fig. 50.), dass sie unter dem Mikroskope mir bei gedämpftem
Lichte zu erkennen sind. Die Fruchtobcrhaul besteht aus sehr kleinen, maschenförmigen
Zellchen (Fig. 22. Fig. 51.) ohne Spaltöffnungen, aber mit braunen Fleckchen übersäet,
welche die Auhcftungspunkte der abgeiiommcncn Filzhaare sind. Diese Haare haben eine
bräunliche Farbe, sind an ihren beiden Enden verdünnt (Fig. 24. Fig. 4 9 ) , doch so, dass
sie an der gekrümmten Spitze mehr pfriemlich zulaufen. Sie bestehen aus mehreren Zellen,
die aber nicht genau gliederartig auf einander gestellt sind. Aus der zusammengcsclinürten
Basis wird das leichte Abfallen derselben namentlich bei Marsilea erklärlich. Auf der
Oberhaut befindet sich, den Grund der Haare umgebend, ein Kranz von dunkler gefärbten
Zellchen (Fig. 51, b ), in welchem sie gleichsam cingclenkt waren; nach dem Ablösen der
Oberhaut bleibt zuweilen daselbst eine kleine Oeffnung zurück, wodurch jene das Ansehen
erhält, als wäre sie mit Spaltöffnungen versehen.
Bei Sahinia bestehen die beiden durchscheinenden Häute der Fruclithülle aus weilen
sechsseitigen Zellen, und die äussere (Tab. IX. Fig. 22.) unterscheidet sich nur dadurch
von der innern, dass sie, wie die äussere Zellcnlage des Stengels, gegliederte, staclielspitzige
Haare trägt. Auch das kolbige Mittelsäuichen (Fig. 6. 7.) besitzt einen zelligen Bau.
Die einfache Frucht haut bei Isoetes ist sehr zart und besteht aus unregelmässigen,
schmalen Zellen mit schwach geschlängelten Wänden. In den Querfäden kommen ebenfalls
schmale, etwas gestreckte Zellen vor (Fig. 40.).
Des zelligen Bancs der Sporcndcckcn und der körncrhaltigen Beutelchcn der drei
ersten Gattungen ist schon früher Erwähnung geschehen. Die gallertartige Masse, welche
die Sporen und Körner bei Pilularia und Marsilea cinhüllt, hat keinen zelligen Bau, sondern
zeigt unter dem Mikroskope blos strahlige, faltenaitige Qucrstreifeii (Tab. \U I . Fig. 12 ).
Die cigciilllche Sporenhaut ist bei allen Bhizokarpen ziemlich derb und besonders bei Sal-
11