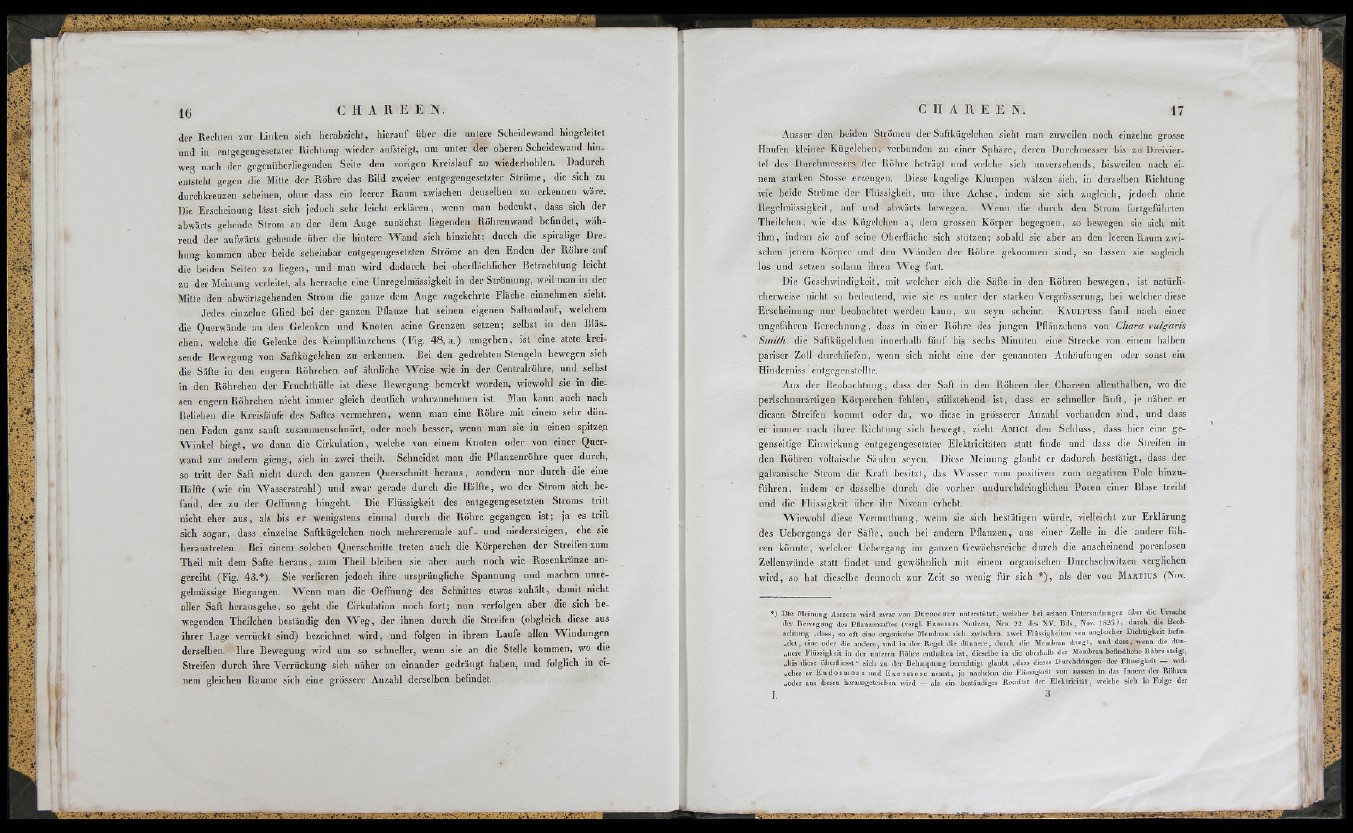
1 6 C H A R E E N .
[■ 'u « ; 7 '
Ml
der Rechten zur Linken sich herabzieht, hierauf über die uniere Scheidewand hingeieitet
und in enigegeugesetzter Richtung wieder aufsteigt, um unter der oberen Scheidewand hinweg
nach der gegenüberliegenden Seite den vorigen Kreislauf zu wiederhohlen. Dadurch
entsteht gegen die Mitte der Röhre das Bild zweier entgegengesetzter Ströme, die sich zu
durchkreuzen scheinen, ohne dass ein leerer Raum zwischen denselben zu erkennen wäre.
Die Erscheinung lässt sich jedoch sehr leicht erklären, wenn man bedenkt, dass sich der
abwärts gehende Strom an der dem Auge zunächst liegenden RÖhrenwand befindet, während
der aufwärts gehende über die hintere Wand sich hinzieht; durch die spiralige Drehung
kommen aber beide scheinbar entgegengesetzten Ströme an den Enden der Röhre auf
die beiden Selten zn liegen, und man wird dadurch bei oberflächlicher Betrachtung leicht
zu der hlelnung verleitet, als herrsche eine Unregelmässigkeit in der Strömung, weil man in der
Mitte den abwärisgchendeu Strom die ganze dem Auge zugekehrte Fläche einnehmen sieht.
Jedes einzelne Glied bei der ganzen Pflanze hat seinen eigenen Saftumlanf, welchem
die Querwände an den Gelenken und Knoten seine Grenzen setzen; selbst in den Bläschen,
welche die Gelenke des Keirnpflänzchens (Flg. 48, a.) umgeben, ist eine stete kreisende
Bewegung von Saflkügelclien zu erkennen. Bei den gedrehten Stengeln bewegen sich
die Säfte In den engem Röhrchen auf ähnliche Weise wie in der Centralröhre, und selbst
in den Röhrchen der Fruclithülle ist diese Bewegung bemerkt worden, wiewohl sie in diesen
engem Röhrchen nicht immer gleich deutlich wahrzunehmen ist. Man kann auch nach
Belieben die Kreisläufe des Saftes vermehren, wenn man eine Röhre mit einem sehr dünnen
Faden ganz sanft zusammenschnürt, oder noch besser, wenn man sie in einen spitzen
Winkel biegt, wo dann die Clrkulatlon, welche von einem Knoten oder von einer Querwand
zur ändern gieng, sich in zwei thellt. Schneidet man die Pflanzenröhre quer durch,
so tritt der Saft nicht durch den ganzen Querschnitt heraus, sondern nur durch die eine
Hälfte (wie ein Wasserstrahl) und zwar gerade durch die Hälfte, wo der Strom sich befand,
der zu der Oeffnung bingeht. Die Flüssigkeit des entgegengesetzten Stroms tritt
nicht eher aus, als bis er wenigstens einmal durch die Röhre gegangen ist; ja es trift
sich sogar, dass einzelne Saftkügelchen noch mehreremale auf- und niedersteigen, ehe sie
herauslreten. Bei einem solchen Querschnitte treten auch die Körperchen der Streifen zum
Theil mit dem Safte heraus, zum Theil bleiben sie aber auch noch wie Rosenkränze angerellit
(Fig. 43.*). Sie verlieren jedoch ihre ursprüngliche Spannung und machen nnregelmässige
Biegungen. Wenn man die Oeffnung des Schnittes etwas zuhält, damit nicht
aller Saft hcrausgehe, so geht die Cirkulation noch fort; nun verfolgen aber die sieb bewegenden
Theilchen beständig den W e g , der ihnen durch die Streifen (obgleich diese aus
ihrer Lage verrückt sind) bezeichnet wird, und folgen in ihrem Laufe allen Windungen
derselben. Ihre Bewegung wird um so schneller, wenn sie an die Stelle kommen, wo die
Streifen durch ihre WuTÜckung sich näher an einander gedrängt haben, und folglich in einem
gleichen Raume sich eine grössere Anzahl derselben befindet.
C II A R E E N.
Ausser den beiden Strömen der Saflkügelclien siebt man zuweilen noch einzelne grosse
Haufen kleiner Kügelchen, verbunden zu einer Sphäre, deren Durchmesser bis zu Dreivier-
tcl des Durchmessers der Röhre beträgt und welche sich unverschends, bisweilen nach einem
starken Slosse erzeugen. Diese kugelige Klumpen wälzen sich, ln derselben Pachtung
wie beide Strome der Flüssigkeit, um ihre Achse, indem sie sich zugleich, jedoch ohne
Regelmässigkeil, auf und abwärts liewegen. Wenn die durch den Strom fortgcfülirlen
Theilchen, wie das Kügelchen a, dem grossen Körper begegnen, so bewegen sie sich mit
ihm, indem sie auf seine Oberfläche sich stützen; sobald sie aber an den leeren Pvaum zwischen
jenem Körper und den Wanden der Röhre gekommen sind, so lassen sie sogleich
los und setzen sodann ihren W eg fort.
Die Geschwindigkeit, mit welclier sich die Säfte in den Röhren bewegen, ist natürlicherweise
nicht so bedeutend, wie sie es unter der starken Yergrösserung, bei welcher diese
Erscheinung nur beobachtet Muerden kann, zn seyn scheint. KaULFüSS fand nach einer
ungefähren Berechnung, dass in einer Piöhre des jungen Pflänzchens von Chara vulgaris
Srniih. die Saftkügelchen innerhalb fünf big sechs Minuten eine Strecke von einem halben
pariser Zoll durchliefen, wenn sich nicht eine der genannten Anhäufungen oder sonst ein
Hinderniss enfgcgenslcllle.
Aus der Beobachtung, dass der Saft in den Röhren der Chareen allenthalben, wo die
perlschiiurartlgen Körperchen fehlen, stillstehend ist, dass er schneller läuft, je näher er
diesen Streifen kommt oder da, wo diese in grösserer Anzahl vorhanden sind, und dass
er immer nach ihrer Piichlung sich bewegt, zieht AmiCI den Schluss, dass hier eine gegenseitige
Einwirkung entgegengesetzter ElcktiTcItätcii statt finde und dass die Slrcifen in
den Piöhren voltaische Säulen seyen. Diese Meinung glaubt er dadurch beslätigt, dass der
galvanische Strom die Kraft besilzl, das Wasser vom positiven zum negativen Pole hinzu-
führeu, indem er dasselbe durch die vorher undurchdringlichen Poren einer Blase treibt
und die Flüssigkeit über ihr Niveau erhebt.
Wiewohl diese Vermuthung, wenn sie sich bestätigen würde, vielleicht zur Erklärung
des TJchergangs der Säfte, auch bei ändern Pflanzen, aus einer Zelle in die andere führen
könnte, welcher Uchergang im ganzen Gewächsreichc durch die anscheinend porenlosen
Zcilenwäiide statt findet und gewöhnlich mit einem organischen Durchschwitzen verglichen
wird, so hat dieselbe dennoch zur Zeit so wenig für sich * ), als der von M a r T Iü S ( N ov.
* ) D ie Meinung A ihicis
der B ew egu n g des Pfln
achtung „dass, so oft
„ d c t, eine oder cl
„ncre Flüssigkeit
„bis diese iibcrftii
„dies er E n d o s
I .
unterstützt, welcher bei seinen Untcrsuchiingen über die Ursache
i Notizen, Nro. 2 2 . des XV. Bds., Nov. 1 8 2 6 .), durch die Beobich
zwischen zwe i Flüssigkeiten von ungleicher D ich tigk e it befin-
die dünnere, durdi die Membran dringt, und d a ss, wenn die dün-
en is t , dieselbe in die oberhalb der Membran befindliche Röhre steigt,
berechtigt glaubt „dass dieses D urdid ringen der Flüssigkeit — wcl-
je nachdem die Flüssigkeit von aussen in das Innere der Röhren
in beständiges Resultat der Elek tr icitä t, welche sich in F o lg e der
3
»IBö
ÌÌ--XiI
iÍ!
i