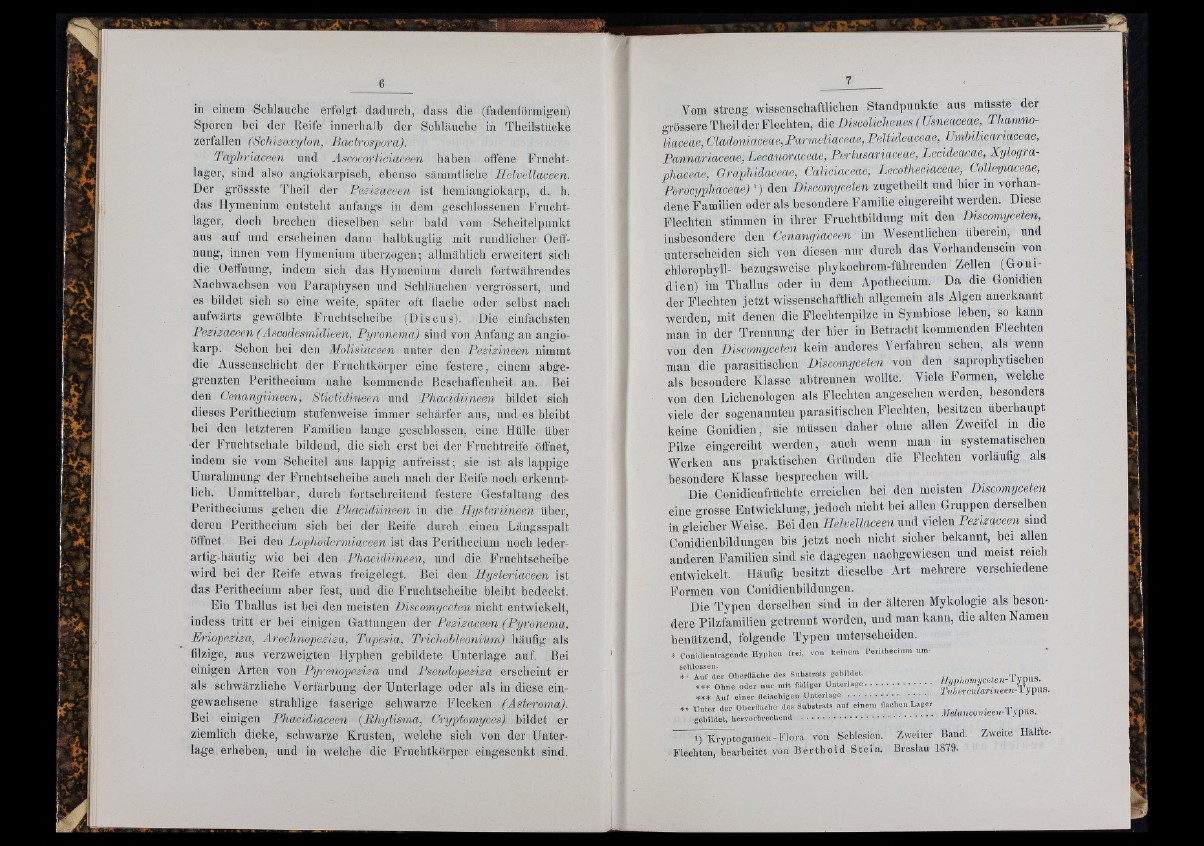
in einem Schlauche erfolgt dadurch, dass die (fadenförmigen)
Sporen bei der Keife innerhalb der Schläuche in TheilstUcke
zerfallen (Scliizoxyhm, liactrospora).
Taphriaceen und Ascocorticiaceen haben offene Fruchtlager,
sind also angiokarpiscli, ebenso sänimtliohe Helvellaceen.
Der grössste Theil der Fezizaceen ist hemiangiokarp, d. li.
das Hymenium entstellt anfangs in dem geschlossenen Fruchtlager,
doch brechen dieselben sehr bald vom Scheitelpunkt
aus aut und erscheinen dann halbkuglig mit rundlicher Oeff-
nung, innen vom Hymenium überzogen; allmählich erweitert sich
die Oeffimng, indem sich das Hymenium durch fortwährendes
Nachwachseil von Paraphysen und Schläuchen vergrössert, und
es bildet sich so eine weite, später oft flache oder selbst nach
aufwärts gewölbte Fruclitsclieibe (Discus). Die einfachsten
Pezizaceen (Ascodesmidieen, Pyronema) sind von Anfang an angio-
karp. Schon bei den Alolisiaceen unter den Pezizineen nimmt
die Ausseiiscliicht der Fruchtkörper eine festere, einem abgegrenzten
Perithecium nahe kommende Beschaffenheit an. Bei
den Cenangiineen, Stictidineen und Phaeidiineen bildet sich
dieses Perithecium stufenweise immer schärfer aus, und es bleibt
bei den letzteren Familien lange geschlossen, eine Hülle über
der Fruchtscliale bildend, die sich erst bei der Fruchtreife öffnet,
indem sie vom Scheitel aus lappig aufreisst; sie ist als lappige
Umrahmung der Fruclitsclieibe auch nach der Keife noch erkenntlich.
Unmittelbar, durch fortschreitend festere Gestaltung des
Peritheciums gehen die Phaeidiineen in die Hysterimeen über,
deren Perithecium sich bei der Keife durch einen .Längsspalt
öffnet Bei den Lophodermiaceen ist das Perithecium noch lederartig
häutig wie bei den Phaeidiineen, und die Fruchtscheibe
wird bei der Reife etwas freigelegt. Bei den Hysteriaceen ist
das Perithecium aber fest, und die Fruchtscheibe bleibt bedeckt.
Ein Thallus ist bei den meisten Discomyceten nicht entwickelt,
indess tritt er bei einigen Gattungen der Pezizaceen (Pyronema,
Eriopeziza, Arochnopeziza, Tapesia, Trichohleonium) häufig als
filzige, aus verzweigten Hyphen gebildete Unterlage auf. Bei
einigen Arten von Pyrenopeziza und Pseudopeziza erscheint er
als schwärzliche Verfärbung der Unterlage oder als in diese eingewachsene
strahlige faserige schwarze Flecken (Asteroma).
Bei einigen Phacidiaceen {Bhytisma, Cryptomyces) bildet er
ziemlich dicke, schwarze Krusten, welche sich von der Unterlage
erheben, und in welche die Fruchtkörper eingesenkt sind.
Vom streng wissenschaftlichen Standpunkte aus müsste der
grössere Theil der Flechten, die Discolichenes (Usneaceae, Thamno-
liaceae, Cladoniaceae,Parmeliaceae, Peltideaceae, UmUhcariaceae,
Pannariaceae,Lecanoraceae, Pertusariaceae, Lecideacae, Xylogra-
phaceae, GrapUdaceae, Caliciaceae, Lecotheciaceae, Collemceae,
Porocyphaceae) ' ) den Discomyceten zugetheilt und hier in vorhandene
Familien oder als besondere Familie eingereiht werden. Diese
Flechten stimmen in ihrer Fruchtbildung mit den Discomyceten,
insbesondere den Cenangiaceen im Wesentlichen überein, und
unterscheiden sich von diesen nur durch das Vorhandensein von
Chlorophyll- bezugsweise phykochrom-führenden Zellen ^(C^oni-
dien) im Thallus oder in dem Apothecium. Da die Gonidien
der Flechten jetzt wissenschaftlich allgemein als Algen anerkannt
werden, mit denen die Flechtenpilze in Symbiose leben, so kann
man in der Trennung der hier in Betracht kommenden Flechten
von den Discomyceten kein anderes Verfahren sehen, als wenn
man die parasitischen Discomyceten von den saprophytischen
als besondere Klasse abtrennen wollte. Viele Formen, welche
von den Lichenologen als Flechten angesehen werden, besonders
viele der sogenannten parasitischen Flechten, besitzen überhaupt
keine Gonidien, sie müssen daher ohne allen Zweifel in die
Pilze eingereiht werden, auch wenn man m systematischen
Werken aus praktischen Gründen die Flechten vorläufig als
besondere Klasse besprechen will.
Die Conidienfrüchte erreichen bei den meisten Discomyceten
eine grosse Entwicklung, jedoch nicht bei allen Gruppen derselben
in gleicher Weise. Bei den Helvellaceen und vielen Pezizaceen sind
Conidienbildungeii bis jetzt noch nicht sicher bekannt, bei allen
anderen Familien sind sie dagegen nachgewiesen und meist reich
entwickelt. Häufig besitzt dieselbe Art mehrere verschiedene
Formen von Conidienhilduiigen.
Die Typen derselben sind in der älteren Mykologie als besondere
Pilzfamilien getrennt worden, und man kann, die alten Namen
benützend, folgende Typen unterscheiden.
* C iin id ien tra g en c le H y p lte n fre i, v o n k e in em P e ritlie e ium um -
s c h lo s s e n .
Auf der Oberfl.äche des Substrats gebildet. U u v h o m m e t e n - T y v n s .
* « Ohne oder n u r n u t S « ® « r u L r c l r i n e e n - T y p ^ S .
Auf einer fleischigen Unterlage ..........................
* . u n te r der Oberfläche des Substrats auf einem «achen Lager , „ 3 ,
g e b ild e t, h e r v o v b re c h e n d .............................................................
4 ) K r y p t o g a m e n -F lo r a von Schlesien. Zweiter Band. Zweite Hälfte.
Flechten, bearbeitet von B e r t b o l d S t e i n . Breslau 1879.