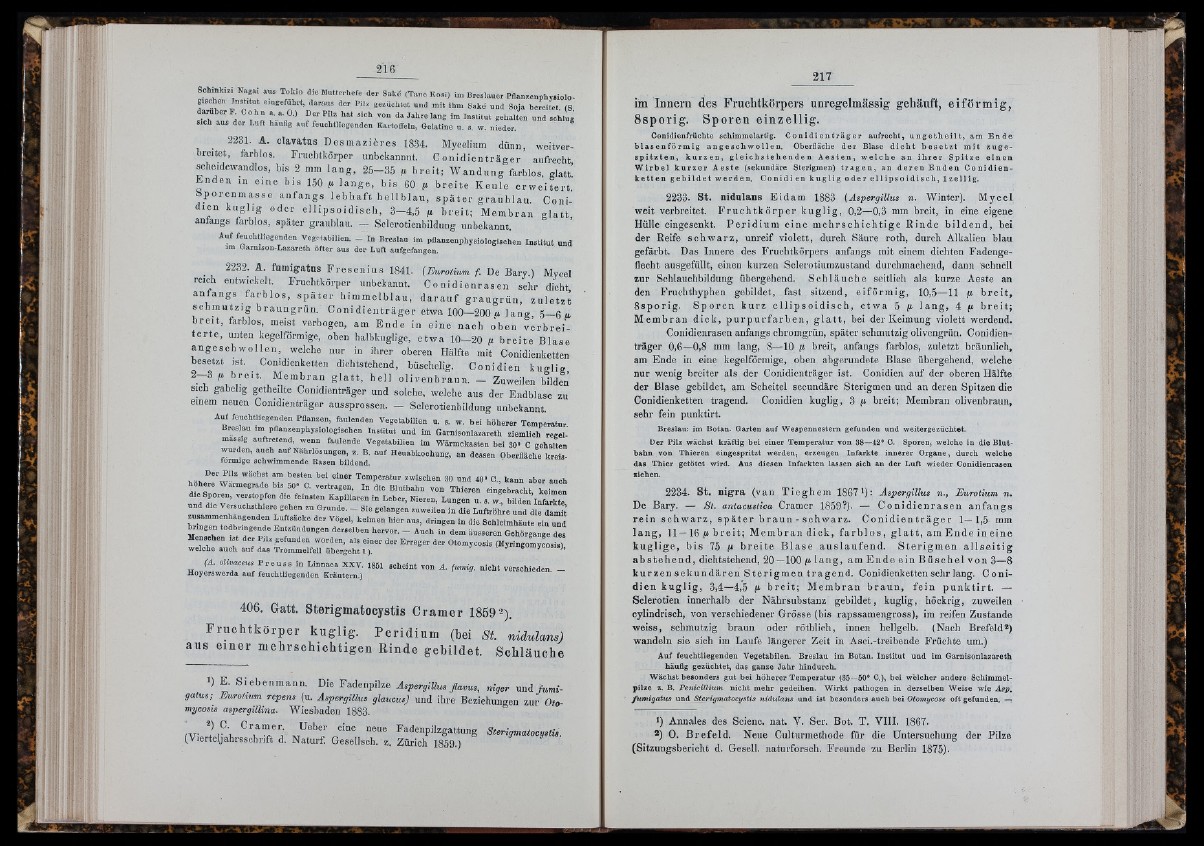
Schinkizi Nagai ans Toldo die Mut.erhofe der Saké (Tane Ko.i) im Breslauer Pflanzenphysiolo-
gisehei. In stitu t eingefnhrt, daraus der Pilz gezuclilet und mit ihm Saké und Soja bereitet fS
d arüber F C o h n a. a. 0.) Der Pilz h a t sieh von da Ja h re lang im In stitu t gehalten und schlug
Bich aus der Luft hauflg auf feuchtliogenden Kartoffeln, Gelatine u. s. w. nieder.
2231. A. olavatns D e sm a z i è r e s 1834. Mycelium dünn, weitverbreitet,
farblos. Fnicbtkörper iinbe tannnt C o n i d i e n t r ä g e r aufrecht
scheidewandlos, bis 2 mm l a n g , 2 5 - 3 5 fl b r e i t ; W a n d u n g farblos, glatt!
E n d e n in e i n e b i s 150 fl l a n g e , b i s 60 fl b r e i t e K e u l e e r w e i t e r t
S p o r e n m a s s e a n f a n g s 1 e b h a f t h e l 1 b l a u , s p ä t e r g r a u b l a u . C o n i d
i e n k u g h g o d e r e l l i p s o i d i s c l i , 3 - 4 , 5 fl b r e i t ; M em b r a n g l a t t
anfangs farblos, späte r graublau. — Sclerotienbildung unbekannt.
Auf feuchUiegenden Vegetabilien. - In Breslau im pllanzenphysiologischen In slilu t und
im Garmsou-Lazareth öfter aus der Luft aufgefangeu.
2232. A. fumig a ta s F r e s e n i u s 1841. (Eurotium f. De Bary.) Mycel
reich entwickelt. Fruchtkörper unbekannt. C o n i d ¡ e n r a s e n sehr dicht
a n f a n g s f a r b l o s , s p ä t e r h im m e l b l a u , d a r a u f g r a u g r ü n , z u l e t z t
s c h m u t z i g b r a u n g r ü n . C o n i d i e n t r ä g e r etwa 100—200«. l a n g , 5—6 fl
b r e i t , farblos, meist verbogen, am E n d e in e i n e n a c h o b e n v e r b r e i t
e r t e , unten kegelförmige, oben halbkuglige, e tw a 1 0 - 2 0 fl b r e i t e B l a s e
a n g e s c h w o l l e n , welche nur in ihrer oberen Hälfte mit Conidienketten
besetzt ist. Conidienketten dichts tehend, büschelig. C o n i d i e n k u g l i g
2 - 3 fl b r e i t . M em b r a n g l a t t , h e l l o l i v e n b r a u n . - Zuweilen bilden
Sich gabehg getheilte Conidienträger und solche, welche aus der Endblase zu
einem neuen Conidienträger aussprossen. - Sclerotienbildung unbekannt.
Auf feuchtliegenden Pdanzen, faulenden Vegetabilien n. s. w. b e i h ö h e re r Temperatur
Breslau im pllanzenphysiologischen In stitu t un d im Garnisonlazareth ziemlich regel-
massig auftretend, wenn faulende Vegetabilien im Wärmekasten bei SO- C gehalten
wurden, auch au f Nährlösungen, z. B. au f Heuabkochnug, an dessen Oberfläche kreis-
formige schwimmende Rasen bildend.
T zwischen 80 und 40- C., k an n ab e r auch
h ö h ere Wärmegrade bis 50- C. vertragen. In die Blulbahn von Thieren ein^ebraeht, keimen
un d d Y T ’ to Nieren, Lungen u. s. w., bilden Infarkte,
un d die Ve rta eh sth iere gehen zu Grunde. - Sie gelangen zuweilen in die Luftröhre un d die damit
zusammenhängenden Luftsacke der Vögel, keimen h ier aus, dringen in die Schleimhäute ein u n d
b ringen todbringende Entzündungen derselben hervor. - Auch in dem äusseren Gehörgange des
Menschen ist der Pilz gefunden worden, als einer der E rreg er der Otomycosis (Myringomycosis),
welche auch auf das Trommelfell übergeht 1 ). y usisj,
(A. olivaceus P r e u s s in Linnaea XXV. 1861 scheint von A. fumig. n ich t verschieden -
Hoyerswerda auf feuchtliegenden Kräutern.)
406. Gatt. Sterigmatocystis Grame r 1859®).
F r u c h tk ö r p e r k u g l ig . P e r id ium (bei 8t. nidulans)
aus e in e r m e h r s c h ic h t ig e n Rinde gehildet. Schläuche
' ) E. S i e b e n m a n n . Die Fadenpilze Aspergillus flavus, niger und fumi-
gatus; Eurohum repens (u. Aspergillus glaucus) und ihre Beziehungen zur Otomycosis
aspergillina. Wiesbaden 1883.
IV n i " ’'®' Fadenpilzgattung Sterigmatocystis.
(Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. z. Zürich 1859.)
im Innern des Fruchtkörpers unregelmässig gehäuft, e ifö rmig ,
Ssporig. Sporen e inzellig.
Conidienfrüchte schimmelartig. C o n i d i e n t r ä g e r a u fre ch t, u n g e t h e i l t , am E n d e
b l a s e n f ö rm i g a n g e s c h w o l l e n . Oberfläche d e r Blase d i c h t b e s e t z t m i t z u g e s
p i t z t e n , k u r z e n , g l e i c h s t e h e n d e n A e s t e n , w e l c h e a n i h r e r S p i t z e e i n e n
W i r b e l k u r z e r A e s t e {sekundäre Sterigmen) t r a g e n , a n d e r e n E n d e n C o n i d i e n k
e t t e n g e b i l d e t w e r d e n . C o n i d i e n k u g l i g o d e r e l l i p s o i d i s c h , I z e l l i g .
2233. St . n id n lan s E i d am 1883 [Aspergillus n. Winter). M y c e l
weit verbreitet. F r u c h t k ö r p e r k u g l i g , 0,2—0,3 mm breit, in eine eigene
Hülle eingesenkt. P e r i d i u m e i n e m e h r s c h i c h t i g e R i n d e b i l d e n d , bei
der Reife s c h w a r z , unreif viole tt, durch Säure roth, durch Alkalien blau
gefärbt. Das Innere des Fruchtkörpers anfangs mit einem dichten Fadengeflecht
ausgefüllt, einen kurzen Sclerotiumzustand durchmachend, dann schnell
zur Schlauchbildung übergehend. S c h l ä u c h e seitlich als kurze Aeste an
den Fruchthyphen gebildet, fast sitzend, e i f ö rm i g , 10,5—11 y b r e i t ,
S s p o r i g . S p o r e n k u r z e l l i p s o i d i s c h , e tw a 5 y l a n g , 4 y b r e i t ;
M e m b r a n d i c k , p u r p u r f a r b e n , g l a t t , bei der Keimung violett werdend.
Conidienrasen anfangs chromgrün, später schmutzig olivengrün. Conidienträger
0,6—0,8 mm lang, 8—10 y breit, anfangs farblos, zuletzt bräunlich,
am Ende in eine kegelförmige, oben abgerundete Blase übergehend, welche
nur wenig breiter als der Conid ienträger ist. Conidien auf der oberen Hälfte
der Blase gebildet, am Scheitel secundäre Sterigmen und an deren Spitzen die
Conidienketten tragend. Conidien kuglig, 3 fi breit; Membran olivenbraun,
sehr fein punktirt.
Breslau: im Botan. Garten au f Wespennestern gefunden und weitergezüchtet.
Der Pilz wächst kräftig bei ein er T em peratur von 38—42« C. Sporen, welche in die B lu tb
ah n von T hieren eingespritzt werden, erzeugen In fa rk te in n ere r Organe, du rch welche
das Thier getötet wird. Aus diesen In fark ten lassen sich an der Luft wieder Conidienrasen
ziehen.
2234. St , n i g r a (v a n T i e g h e m 1867 ' ) : Aspergillus n., Eurotium n.
De Bary. — S t. antacustica Cramer 1859?). — C o n i d i e n r a s e n a n f a n g s
r e i n s c h w a r z , s p ä t e r b r a u n - s c h w a r z . C o n i d i e n t r ä g e r 1—1,5 mm
l a n g , 11 —16 ft b r e i t ; M em b r a n d i c k , f a r b l o s , g l a t t , am E n d e in e i n e
k u g l i g e , b i s 75 y b r e i t e B l a s e a u s l a u f e n d . S t e r i g m e n a l l s e i t i g
a b s t e h e n d , dichtstehend, 2 0—100 f t l a n g , a m E n d e e i n B ü s c h e l v o n 3—8
k u r z e n s e k u n d ä r e n S t e r i g m e n t r a g e n d . Conidienketten sehr lang. C o n i d
i e n k u g l i g , 3,4—4,5 ft b r e i t ; M e m b r a n b r a u n , f e i n p u n k t i r t . —
Sclerotien innerhalb der Nährsubstanz gebildet, kuglig, höckrig , zuweilen
cylindrisch, von verschiedener Grösse (bis rapssamengross), im reifen Zustande
weiss, schmutzig braun oder röth lich, innen hellgelb. (Nach Brefeld*)
wandeln sie sich im Laufe längerer Zeit in Asci.-treibende Früchte um.)
Auf feuchtliegenden Vegetabilen. Breslau im Botan. In stitu t un d im Garnisonlazareth
häufig gezüchtet, das ganze J a h r hindurch.
W äch st besonders gut bei h ö h e re r T em peratur {35—50« C.), bei welcher an d ere Schimmelpilze
z. B. Pénicillium n ich t m eh r gedeihen. W irk t pathogen in derselben Weise wie Asp.
fum ig a tu s un d Sterigmatocystis n idulans und ist besonders auch bei Otomycose oft gefunden. —
1) Annales des Scienc. nat. V. Ser. Bot. T. VIII . 1867.
*) 0 . B r e f e l d . Neue Culturmethode für die Untersuchung der Pilze
(Sitzungsbericht d. Ge se l l naturforsch. Freunde zu Berlin 1875).