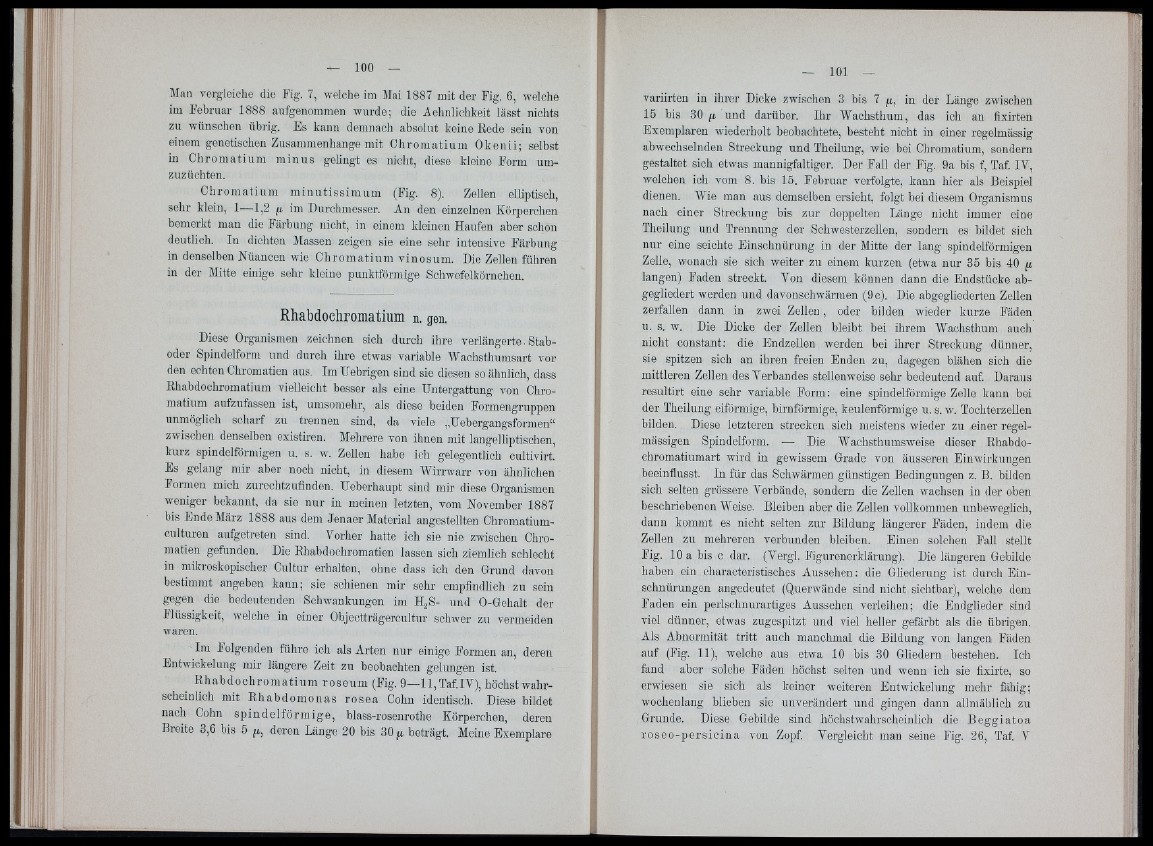
Man vergleiche die Fig. 7, welche im Mai 1887 mit der Fig. 6, welche
im Februar 1888 aufgenommen wurde; die Aehnlichkeit lässt nichts
zu Avünschen übrig. Es kann demnach absolut keine Eede sein von
einem genetischen Zusammenhänge mit C h rom a tium O k e n ii; selbst
in C h rom a tium m in u s gelingt es nicht, diese kleine Form umzuzüchten.
C h rom a tium m in u ti s s im u m (Fig. 8). Zellen elliptisch,
sehr klein, 1— 1,2 ¡i im Durchmesser. An den einzelnen Körperclien
bemerkt man die Färbung nicht, in einem kleinen Haufen aber schon
deutlich. In dicliten Massen zeigen sie eine selir intensive Färbung
in denselben Nüancen ivie C h rom a tium v in o sum . Die Zellen führen
in der Mitte einige sehr kleine punktförmige Scliwefelkörnchen.
Rhabdoehromatium n, gen.
Diese Organismen zeichnen sich durch ihre verlängerte. Staboder
Spindelform und durch ihre etwas variable Wachsthumsart vor
den ecliten Chromatien aus. Im Uebrigen sind sie diesen so älmlich, dass
Ehabdochromatium vielleicht besser als eine Untergattung von Chro-
matiiim aufzufassen ist, umsomehr, als diese beiden Formengruppen
unmöglich scharf zu trennen sind, da viele ,,Uebergangsformen“
zwischen denselben existiren. Mehrere von ihnen mit langelliptischen,
kurz spindelförmigen u. s. w. ZeUen habe ich gelegentlich cultivirt.’
Es gelang mir aber noch nicht, in diesem Wirrwarr von ähnlichen
Eormen mich zurechtzufinden. Ueberhaupt sind mir diese Organismen
weniger bekannt, da sie n u r in meinen letzten, vom November 1887
bis Ende März 1888 aus dem Jenaer Material angestellten Chromatium-
culturen anfgetreten sind. Vorher hatte ich sie nie zwischen Chromatien
gefunden. Die Ehabdochromatien lassen sich ziemlich schlecht
in mikroskopischer Cultur erhalten, ohne dass ich den Grund davon
bestimmt angeben kann; sie schienen mir sehr empfindlich zu sein
gegen die bedeutenden Schwankungen im HjS- und 0-Gehalt der
Flüssigkeit, weiche in einer Objectträgercultur schwer zu vermeiden
■waren.
Im Folgenden führe ich als Arten n u r einige Formen an, deren
Enhvickelung mir längere Zeit zu beobachten gelungen ist.
^ E h a b d o c h rom a tium ro s e um (Fig. 9—1 1 ,Taf.IV), höchstwahrscheinlich
mit E h a b d om o n a s ro s e a Cohn identisch. Diese bildet
nach Cohn s p in d e lf ö rm ig e , blass-rosenrothe Körperchen, deren
Breite 3,6 bis 5 ft, deren Länge 20 bis 30 ft beträgt. Meine Exemplare
variirten in ihrer Dicke zwischen 3 bis 7 f t , in der Länge zwischen
15 bis 30 ft und darüber. Ih r Wachsthum, das ich an fixirten
Exemplaren wiederholt beobachtete, besteht nicht in einer regelmässig
abwecliselnden Streckung und Theilung, wie bei Chromatium, sondern
gestaltet sich etwas mannigfaltiger. Der Pall der Fig. 9a bis f, Taf. IV,
welchen ich vom 8. bis 15. Februar verfolgte, kann liier als Beispiel
dienen. Wie man aus demselben ersieht, folgt bei diesem Organismus
nach einer Streckung bis zu r doppelten Länge nicht immer eine
Theilung und Trennung der Scliwesterzellen, sondern es bildet sich
n u r eine seichte Einschnürung in der Mitte der lang spindelförmigen
Zelle, wonach sie sich weiter zu einem kurzen (etwa n u r 35 bis 40 ¡i
langen) Faden streckt. Von diesem können dann die Endstücke ah-
gegliedert werden und davon schwärmen (9 c). Die abgegiiederten Zellen
zerfallen dann in zwei Zellen, oder bilden wieder kurze Fäden
u. s. AV. Die Dicke der Zellen bleibt bei ihrem Wachsthum auch
nicht constant; die Endzeilen werden bei ihrer Streckung dünner,
sie spitzen sich an ihren freien Enden zu, dagegen blähen sich die
mittleren Zellen des Verbandes stellenweise sehr bedeutend auf. Daraus
resnltirt eine selir variable Form: eine spindelförmige Zelle kann bei
der Theilung eiförmige, bimförmige, keulenförmige u. s. w. Tochterzellen
bilden. Diese letzteren strecken sich meistens Avieder zu einer regelmässigen
Spindelform. — Die Wachsthumsweise dieser Ehabdo-
chromatiumart Avird in gewissem Grade von äusseren Einwirkungen
beeinflusst, ln für das Schwärmen günstigen Bedingungen z. B. bilden
sich selten grössere Verbände, sondern die Zellen wachsen in der oben
beschriebenen Weise. Bleiben aber die Zellen vollkommen unbeAveglich,
dann kommt es nicht selten zu r Bildung längerer Fäden, indem die
Zellen zu mehreren verbunden bleiben. Einen solclien IGll stellt
Fig. 10 a bis c dar. (Vergl. Figurenerklärung). Die längeren Gebilde
haben ein cliaracteristisches Aussehen: die Gliederung ist durcli Einschnürungen
angedeutet (QuerAvände sind nicht sichtbar), welche dem
Faden ein perlsclmurartiges Aussehen verleihen; die Endglieder sind
viel dünner, etwas zugespitzt und viel heller gefärbt als die übrigen.
Ais Abnormität tritt auch manchmal die Bildung von langen Fäden
auf (Fig. 11), Avelche aus etAva 10 bis 30 Gliedern bestehen. Ich
fand aber solche Fäden höchst selten und wenn ich sie fixirte, so
erwiesen sie sich als keiner weiteren Entwickelung mehr fähig;
wochenlang blieben sie unverändert und gingen dann allmählich zu
Grunde. Diese Gebilde sind höchstAvahrscheinlich die B e g g ia to a
r o s e o - p e r s i c in a a'ou Zopf Vergleicht man seine Fig. 26, Taf. V