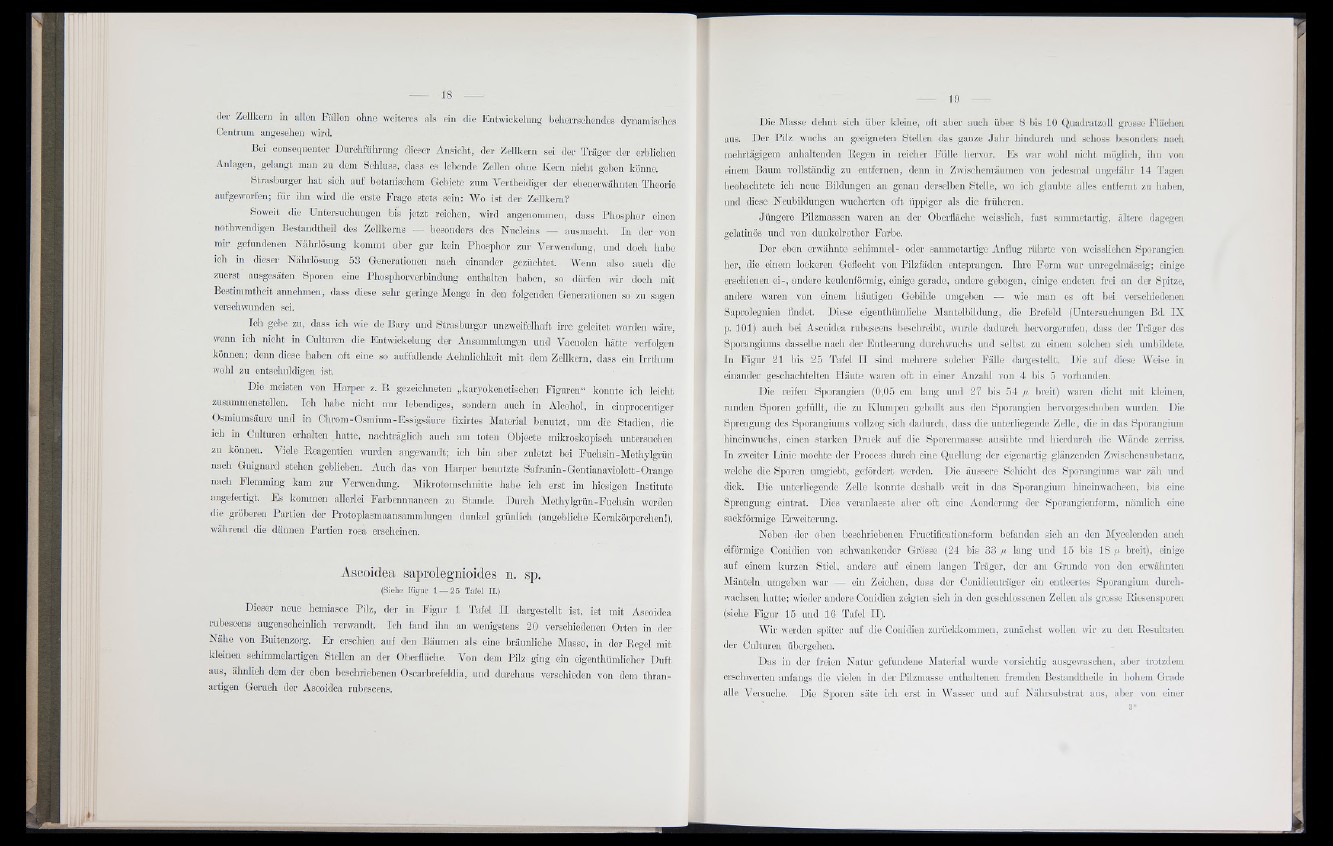
iliT Z d lkm i ¡11 allm Füllen ohne weiteres als ein die Entwickduiig hdiciTsdiondes dynainisdies
Cenlruni ang'eselion wird.
Bei con.soiiuenter Dnrdifüliriing dieser Aiisidit, der Zellkern sei der Träger dev erblidieii
Anlagen, gelangt man zu dem Schluss, dass es lebende Zellen ohne Kern niclit geben könne.
Strasburger bat sidi auf botaiiiselicm Gebiete zum Vertlieidiger der ebenerwäbiiten Tlieorie
anfgeworl'en; für hin wird die erste Frage stets sein: W o ist der Zellkern?
Soweit die ünter.snelumgen bis jetzt reichen, wird angcnomnien, dass Bliosplior einen
notliwendigcii Bestandtheil des Zellkerns — besonders des Nucleins — ausmadit. In der von
mir gefnudeiien Nälirlösimg kommt aber gar kein Phosphor zur Verwendniig, und doch habe
id i in dieser Nährlösung ,03 Generationen nach einander gezüchtet. lYeiin also auch die
zuerst ausgesäteii Sporen eine Pliospliorverhindung eiitlialteii haben, so dürfen wir doch mit
Bestimmtheit aimdimeii, dass diese sehr geringe Menge in den folgenden Generationen so zu sagen
versclnvunden sei.
Ich gebe zu, dass ich wie de Bary und Strashurger unzweifelhaft irre geleitet worden wäre,
wenn leli niclit in Culturen die Eiitwickelmig der Ansammlungen und Vacuolen liätte Tcrfolgen
kömieii; denn diese haben oft eine so anffallemle Aelmliehkoit mit dem Zellkern, dass ein Irrtlmm
wolil zu entseliuldigen ist.
Die meisten von Harper z. E. gezeichneten „karyokenetiselieii Figuren“ konnte ich leicht
ziisammenstellcn. Ich luihe nicht nur lebendiges, sondern auch in Alcohol, in eiiiprocentiger
Osmiumsäure und in Chroin-Osmium-Essigsäiire fixirtes Material benutzt, um die Stadien, die
ich in Culturen erhalten liatte, nachträglich auch am toten Objecte mikroskoiiiseli untersnclicn
zu können. Viele Keagentien wurden angewandt; ich bin aber zuletzt bei Fuchsin-Metliylgrün
nach Gingiiard stehen geblieben. Auch das von Harper benutzte Safranin-Gentianaviolett-Orange
nach Flemming kam zur Verwendung. Jlikrotomschnitte habe ich erst im hiesigen Tiistitiite
angefertigt. Es kommen allerlei Farbemmaneeii zu Stande. Durch ]\.[ethylgrün-FueIisin werden
die gröberen Partien der Protoplasmaansammlungen dunkel grünlich {angebiiehe Kernkörperelieii!),
während die dünnen Partien rosa erscheinen.
Ascoidea saprolegnioides n. sp.
(Siehe Figur 1 — 2 5 Tafel IL)
Dieser neue hemiasce Pilz, der in Figur 1 Tafel I I dargestellt ist, ist mit Ascoidea
rubescens augenscheinlich verwandt. Ieh fand ihn an wenigstens 20 verschiedenen Orten in der
Nähe von Euiteiizorg. E r erschien auf den Bäumen als eine bräunliche Masse, in der Regel mit
kleinen selnnimelartigen Stellen an der Oliorfhiclie. Von dem Pilz ging ein eigenüüimlieher DuCt
aus, ähnlich dem der ehen beschriebenen Oscarbrefeldia, und durchaus verschiedciii von dom thran-
artigen Geruch der Ascoidea rubescens.
Die Masse dehnt sich über kleine, oft aber auch ülier 8 bis 10 (¿uadratzoll grossii Fläelien
aus. Der Pilz wuchs an geeigneten Stellen das ganze J a h r hindurch und schoss besonders nach
mehrtägigem anhaltenden Regen in reicher Fülle hervor. Es war wohl nicht möglich, ilin von
einem Baum vollständig zu entfernen, denn in Zwiselienränmen von jedesmal ungefähr 14 Tagen
beobachtete ich neue Bildungen an genau derselben Stelle, wo ieh glaubte alles entfernt zu lialieu,
und diese Neubildungen wucherten oit üppiger als die früheren.
Jüngere Pilzmassen 'waren an der Oberfläche weisslich, fast Bammetartig, ältere: dagegen
gelatinös und von dimkelrotlier Farbe.
Der eben erwähnte scliimmel- oder sammetartige Anflug rührte von weisslichen Sporangien
her, die einem lockeren Geflecht von Pilzfäden entsprangen. Ihre Form war unregelmässig; einige
erschienen ei-, andere keulenförmig, einige gerade, andere gebogen, einige endeten frei an der Spitze,
andere waren von einem häutigen Gebilde umgeben — wie man es oft bc*i verschiedenen
Saprolegnien findet. I.)iese eigenthümliche i\Iantell)ildung, die Brefeld (Untersuclmngen Bd. IX
p. 101) auch bei Ascoidea rubciscens beschreibt, wurde daduivh hervorgerufen, dass der Träger des
Sporangiums dasselbe nach der Entleenmg dnrehwuehs und selbst zu einem solchen sieh iimhihlete.
In Figur 21 bis 25 Tafel I I sind mehrere solcher Fälle daigestellt. Die auf diese Weise in
einander geschachtelten Häute 'waren oft in einer j\.nzahl von 4 bis 5 vorhanden.
Die reifen Sporangieif (0,05 cm lang und 27 bis 54 /i breit) waren dicht mit kleinen,
runden Sporen gefüllt, die zu Klampen gehallt aus den Sporangien hervorgesehoben wurden. I)ie
Sprengung des Sporangiums vollzog sich dadurch, dass die mitcrliegendc Zelle, die in das Sporangium
hineinwiTchs, einen starken Druck auf die Sporenmasse ausül)te und hierdurch die Wände zerriss.
In zweiter Linie mochte der Process durch eine Quellung der eigenartig glänzenden Zwiscliensuhsfanz,
welche die Sporen umgiebt, gefördert werden. Die äussere Schicht des Sporangiums war zäh und
diek. Die unterliegende Zelle konnte deshalb weit in das Sporangium hineinwachsen, bis eine
Sprengung eintrat. Dies veranlasste aber oft eine Aenderung der Sporaiigienform, nämlich eine
sackförmige Erweiterung.
Neben der oben beschriebenen Fructificationsform befanden sieh an den Mycelenden auch
eiförmige Conidien von sclnvankendor Grösse (24 bis 38 /t lang und 15 bis 18 fi breit), einige
auf einem kurzen Stiel, andere auf einem langen Träger, der am Grunde von den erwähnten
Mänteln umgehen war — ein Zeichen, dass der Conidienträger ein entleertes Sporangium durchwachsen
hatte; wieder andere Conidien zeigten sich in den geschlossenen Zellen als grosse Riesensporen
(siehe Figur 15 und IG Tafel IT).
W ir werden später auf die Conidien zurückkommen, zunächst wollen wir zu den Resultaten
der Culturen ühcrgehen.
Das in der freien Natur gefundene iNfaterial wurde vorsichtig ausgewaschen, aber trotzdem
erselnverten anfangs die vielen in der Pilzniasse enthaltenen fremden Bestandtheile in hohem Grade
alle Versuche. Die Sporen säte ieh erst in "Wasser und auf Nährsuhstrat aus, aber von einer