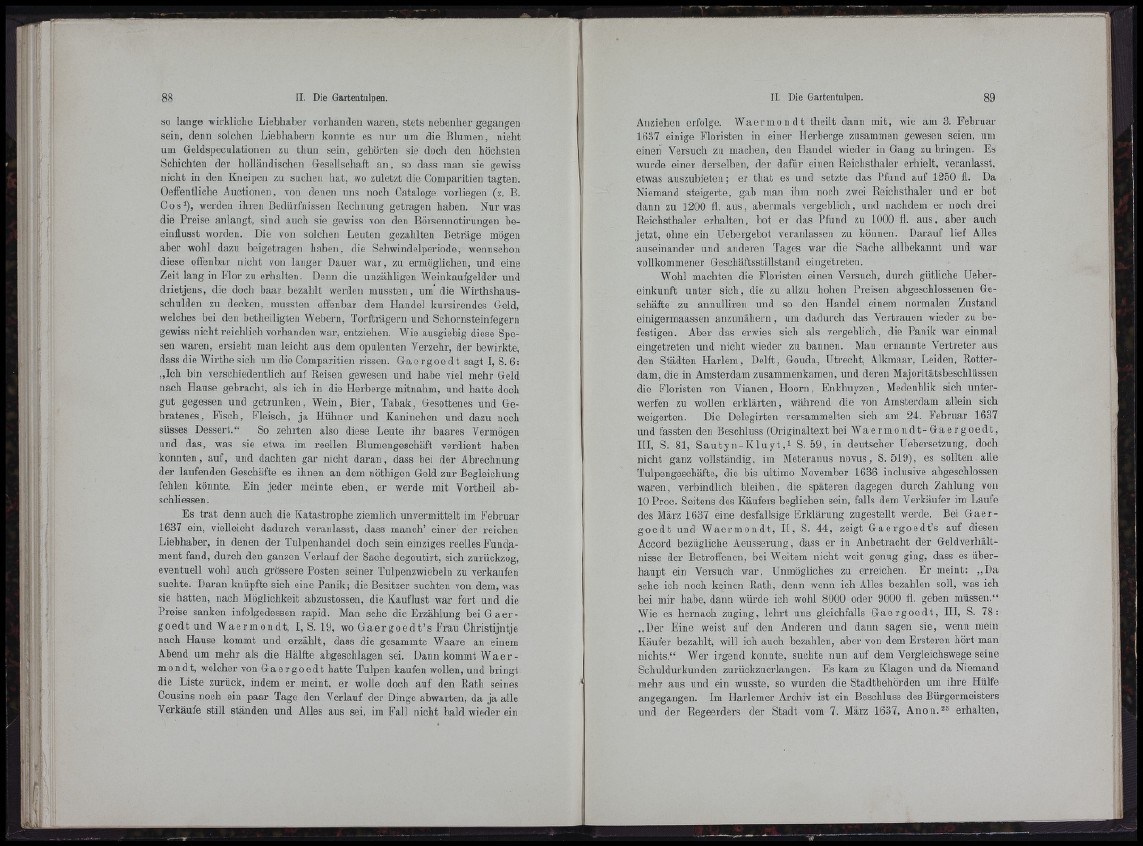
so lange wirkliche Liebhaber vorhanden waren, stets nebenher gegangen
sein, denn solchen Liebhabern konnte es n u r um die Blumen, nicht
um Geldspeculationen zu thun sein, gehörten sie doch den höchsten
Schichten der holländischen Gesellschaft a u , so dass man sie gewiss
nicht in den Kjieipen zu suchen hat, wo zuletzt die Comparitien tagten.
Oeffentliche Auctionen, von denen uns noch Cataloge vorliegen (z. B.
C o s *), werden ihren Bedürfnissen Rechnung getragen haben. Nur was
die Preise anlangt, siud auch sie gewiss von den Börsennotirungen beeinflusst
worden. Die von solchen Leuten gezahlten Beträge mögen
aber wohl dazu beigetragen haben, die Scbwindclperiode, wennschon
diese offenbar nicht von langer Dauer wa r, zu ermöglichen, und eine
Zeit lang in Flor zu erhalten. Denn die unzähligen Weinkaufgelder und
drietjens, die doch baar bezahlt werden muss ten, um die Wirthshaus-
schulden zu decken, mussten offenbar dem Handel kursirendes Geld,
welches bei den betheiligten Webern, Torfträgern und Schornsteinfegern
gewiss nicht reichlich vorhaTiden war, entziehen. Wie ausgiebig diese Spesen
waren, ersieht man leicht aus dem opulenten Verzehr, der bewirkte,
dass die Wirthe sich um die Comparitien rissen. G a e r g o e d t sagt I, S. 6:
„Ich bin verschiedentlich auf Reisen gewesen und habe viel mehr Geld
nach Hause gebracht, als ich in die Herberge mitnahm, und hatte doch
gut gegessen und getrunken, We in , Bie r, Tabak, Gesottenes und Gebratenes,
Fisch, Fleisch, j a Hühner und Kaninchen und dazu noch
süsses Dessert.“ So zehrten also diese Leute ih r baares Vermögen
und das , was sie etwa im reellen Blumengeschäft verdient haben
konnten, auf, und dachten gar nicht d a r a n , dass bei der Abrechnung
der laufenden Geschäfte es ihnen an dem nöthigen Geld zur Begleichung
fehlen könnte. Ein jeder meinte eben, er werde mit Vortheil ab-
schliessen.
Es t r a t denn auch die Katastrophe ziemlich unvermittelt im Februar
1637 ein, vielleicht dadurch veranlasst, dass manch’ einer der reichen
Liebhaber, in denen der Tulpenhandel doch sein einziges reelles F u n d a ment
fand, durch den ganzen Verlauf der Sache degoutirt, sich zurückzog,
eventuell wohl auch grössere Posten seiner Tulpenzwiebeln zu verkaufen
suchte. Daran knüpfte sich eine Panik; die Besitzer suchten von dem, was
sie hatten, nach Möglichkeit abzustossen, die Kauflust war fort und die
Preise sanken infolgedessen rapid. Man sehe die Erzählung bei G a e r g
o e d t und W a e r m o n d t , I, S. 19, wo G a e r g o e d t ’s Frau Christijntje
nach Hause kommt und erzählt, dass die gesammte Waare an einem
Abend um mehr als die Hälfte abgeschlagen sei. Dann kommt W a e r mon
d t , welcher von G a e r g o e d t hatte Tulpen kaufen wollen, und bringt
die Liste zurück, indem er meint, er wolle doch auf den Ra th seines
Cousins noch ein paa r Tage den Verlauf der Dinge abwarten, da j a alle
Verkäufe still ständen und Alles aus sei, im Fa ll nicht hald wieder ein
Anziehen erfolge. W a e r m o n d t theilt dann m it, wie am 3. Februar
1637 einige Floristen in einer Herberge zusammen gewesen seien, um
einen Versuch zu machen, den Handel wieder iu Gang zu bringen. Es
wurde einer derselben, der dafür einen Reiclisthaler erhielt, veranlasst,
etwas auszubieten; er th a t es und setzte das Pfund auf 1250 fl. Da
Niemand steigerte, gab man ihm noch zwei Reichsthaler und er bot
dann zu 1200 fl. aus , abermals vergeblich, und nachdem er noch drei
Reichsthaler e rha lten, bot er das Pfund zu 1000 fl. a u s , aber auch
jetzt, ohne ein Uebergebot veranlassen zu können. Darauf lief Alles
auseinander und anderen Tages war die Sache allbekannt und war
vollkommener Gescbäftsstillstand eingetreten.
Wohl machten die Floristen einen Versuch, durch gütliche Ueher-
einkunft unte r sich, die zu allzu hohen Preisen abgeschlossenen Geschäfte
zu annulliren und so den Handel einem normalen Zustand
einigermaassen a n z u n ä h e rn , um dadurch das Vertrauen wieder zu befestigen.
Aber das erwies sich als vergeblich, die Panik war einmal
eingetreten und nicht wieder zu bannen. Mau ernannte VerHeter aus
den Städten Harlem, Delft, Gouda, Utrecht, Alkmaar, Leiden, Rotterdam,
die in Amsterdam zusammenkamen, und deren Majoritätsbeschlüssen
die Floristen von V ia n e n , Hoorn, Enkhuyzen, Medenblik sich unte rwerfen
zu wollen e rk lä rte n , während die von Amsterdam allein sich
weigerten. Die Delegirten versammelten sich am 24. Februar 1637
und fassten den Beschluss (Originaltext bei W a e r m o u d t - G a e r g o e d t ,
III, S. 81, S a u t y n - K l u y t , * S. 59, in deutscher Uebersetzung, doch
nicht ganz vollständig, im Meteranus novus, S. 519), es sollten alle
Tulpengeschäfte, die bis ultimo November 1636 inclusive abgeschlossen
waren, verbindlich bleiben, die späteren dagegen durch Zahlung vou
10 Proc. Seitens des Käufers beglichen sein, falls dem Verkäufer im Laufe
des März 1637 eine desfallsige Erk lä ru n g zugestellt werde. Bei G a e r g
o e d t und W a e r m o n d t , I I , S. 4 4 , zeigt G a e r g o e d t ’s auf diesen
Accord bezügliche Aeusserung, dass er in Anbetracht der Geldverhältnisse
der Betroffenen, bei Weitem nicht weit genug ging, dass es überhaup
t ein Versuch war. Unmögliches zu erreichen. E r meint: „D a
sehe ich noch keinen Rath, denn wenn ich Alles bezahlen soll, was ich
bei mir habe, dann würde ich wohl 8000 oder 9000 fl. geben müssen.“
Wie es hernach zuging, le h rt uns gleichfalls G a e r g o e d t , III, S. 78:
„D e r Eine weist auf den Anderen und dann sagen sie, wenn mein
Käufer bezahlt, will ich auch bezahlen, aber von dem Ers teren hört man
nichts.“ Wer irgend konnte, suchte nun auf dem Vergleichswege seine
Schuldurkunden zurückzuerlaugen. Es kam zu Klagen und da Niemand
mehr aus und ein wusste, so wurden die Stadtbehörden um ihre Hülfe
angegangen. Im Harlemer Archiv ist ein Beschluss des Bürgermeisters
und der Regeerders der Stadt vom 7. März 1637, Anon.®» erhalten.