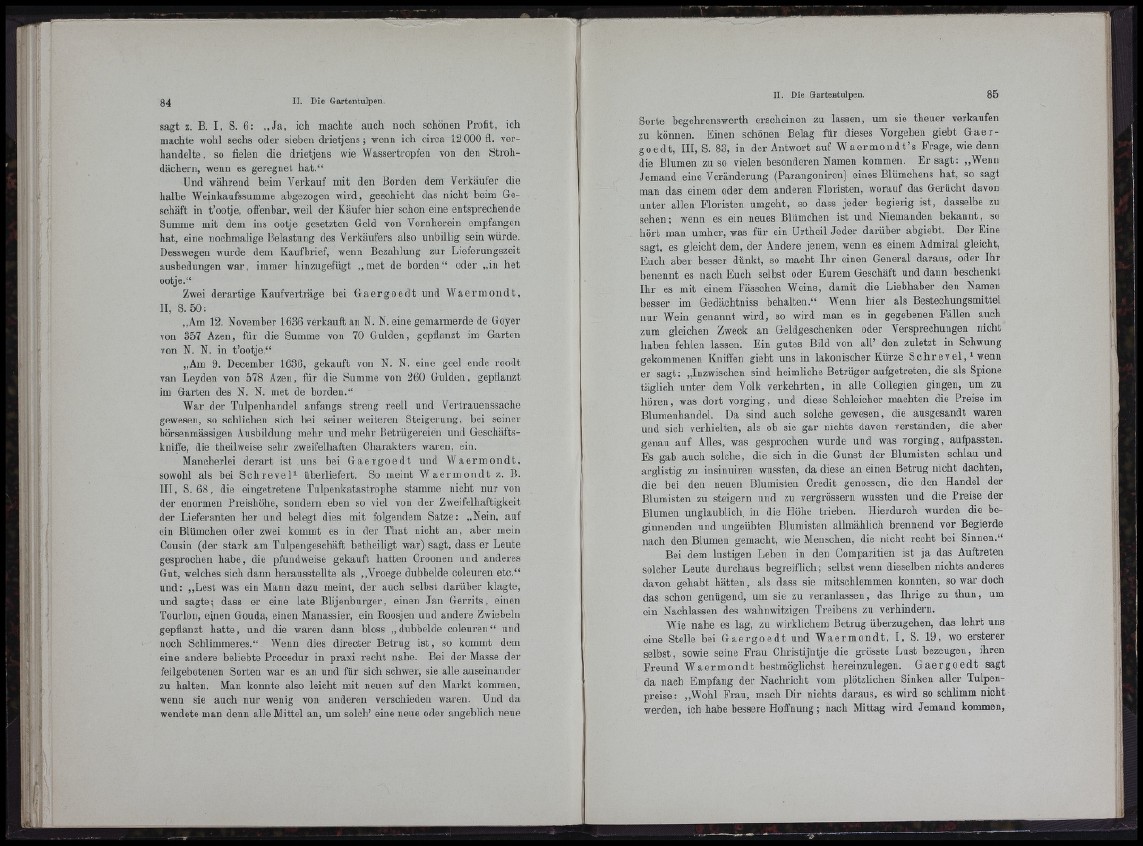
sagt z. B. I , S. 6: „ J a , ich machte auch noch schönen Profit, ich
machte wohl sechs oder sieben d r ie tjen s ; wenn ich circa 12 000 fl. verhande
lte , so fielen die drietjens wie Wassertropfen von den Strohdächern,
wenn es geregnet h a t .“
Und während beim Verkauf mit den Borden dem Verkäufer die
halbe Weinkaufssumme abgezogen wird, geschieht das nicht beim Geschäft
in t ’ootje, offenbar, weil der Käufer hier schon eine entsprechende
Summe mit dem ins ootje gesetzten Geld von Vornherein empfangen
hat, eine nochmalige Belastung des Verkäufers also unbillig sein würde.
Desswegen wurde dem Kaufbrief, wenn Bezahlung zur Lieferungszeit
ausbedungen war, immer hiuzugefügt „me t de b o rd e n “ oder „ in h e t
ootje.“
Zwei derartige Kaufverträge bei G a e r g o e d t und W a e r m o n d t ,
II, S. 50;
,,Am 12. November 1636 verkauft an N. N. eine gemarmerde de Goyer
von 357 Azen, für die Summe von 70 Gulden, gepflanzt im Garten
von N. N. in t ’ootje.“
„Am 9. December 1636, gekauft von N. N. eine geel ende roodt
van Leyden von 578 Azen, für die Summe von 260 Guldeu, gepflanzt
im Garten des N. N. met de borden.“
Wa r der Tulpenhaudel anfangs streng reell und Vertrauenssache
gewesen, so schlichen sich bei seiner weiteren Steigerung, bei seiner
börsenmässigen Ausbildung mehr u n d mehr Betrügereien und Geschäftskniffe,
die theilweise sehr zweifelhaften Charakters waren, ein.
Mancherlei de ra rt ist .uns bei G a e r g o e d t und W a e r m o n d t ,
sowohl als bei S c h r e v e l * überliefert. So meint W a e r m o n d t z. B.
I I I , S. 68 , die eingetretene Tulpenkatastrophe stamme nicht n u r von
der enormen Preishöhe, sondern eben so viel von der Zweifelhaftigkeit
der Lieferanten her und belegt dies mit folgendem Satze: „Nein, auf
ein Blümchen oder zwei kommt es in der T h a t nicht an , aber mein
Cousin (der s tark am Tulpengeschäft betheiligt war) sagt, dass er Leute
gesprochen h ab e , die pfundweise gekauft hatten Croonen und anderes
Gut, welches sich dann herausstellte als ,,Vroege dubbelde coleuren etc.“
und: ,,Lest was ein Mann dazu meint, der auch selbst da rüb e r klagte,
und sagte; dass er eine late Blijen b u rg e r, einen J a n Ge rrits , einen
Tourion, epien Gouda, einen Manassier, ein Roosjen und andere Zwiebeln
gepflanzt h a t te , und die waren dann bloss „dubbe lde coleuren“ und
noch Schlimmeres.“ Wenn dies directer Betrug i s t , so kommt dem
eine andere beliebte Procedur in praxi re ch t nahe. Bei der Masse der
feilgebotenen Sorten war es an und für sich schwer, sie alle auseinander
zu halten. Man konnte also leicht mit neuen auf den Markt kommen,
wenn sie auch n u r wenig von anderen verschieden waren. Und da
wendete man denn alle Mittel an, um solch’ eine neue oder angeblich neue
Sorte begehrenswerth erscheinen zu lassen, um sie theuer verkaufen
zu können. Einen schönen Belag für dieses Vorgehen giebt G a e r g
o e d t , III, S. 83, in der Antwort auf W a e r m o n d t ’s Frage, wie denn
die Blumen zu so vielen besonderen Namen kommen. E r s a g t: „Wenn
Jemand eine Veränderung (Parangoniren) eines Blümchens hat, so sagt
man das einem oder dem anderen Floristen, worauf das Gerücht davon
unte r allen Floristen umgeht, so dass jeder begierig is t , dasselbe zu
sehen; wenn es ein neues Blümchen ist und Niemanden bekannt, so
h ö rt man umher, was für ein Urtheil Jeder darüber abgiebt. Der Eine
sagt, es gleicht dem, der Andere jenem, wenn es einem Admiral gleicht.
Euch aber besser dünkt, so macht Ih r einen General daraus, oder Ih r
benennt es nach Euch selbst oder Eurem Geschäft und dann beschenkt
Ih r es mit einem Fässchen Weins, damit die Liebhaber den Namen
besser im Gedächtniss behalten.“ Wenn hier als Bestechungsmittel
uur Wein genannt wird, so wird man es in gegebenen Fällen auch
zum gleichen Zweck an Geldgeschenken oder Versprechungen nicht
haben fehlen lassen. Ein gutes Bild vou a ll’ den zuletzt in Schwung
gekommenen Kniffen giebt uns in lakonischer Kürze S c h r e v e l , * wenn
er sagt: „Inzwischen sind heimliche Betrüger aufgetreten, die als Spione
täglich unte r dem Volk v e rkehrten, in alle Collégien gingen, um zu
h ö r e n , was dort v o rg in g , und diese Schleicher machten die Preise im
Blumenhandel. Da sind auch solche gewesen, die ausgesandt waren
und sich verhielten, als ob sie gar nichts davon verständen, die aber
genau auf Alles, was gesprochen wurde und was vorging, aufpassten.
Es gab auch solche, die sich in die Gunst der Blumisten schlau und
arglistig zu insinuiren wussten, da diese an einen Betrug nicht dachten,
die bei den neuen Blumisten Credit genossen, die den Handel der
Blumisten zu steigern und zu vergrössern wussten und die Preise der
Blumen unglaublich, in die Höhe trieben. Hierdurch wurden die beginnenden
und ungeübten Blumisten allmählich brennend vor Begierde
nach den Blumen gemacht, wie Menschen, die nicht recht bei Sinnen.“
Bei dem lustigen Leben in den Comparitien ist ja das Auftreten
solcher Leute durchaus begreiflich ; selbst wenn dieselben nichts anderes
davon gehabt h ä t te n , als dass sie mitschlemmen konnten, so war doch
das schon genügend, um sie zu veranlassen, das Ihrige zu th u n , um
ein Nachlassen des wahnwitzigen Treibens zu verhindern.
Wie nahe es lag, zu wirklichem Betrug überzugehen, das leh rt uns
eine Stelle bei G a e r g o e d t und W a e r m o n d t , I , S. 19, wo ersterer
selbst, sowie seine F ra u Christij'ntje die grösste Lus t bezeugen, ihren
Freund W a e r m o n d t bestmöglichst hereinzulegen. G a e r g o e d t sagt
da nach Empfang der Nachricht vom plötzlichen Sinken aller Tulpenpreise:
„Wohl Frau, mach Dir nichts daraus, es wird so schlimm nicht
werden, ich habe bessere Hoffnung ; nach Mittag wird Jemand kommen,